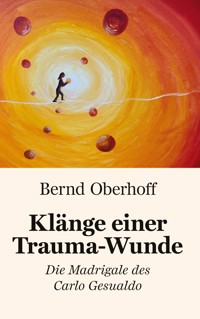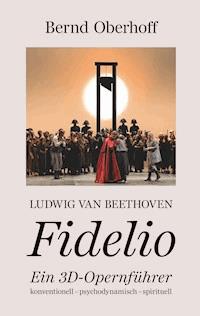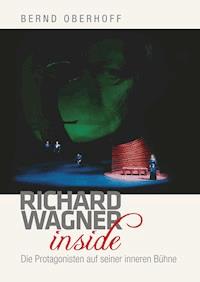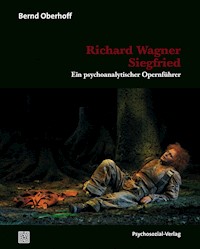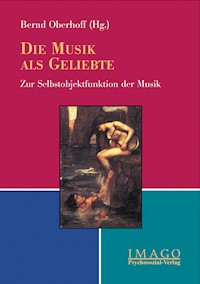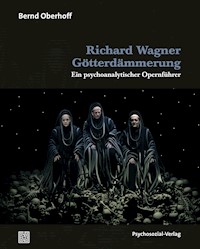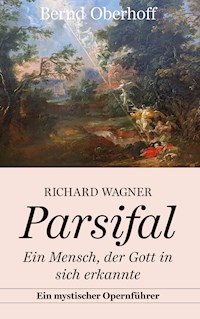
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
In Richard Wagners Weiheoper Parsifal begegnen sich buddhistische Spiritualität und christliche Mystik, um gemeinsam jenen dornenreichen Pilgerpfad zu schildern, auf dem die individuelle Seele - ja, die ganze Menschheit - wandern muss, wenn sie den göttlichen Wesenskern im eigenen Inneren entdecken will.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Einleitung
I. Akt: Auf dem Weg nach innen
1. Der geheimnisvolle Weckruf des Grals
2. Parsifal – Ein Mensch, der nicht weiß, wer er ist
3. Kundry – Die Schlange
4. Unterwegs auf buddhistischen Pfaden
a) Die Schlange in der indischen Mythologie
b) Das Erwachen der Kundalini
c) Musik-Meditation: Die „Kundalini-Motive“
5. Unterwegs auf christlichen Pfaden
a) Der Gral und die Gralszeremonie
b) Das Schreiten zur Gralsburg – Ein Weg nach innen
c) Titurel – Ein lebendiger Toter
d) Amfortas – Die Wunde des Menschen der Gegenwart
e) Die Grals-Speisung mit der violetten Flamme
f) Parsifal wird auf seinen Weg gestoßen
g) Musik-Meditation: Das „Motiv des spirituellen Weges“
6. Überblick: Auf dem Weg nach innen
II. Akt: Im Prüfungsland
1. Klingsor und Kundry – Ein teuflisches Duo
2. Der Wonnegarten – Die verlockende Schönheit der sinnlichen Natur
3. Die Verführungskünste der Kundry
4. Meditation: Blumenmädchen und Mutter Herzeleide
5. Klingsor – Ein Luzifer in der menschlichen Seele
6. Der innere Kampf gegen die luziferischen Verführungskräfte
7. Parsifals Herz erwacht zu Gefühlen des Mitleids
8. Parsifal gewinnt an Weisheit
9. Kundry – Die niedere und potenziell Höhere Seele Parsifals
10.Die Erfahrung des „Christus in mir“
11. Schlussszene: Christus und Luzifer
12.Überblick: Im Prüfungsland
III. Akt: Seelenreinigung, Erleuchtung, Einswerdung mit dem Göttlichen
1. Der Prozess der Seelenreinigung
a) Die demutsvolle Hingabe an den göttlichen Willen
b) Die Ich-Überwindung
c) Rechter Wille und rechtes Tun: Der Speer
d) Buße und Reue: Die Befreiung von Schuld und Sünde
e) Die Tilgung von Karma-Lasten
f) Die Salbung zum Gralskönig
2. Die Erleuchtung
a) Die Verklärung der äußeren Welt: Der „Karfreitagszauber“
b) Das Aufstrahlen des inneren Lichts: Der Gral
c) Musik-Meditation: Liebe – Glaube –: Hoffen?
3. Am Ziel des mystischen Weges: Die Erkenntnis des Göttlichen im eigenen Inneren
a) Amfortas – Die Bereitschaft zur Ich-Überwindung
b) Kundry – Die Geburt des Höheren Selbst in der Seele
c) Parsifal – Der vollendete Mensch der Zukunft
Literatur
Bildnachweis
Einleitung
„Die Wahrheit liegt in uns;
Was wir auch glauben mögen,
Zutiefst besteht in uns ein Mittelpunkt,
Wo Wahrheit wohnt in Fülle;
Doch ringsum lauter Wälle;
Das grobe Fleisch, das schließt uns ein.“
Robert Browning (1812-1889)
Im fernen Thailand erzählt man sich eine wundersame Geschichte: In einer Tempelanlage nahe der Stadt Sukhothai stand einst eine uralte Buddha-Statue. Sie war aus einfachem Ton gefertigt und nicht unbedingt schön. Aber sie hatte viele Generationen, Naturkatastrophen und Kriege überlebt und schon deshalb wurde sie geliebt und verehrt. Eines Tages entdeckten die Mönche, dass die Statue Risse bekam. Einer dieser Risse hatte sich in einem besonders heißen Sommer so stark verbreitert, dass man in das Innere der Statue hineinschauen konnte. Ein Mönch leuchtete mit einer Fackel dort hinein und bemerkte zu seiner Überraschung einen goldenen Schimmer. Als er schließlich ganz hineinkroch, stand er vor einer der größten und schönsten Goldstatuen, die je vom Buddha angefertigt worden war. Scharen von Pilgern reisten nun heran, um diesen goldenen Buddha zu sehen und zu ihm zu beten. Offensichtlich war die Goldstatue deswegen mit Ton ummantelt worden, um sie in kriegerischen Zeiten vor Raub oder Beschädigung zu schützen.
Warum erzähle ich Ihnen diese Geschichte? Ich denke, dass diese Geschichte sich als ein geeignetes Modell anbietet, um zum verborgenen Kern von Wagners Bühnenweihfestspiel Parsifal vorzudringen. Wenn wir nur dasjenige Bühnengeschehenzur Kenntnis nehmen, das unsere Augen und Ohren uns übermittelt, dann kann es sein, dass wir nur einem aus einfachem Ton gefertigten Parsifal begegnen, der „nicht unbedingt schön“ ist. Wenn wir aber wie der Mönch von Sukhothai verfahren und auf Risse achtgeben, die sich im sichtbaren Geschehen auf der Bühne auftun, so könnte sich möglicherweise auch für uns ein Tor zu einem „goldenen“ Geheimnis öffnen, das uns wundersame Kunde übermittelt.
Normalerweise verfährt man mit Rissen in Gegenständen so, dass man sie kittet und wieder verschließt, damit der vertraute Anblick zurückkehrt. Und viele Bürger von Sukhothai wären sicherlich auch so verfahren. Doch einer der Mönche hatte die Idee und den Mut, einmal mit der Fackel in die Risse hineinzuleuchten. Und nicht nur das. Er hat es schließlich sogar gewagt, hineinzukriechen, das heißt, er hat den Weg nach innen gewählt und ist dort auf einen goldglänzenden Kern gestoßen, gleichsam auf einen „Mittelpunkt, wo Wahrheit wohnt in Fülle“, wie Robert Browning es im einleitenden Zitat ausgedrückt hat.
Vielleicht vermag uns ja auch Wagners Weiheoper Parsifal auf ihrer inneren Bühne mit solch einem goldglänzenden Heiligtum, etwa einem alles überstrahlendem Gral zu überraschen. Wer ist der Gral? Auf diese Frage des jungen Parsifal entgegnet der weise Gurnemanz am Ende des 1. Aufzugs: „Das sagt sich nicht.“ Doch das muss ja nicht das letzte Wort sein. Vielleicht sagt es sich ja doch, zum Beispiel dann, wenn wir uns den Mönch von Sukhothai zum Vorbild nehmen und zusammen mit dem jungen Parsifal wagemutig der Spur des Weges nach innen folgen.
I. Akt: Auf dem Weg nach innen
1. Der geheimnisvolle Weckruf des Grals
Wenn sich der Vorhang hebt, schaut der Zuschauer auf einen Wald, der sich „schattig und ernst, doch nicht düster“ präsentiert. Weiter heißt es:
„Eine Lichtung in der Mitte. Links aufsteigend wird der Weg zur Gralsburg angenommen. Der Mitte des Hintergrundes zu senkt sich der Boden zu einem tiefer gelegenen Waldsee hinab. – Tagesanbruch.
Gurnemanz (rüstig greisenhaft) und zwei Knappen (von zartem Jünglingsalter) sind schlafend unter einem Baume gelagert. – Von der linken Seite, wie von der Gralsburg her, ertönt der feierliche Morgenweckruf der Posaunen“ (Bühnenanweisung).
Das Bühnenweihfestspiel beginnt also mit einem Weckruf. Der greise Gralsbruder Gurnemanz rüttelt die jungen Knappen wach und gebietet ihnen, Gott dafür zu danken, dass sie dazu berufen sind, den aus der Gralsburg herübertönenden Weckruf zu vernehmen.
Gurnemanz (erwachend und die Knappen rüttelnd)
He! Ho! Waldhüter ihr,
Schlafhüter mitsammen,
so wacht doch mindest am Morgen!
(Die beiden Knappen springen auf)
Hört ihr den Ruf? Nun danket Gott,
daß ihr berufen, ihn zu hören!
(Er senkt sich mit den Knappen auf die Knie und verrichtet mit ihnen gemeinschaftlich stumm das Morgengebet)
Dann erheben sich alle drei, denn es ist Zeit, das morgendliche Bad des siechen Gralskönigs Amfortas im Waldsee vorzubereiten. Zwei Ritter erscheinen und berichten, dass die geheimnisvolle Wunde des Königs (eine Verwundung in der Leiste) durch das Heilkraut, das der Ritter Gawan „mit List und Kühnheit“ gewonnen hatte, keine Linderung erfahren hat.
Gurnemanz (das Haupt traurig senkend)
Toren wir, auf Lind’rung da zu hoffen,
wo einzig Heilung lindert!
Nach allen Kräutern, allen Tränken forscht
und jagt weit durch die Welt:
ihm hilft nur eines –
nur der Eine.
Zweiter Ritter
So nenn uns den!
Wie es scheint, ist Gurnemanz nicht in der Stimmung, weitere Auskünfte zu erteilen. Doch die Musik hat es bereits verraten, woran Gurnemanz gedacht hat. Den Verszeilen „ihm hilft nur eines – nur der Eine“ ist der Beginn eines musikalischen Motivs unterlegt, das sowohl auf den Heilsweg wie auch auf jenen Heilsbringer hinweist, der einmal kommen wird, um die Wunde des Amfortas zu heilen. So jedenfalls ist es dem Gralskönig prophezeit worden. Man nennt es deshalb das „Prophezeiungs-Motiv“:
Notenbeispiel Nr. 1
„Prophezeiungs-Motiv“
Die Musik verbleibt in einer Andeutung und dabei wollen auch wir es hier belassen. Dieses Motiv wird uns später noch ausführlicher beschäftigen. Doch schon hier erhalten wir einen Hinweis darauf, dass die Musik oftmals mehr weiß, als die beteiligten Protagonisten. Das sollte uns darauf einstimmen, im weiteren Gang durch dieses Werk, der Musik mit einer besonderen Achtsamkeit zu begegnen.
Gurnemanz‘ Einlassungen werden auch dadurch unterbrochen, dass urplötzlich eine wilde Reiterin – untermalt von einem dramatischen Orchestergetöse – heranprescht. Es ist Kundry, die sich hier geräuschvoll nähert. Sollte es Zufall sein, dass dieses Wesen just in dem Moment auf der Bildfläche erscheint, wo Gurnemanz darüber sinniert, wer oder was Heilung bringen könnte?
Musikalisch stellt sich diese Protagonistin durch mehrere durchaus gegensätzliche Motive vor. Wir hören zum einen eine stark rhythmisierte, kraftvoll aufwärts drängende Bewegung, die aber augenscheinlich durch starke Gegenkräfte daran gehindert wird, an Höhe zu gewinnen.
Notenbeispiel Nr. 2
Kundry-Motiv I
Dann gelingt kurzfristig ein Ausbruch, der in der Höhe auf einer schrillen Dissonanz im ff endet, worauf ein dramatischer Absturz (ebenfalls im ff) in tiefste Tiefen folgt. Dieser rasante Absturz in die Tiefe bildet ein zweites Motiv, das der herannahenden wilden Reiterin zuzuordnen ist.
Notenbeispiel Nr. 3
Kundry-Motiv II
Musikalisch kündigt sich also eine höchst dramatische Figur an, die hektisch agiert und von einer großen Unruhe ergriffen ist. Sie drängt gewaltsam in die Höhe, stürzt aber immer wieder ab. Das hektische Wesen dieser „Wilden“ findet in ihrem Aussehen eine Entsprechung:
„Wilde Kleidung, hoch geschürzt; Gürtel von Schlangenhäuten lang herabhängend; schwarzes, in losen Zöpfen flatterndes Haar; tief braun-rötliche Gesichtsfarbe; stechende schwarze Augen, zuweilen wild aufblitzend, öfters wie todesstarr und unbeweglich“ (Bühnenanweisung).
Die Knappen kommentieren die Ankunft dieser Protagonistin folgendermaßen:
Zweiter Knappe
Seht dort die wilde Reiterin!
Erster Knappe
Hei!
Wie fliegen der Teufelsmähre die Mähnen!
Zweiter Ritter
Ha! Kundry dort.
Erster Ritter
Die bringt wohl wicht’ge Kunde?
Zweiter Knappe
Die Mähre taumelt
Erster Knappe
Flog sie durch die Luft?
Zweiter Knappe
Jetzt kriecht sie am Boden hin.
Erster Knappe
Mit den Mähnen fegt sie das Moos
(Alle blicken lebhaft nach der rechten Seite.)
Zweiter Ritter
Da schwingt sich die Wilde herab!
Völlig außer Atem eilt diese dramatische Person auf Gurnemanz zu und drängt ihm ein Kristallgefäß auf, mit den hastig hingeworfenen Worten:
Kundry
Hier! Nimm du! – Balsam…
Gurnemanz
Woher brachtest du dies?
Kundry
Von weiter her, als du denken kannst.
Hilft der Balsam nicht,
Arabia birgt
dann nichts mehr zu seinem Heil. –
Fragt nicht weiter!
(Sie wirft sich auf den Boden.)
Ich bin müde.
In der nun folgenden Szene erscheint der sieche Gralshüter Amfortas, der auf einer Sänfte zum morgendlichen Bad hinab zum See geleitet wird. Kundrys Balsam wird ihm überreicht. Als er der wilden Reiterin, die er als „rastlos scheue Magd“ bezeichnet, für den Balsam danken will, den sie aus dem fernen Arabien auf wundersame Weise herbeigeschafft hat, fordert Gurnemanz Kundry auf, sich zu erheben. Doch dieses Wesen verbleibt am Boden und weigert sich, aufzustehen.
Dieses merkwürdige Verhalten nehmen die Knappen zum Anlass, um ihre Abneigung, ja Abscheu gegen dieses „wilde Tier“ zum Ausdruck zu bringen:
Dritter Knappe
He! Du da!
Was liegst du dort wie ein wildes Tier?
Kundry
Sind die Tiere hier nicht heilig?
Dritter Knappe
Ja; doch ob heilig du,
das wissen wir grad noch nicht.
Vierter Knappe
Mit ihrem Zaubersaft, wähn‘ ich,
wird sie den Meister vollends verderben.
Der Frage des Dritten Knappen „Was liegst du dort wie ein wildes Tier?“ und Kundrys sich anschließender Gegenfrage: „Sind Tiere hier nicht heilig?“ ist ein Motiv unterlegt, das als ein drittes Kundry-Motiv gelten kann. Es enthält eine langsam beginnende Aufwärtsbewegung, gefolgt von einem schnelleren Hinaufgleiten in die Höhe.
Notenbeispiel Nr. 4
Kundry-Motiv III
Auch dieses Motiv wird uns noch ausführlich beschäftigen. Wieder einmal macht die Musik Andeutungen und weist auf Dinge hin, die wir Zuschauer im Moment noch nicht wissen können.
Anders als die Knappen hat Gurnemanz offensichtlich eine durchgängig positive Erfahrung mit der „Gralsbotin“, wie Kundry auch genannt wird, gemacht. Er rühmt an ihr, dass sie äußerst hilfsbereit sei. Sie bringt heilsamen Balsam aus fernen Ländern, der in diesem Fall dem Leiden des Amfortas sogar kurzzeitig Linderung verschaffen wird. Sie sei als Gralsbotin verlässlich und erfolgreich. Und wenn sie länger fernblieb, so Gurnemanz, „brach ein Unglück wohl herein“. Und für all ihre guten Taten habe sie nie einen Dank erwartet. Gurnemanz muss zugeben, dass man Kundry manchmal wie ein schlangenhaftes Wesen schlafend im Waldgestrüpp findet, „erstarrt, leblos, wie tot“. Dass Kundry zugleich jenes „teuflisch schöne Weib“ ist, mit dem wir im 2. Akt Bekanntschaft machen werden, das wissen Gurnemanz und die Knappen offensichtlich nicht.
Gurnemanz‘ Eintreten für Kundrys gute Seiten hat die Knappen nicht wirklich überzeugt. Denn sie lassen nicht davon ab, auch weiterhin ihren Widerwillen gegen die Gralsbotin zum Ausdruck zu bringen.
Dritter Knappe
Doch haßt sie uns.–
Sieh nur, wie hämisch dort nach uns sie blickt!
Vierter Knappe
Eine Heidin ist’s, ein Zauberweib.
Gurnemanz muss zugestehen:
Gurnemanz
Ja, eine Verwünschte mag sie sein.
Hier lebt sie heut‘ –
vielleicht erneut,
zu büßen Schuld aus früh’rem Leben,
die dorten ihr noch nicht vergeben.
Übt sie nun Buß‘ in solchen Taten,
die uns Ritterschaft zum Heil geraten,
gut tut sie dann und recht sicherlich,
dienet uns – und hilft auch sich.
Hier taucht erstmals in diesem Bühnenwerk ein Hinweis auf „Karma“ auf, das ein Mensch durch eine schlechte Tat auf sich geladen hat. Dabei kann es sich um eine Schuld aus einem früheren Leben handeln, die ungesühnt geblieben ist und insofern eine Belastung für das aktuelle Leben darstellt. Diese Mutmaßung des Gurnemanz greifen die beiden Knappen nur zu gerne auf.
Dritter Knappe
So ist’s wohl auch jen‘ ihre Schuld,
die uns so manche Not gebracht.
Der alte Gurnemanz richtet daraufhin die äußerst brisante Frage an Kundry:
Gurnemanz
He! Du! – Hör mich und sag‘:
wo schweiftest du damals umher,
als unser Herr den Speer verlor?
(Kundry schweigt düster)
Gurnemanz
Warum halfest du nur damals nicht?
Kundry
Ich – helfe nie.
Kundrys Antwort ist so mysteriös wie ihr ganzes Wesen. Denn Kundry hilft und hilft nicht. Sie steht zu Zeiten auf Seiten des Unheils, wie der 2. Aufzug belegen wird, aber nicht selten auch auf Seiten des Heils. Hierin drängt sich erneut das Symboltier „Schlange“ auf, das einerseits äußerst gefährlich ist, andererseits aber zum Heil führt, so wie die eherne Schlange des Moses, die – wie die Bibel berichtet – allen Menschen, die sie anschauten, Rettung brachte.
Die Bühnengestalt Kundry wirft zweifelsohne etliche Fragen auf. Dass sie zum einen wie ein wildes Tier auf dem Boden herumkriecht und sich zum Schlafen in einem Gebüsch zusammenrollt, aber zu Zeiten auch äußerst dienst- und hilfsbereit ist, lässt erahnen, dass wir es bei Kundry mit einer Protagonistin zu tun haben, die nicht so einfach einzuordnen und zu fassensein wird. Und in der Tat ist sie wohl die verwirrendste und geheimnisvollste Figur in Wagners gesamtem musikdramatischen Schaffen.
Lassen wir uns also etwas Zeit, Kundry von Szene zu Szene besser kennenzulernen, indem wir die jeweils neu hinzukommenden Charakteristika aufmerksam zur Kenntnis zu nehmen, um aus ihnen Stück für Stück ein Bild zu formen, das uns das gewünschte Resultat liefern wird. Wenn wir einmal der Tendenz widerstehen, einer der beiden Parteien – Gurnemanz versus Knappen – die richtige Wahrnehmung zu attestieren, so haben wir möglicherweise bereits einen ersten Erkenntnisschritt getan, indem wir ins Kalkül ziehen, dass es sich bei Kundry um ein Wesen handelt, welches gegensätzliche Eigenschaften in sich vereint.
2. Parsifal – Ein Mensch, der nicht weiß, wer er ist
Geschrei und Lärm vom See her zerreißen die weihevolle Stimmung. Es wird gemeldet, dass ein Fremdling auf heiligem Gralsgebiet mit Pfeil und Bogen einen Schwan erlegt hat. Wir erfahren, dass dieser treffsichere Schütze ein junger Mann ist, der von Kindesbeinen an nichts anderes kennt, als mit Pfeil und Bogen auf Vögel zu schießen. Wie ein Abbild des im Kinderlied besungenen „Jäger aus Kurpfalz“ reitet er durch den grünen Wald „und schießt sein Wild daher, gleich wie es ihm gefällt.“ Dieser junge Mann ist sich folglich keiner Schuld bewusst und versteht die allgemeine Aufregung und den Ruf nach Bestrafung nicht. Er bestätigt nur, dass er der Schütze war („Gewiß! Im Fluge treff‘ ich, was fliegt.“). Der Wildfrevler wird vor Gurnemanz gebracht, damit dieser an ihm die gebührende Strafe vollziehe. Gurnemanz ist erzürnt über diesen herzlosen Vogelmord und tadelt den Jüngling heftig wegen seines„wild kindischen Bogenschusses“. Doch zugleich gibt sich der alte Weise viel Mühe, im Frevler Mitleid mit dem sterbenden Schwan zu wecken.
Gurnemanz
Unerhörtes Werk!
Du konntest morden, hier im heil’gen Walde,
des stiller Friede dich umfing?
Des Haines Tiere nahten dir nicht zahm,
grüßten dich freundlich und fromm?
Aus den Zweigen, was sangen die Vögel dir?
Was tat dir der treue Schwan?
Sein Weibchen zu suchen flog der auf,
mit ihm zu kreisen über dem See,
den so er herrlich weihte zum Bad.
Dem stauntest du nicht? Dich lockt‘ es nur
zu wild kindischem Bogenschuß?
Er war uns hold: was ist er nun dir?
Hier – schau her! – hier trafst du ihn,
da starrt noch das Blut, matt hängen die Flügel,
das Schneegefieder dunkel befleckt –
gebrochen das Aug‘, siehst du den Blick?
(Parsifal hat Gurnemanz mit wachsender Ergriffenheit
zugehört: jetzt zerbricht er seinen Bogen und schleudert
die Pfeile von sich.)
Dieser junge Mann – sein Name lautet: Parsifal – stellt sich musikalisch mit einem Motiv vor, das sein unbekümmertes und in die Welt stürmendes Wesen unvermittelt zum Ausdruck bringt. Es sind die Blechbläser, die uns über die Frohnatur dieses Jünglings aufklären.
Notenbeispiel Nr. 5
„Motiv des jungen Parsifal“
Es wird sicher kein Zufall sein, dass dieser Fremdling nicht irgendein Tier, sondern einen Schwan erlegt hat. Das weiße Gefieder verkörpert die Reinheit dieses Tieres, und es ist ein Schwan, der in Wagners Oper Lohengrin den Gralskönig über den See zu Elsa von Brabant zieht und am Ende der Oper sich in einen Menschen verwandelt, nämlich in Elsas Bruder Gottfried, worin die außerordentlich Verwandlungsfähigkeit dieses Tieres in ein höher stehendes Wesen zum Ausdruck gebracht wird. Aber das Wichtigste ist wohl, dass dieser Schwan als ein Symboltier für die Welt des Grals gilt, die offenbar eine gewisse Anziehungskraft auf den jungen Schützen ausübt, denn sein Aufbruch in die Welt hat ihn schließlich geradewegs ins Gralsgebiet geführt.
Gurnemanz‘ Belehrungen haben es immerhin erreicht, den jungen Mann dazu zu bringen, das Unrecht und die Herzlosigkeit seiner Tat einzusehen. Parsifal zerknickt seinen Bogen und wirft ihn von sich. Er zeigt sich reumütig.
Gurnemanz
Wirst deiner Sündentat du inne?
(Parsifal führt die Hand über die Augen.)
Gurnemanz
Sag, Knab‘, erkennst du deine große Schuld?
Wie konntest du sie begeh’n?
Parsifal
Ich wußte sie nicht.
Im weiteren Verhör wird deutlich, dass dieser Jüngling noch mehr Dinge seines Lebens nicht weiß. Gurnemanz wird immer erstaunter und zunehmend unwilliger über das Maß an Unwissenheit, das dieser junge Mann offenbart.
Gurnemanz
Wo bist du her?
Parsifal
Das weiß ich nicht.
Gurnemanz
Wer ist dein Vater?
Parsifal
Das weiß ich nicht.
Gurnemanz
Wer sandte dich dieses Weges?
Parsifal
Das weiß ich nicht.
Gurnemanz
Dein Name denn?
Parsifal
Ich hatte viele, doch weiß ich ihrer keinen mehr.
Gurnemanz
Das weiß du alles nicht?
(Für sich.) So dumm wie den
erfand bisher ich Kundry nur. –
Dieser junge Bogenschütze präsentiert sich als ein tumber Tor, der im Grunde nichts über sich weiß. Er kennt weder seinen Namen, noch den Namen des Vaters, noch kann er Auskunft darüber geben, wo er herkommt. Diese fundamentale Unwissenheit ist äußerst ungewöhnlich und lässt erahnen, dass in dieser Zuspitzung vermutlich ein tieferer Sinn verborgen liegt. In den sich anschließenden Dialogpassagen rückt seine Mutter Herzeleide in den Fokus des Geschehens, die er als einzige prägende Gestalt seiner Kindheit benennen kann.
Gurnemanz
(wendet sich wieder Parsifal zu)
Nun sag! Nichts weißt du, was ich dich frage:
jetzt meld‘, was du weißt;
denn etwas mußt du doch wissen.
Parsifal
Ich hab‘ eine Mutter: Herzeleide sie heißt:
im Wald und auf wilder Aue waren wir heim.
Parsifal lebte bislang in einer Welt, in der zwei Dinge dominant waren: die Natur („im Wald und auf wilder Aue waren wir heim“) und die Mutter („ich hab‘ eine Mutter“). In diesem von der Natur und der Mutter dominierten Universum scheint er sich lange Jahre wohl und aufgehoben gefühlt haben. Doch eines Tages dringen unverhofft Ritter in sein Paradies. Die Attraktivität dieser Männer, die er in seiner Unwissenheit für Götter hält, bringt Unruhe in seine Natur- und Mutterwelt. Diese Begegnung macht ihm offensichtlich bewusst, dass es noch andere Welten gibt, in denen es sich leben lässt und in denen den Männern offensichtlich eine prächtige Rolle zufällt. Diese Männer scheinen eine Ahnung in ihm haben aufkeimen lassen, dass auch er dem männlichen Geschlecht angehört, welches vom Geschlecht der Mutter unterschieden ist. Unversehensdrängt es ihn dazu, in diese ihn magisch anziehende Männerwelt aufzubrechen. Und so geschieht es.
Über derartig selbstreflexive Gedanken wüsste Parsifal aber nicht zu sprechen, wenn nicht die uns bereits vertraute Kundry ihm auf die Sprünge helfen würde. Plötzlich ist dieses schläfrige Wesen wieder hellwach. Sie ist es, die Parsifals Erinnerungslücken füllt und ihm die entscheidenden Stichworte liefert, damit er selbstständig über seine Erfahrungen reden und über sie reflektieren kann. Man fragt sich: Woher kennt Kundry diese Einzelheiten?
Kundry (welche während der Erzählung des Gurnemanz
von Amfortas‘ Schicksal oft in wütender Unruhe heftig
sich umgewendet hatte, nun aber, immer in der Waldecke
gelagert, den Blick scharf auf Parsifal gerichtet hat,
ruft jetzt, da Parsifal schweigt, mit rauher Stimme daher):
Den Vaterlosen gebar die Mutter,
als im Kampf erschlagen Gamuret;
vor gleichem frühen Heldentod
den Sohn zu wahren, waffenfremd
in Öden erzog sie ihn zum Toren –
die Törin! (Sie lacht.)
Parsifal (der mit jäher Aufmerksamkeit zugehört, lebhaft)
Ja! Und einst am Waldessaume vorbei,
auf schönen Tieren sitzend,
kamen glänzende Männer;
ihnen wollt‘ ich gleichen:
sie lachten und jagten davon.
Nun lief ich nach, doch konnt‘ ich sie nicht erreichen.
Durch Wildnisse kam ich, bergauf, talab;
oft ward es Nacht, dann wieder Tag:
mein Bogen mußte mir frommen
gegen Wild und große Männer…
Der dann folgende Dialog macht vollends deutlich, auf welch kindlicher Bewusstseinsstufe sich das Denken dieses jungen Mannes bewegt. Wieder ist es Kundry, die ihm die Stichworte liefert.
Kundry
(hat sich erhoben und ist zu den Männern getreten, eifrig)
Ja, Schächer und Riesen traf seine Kraft:
den freislichen Knaben lernten sie fürchten.
Parsifal (verwundert)
Wer fürchtet mich? Sag!
Kundry
Die Bösen.
Parsifal
Die mich bedrohten, waren sie bös?
(Gurnemanz lacht.)
Parsifal
Wer ist gut?
Dieser seltsame Wortwechsel ist nicht nur ein weiterer Beleg dafür, dass dieser „freisliche Knabe“ sich in einer kindlichen Geisteswelt aufhält, sondern kann auch als ein Rückverweis auf die biblische Schöpfungsgeschichte verstanden werden, also als Hinweis auf jenen Unschuldszustand, in welchem Adam und Eva sich befanden, bevor sie im Paradies vom Baum der Erkenntnis zu essen begannen und demgemäß noch nicht zwischen Gut und Böse zu unterscheiden gelernt hatten. So haftet auch Parsifals Aufbruch aus seinem mütterlichen Heim so etwas wie ein Auszug aus dem Paradies an, ein Auszug aus einer Welt, in der er noch unschuldig war, hinaus in eine Welt, in derGut und Böse auseinanderfallen und gegensätzlich zueinander stehen.
Doch dann wird Parsifal durch Kundry mit einem Ereignis konfrontiert, das ihm schier den Boden unter den Füßen wegzieht. Als Gurnemanz die Mutmaßung äußert, dass seine Mutter sich in ihrer Einsamkeit nun härme und gräme, schaltet sich erneut Kundry mit einer erschütternden Nachricht ein:
Kundry
Zu End‘ ihr Gram: seine Mutter ist tot.
Parsifal (in furchtbarem Schrecken)
Tot? – Meine Mutter? – Wer sagt’s?
Kundry
Ich ritt vorbei und sah sie sterben:
dich Toren hieß sie mich grüßen.
(Parsifal springt wütend auf Kundry zu
und faßt sie bei der Kehle.)
Gurnemanz (hält ihn zurück)
Verrückter Knabe! Wieder Gewalt!
(Nachdem Gurnemanz Kundry befreit hat,
steht Parsifal lange wie erstarrt.)
Was tat dir das Weib? Es sagte wahr;
denn nie lügt Kundry, doch sah sie viel.
Parsifal gerät in heftiges Zittern und droht in Ohnmacht zu fallen („Ich verschmachte!“). Erneut zeigt sich, wie sehr Parsifal in der mütterlichen Welt verwurzelt ist und ein Verlassen bzw. der Verlust dieser Welt eine äußerst bedrohliche und überfordernde Vorstellung für ihn ist. Kundry zeigt sich – wie so oft – äußerst hilfsbereit. Sie ist zur Quelle geeilt und kehrtmit Wasser für den Ohnmächtigen zurück. Gurnemanz kommentiert:
Gurnemanz
So recht! So nach des Grales Gnade:
das Böse bannt, wer’s mit Gutem vergilt.
Wir wissen bereits, dass bei Kundry „Gutes“ und „Böses“ keinen Gegensatz bilden. Sie möchte nicht auf eine Seite dieser Polarität festgelegt werden. Entsprechend gleichgültig erscheint ihr das Lob des Gurnemanz. Es geht eine neuerliche Verwandlung mit ihr vor.
Kundry (düster)
Nie tu ich Gutes; – nur Ruhe will ich.
(Sie wendet sich traurig ab, und während Gurnemanz
sich väterlich um Parsifal bemüht, schleppt sie sich,
von beiden unbeachtet, einem Waldgebüsch zu.)
Nur Ruhe! ach, der Müden! –
Schlafen! – Oh, daß mich keiner wecke!
(Scheu auffahrend)
Nein! Nicht schlafen! – Grausen faßt mich!
(Sie verfällt in heftiges Zittern; dann läßt sie die Arme
matt sinken.)
Machtlose Wehr! Die Zeit ist da.
Schlafen – schlafen – ich muß.
(Sie sinkt hinter dem Gebüsch zusammen und bleibt
von jetzt an unbemerkt.)
Hier am Ende der Szene erleben wir erneut die schlangenhafte Kundry, wie sie sich wieder ins Gebüsch zurückzieht und in einen Schlaf fällt. Doch zuvor haben wir allerlei Neues über sie erfahren. Überraschenderweise erscheint sie in dieser Szene als ein Wesen, das mit hellseherischen und allwissenden Gabenausgestattet ist. Sie weiß Einzelheiten über Parsifals Kindheit und über Geschehnisse, die sich nach Parsifals Auszug aus der Welt seiner Mutter zugetragen haben. Offensichtlich muss sie in Parsifals Kindheit zugegen gewesen sein.
Während Kundry als nahezu allwissende Person in Erscheinung tritt, wird Parsifal als ein Mensch vorgestellt, der sich durch eine extreme Unwissenheit und Unreife auszeichnet. Das scheint darauf hinzudeuten, dass wir es bei Wagners Weiheoper Parsifal mit einem Drama zu tun haben, dessen Handlung dadurch vorangetrieben wird, dass einzelne Entwicklungsschritte und Entwicklungskrisen in Szene gesetzt werden, die dieser Jüngling zu bewältigen hat. Seine Reife- und Prüfungszeit startet offenbar in dieser Szene, wo ihn Kundry mit Tatsachen konfrontiert, mit denen er sich nur ungern auseinandersetzen und von denen er am liebsten gar nichts hören möchte. Doch ein Zurück in eine heile Kindheitswelt wird es für Parsifal nicht mehr geben.
Man mag es kaum glauben, aber in dieser Szene ist es nicht Gurnemanz, der Parsifal zu Reifungsschritten anregt, sondern Kundry ist die Katalysatorin, die den unbedarften Parsifal auf seinen Weg stößt, indem sie ihn mit Tatsachen konfrontiert, denen er bisher ausgewichen ist. Dass in Kundry die Gegensätze von Gut und Böse eine Einheit bilden, zeigt sich erneut darin, dass sie als umsichtige und liebevolle Helferin dem ohnmächtigen Parsifal Erleichterung verschafft. Sie hegt keinerlei Groll gegen ihn aufgrund seiner gewalttätigen Attacke gegen sie. Sie vergilt nicht Böses mit Bösem, sondern zeigt stattdessen Güte. Gurnemanz ist geradezu gerührt über ihr uneigennütziges Verhalten. Parsifal selbst bleibt gegenüber Kundrys Hilfeleistungen stumm.
Es wird unübersehbar deutlich, dass dieser Jüngling noch wie ein kleines Kind an Mutters Rockzipfel hängt. Es bringt ihnschier um, als er hört, dass Herzeleide aus Verzweiflung über seinen Weggang gestorben ist. Aber er ist nicht fähig, darüber Trauer zu empfinden, sondern er schützt sich vor diesem Gefühl, indem er die Verkünderin der schlechten Botschaft angreift. Damit bewahrt er sich davor, dass peinigende Schuldgefühle in seinem Inneren aufkommen. Er dreht den Spieß einfach um: Die Überbringerin der schlechten Nachricht ist die Böse, gegenüber der er gewalttätig wird. Auch darin zeigt sich uns Parsifal als ein unwissender kleiner Junge, der ziemlich blind durch die Welt stolpert. Es mangelt ihm offenkundig nicht nur an Weltkenntnis, sondern auch an Selbstkenntnis. Er weiß nichts über sich zu sagen, wo er herkommt, wie er heißt und vor allem, wer er ist. Und durch seine Art, sich gegen seine Gefühle abzuschotten, ist er auch sich selbst ein Fremder geblieben. Kurzum, es gibt auf Seiten Parsifals ein großes Wissensund Persönlichkeitsdefizit, das einer dringenden Auffüllung bedarf. Und wenn die Prophezeiung zutreffen sollte, dass dieser Mensch zukünftig einmal ein durch Mitleid wissender Mensch werden soll, so ist er momentan von diesem Entwicklungsziel noch sehr weit entfernt und sein Nachreifungsbedarf an Weltund Selbstkenntnis riesig. Es ist in diesem Moment kaum vorstellbar, dass dieser unbedarfte Jüngling dazu ausersehen ist, einmal ein König – ein spiritueller König – zu werden.