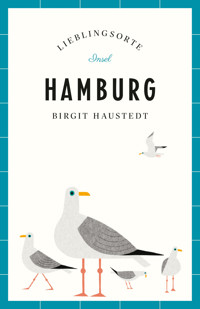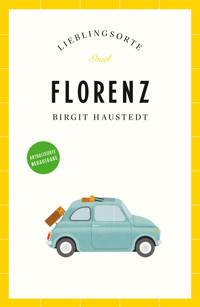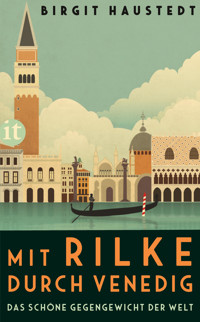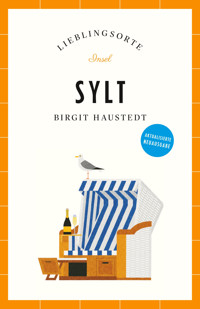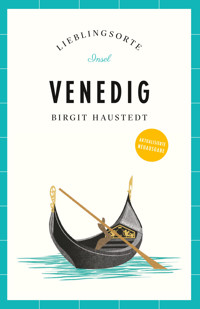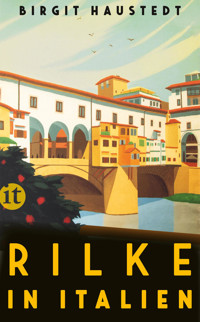
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit vielen farbigen Abbildungen
Das E-Book Rilke in Italien wird angeboten von Insel Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Reiseführer,Italien,Städtetrip,Städtereise,Sightseeing,Florenz,Rom,Capri,Venedig,Duino,Arco,Duineser Elegien,Geschenk,Lou Andreas-Salomé,Neapel,Padua,Sentiero Rilke,Triest,Urlaub,Viareggio,aktuelles Buch,Bücher Neuerscheinung,insel taschenbuch 5063,IT 5063,IT5063,Neuerscheinung 2025,neues Buch,Südeuropa
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cover
Titel
Birgit Haustedt
Rilke in Italien
Mit vielen farbigen Abbildungen
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2025
Der vorliegende Text folgt der xx. Auflage der Ausgabe des insel taschenbuchs 5063.
© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2025
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
eISBN 978-3-458-78332-9
www.insel-verlag.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
VORWORT
»Dieses Gefühl des Aufbruchs«
Kapitel
I
ARCO UND DIE KULTURLANDSCHAFT DES GARDASEES
Die erste Begegnung mit dem Süden
Als Kurschatten der »lieben Frau Mama«
»Skizzenbücher voll mit Sachen« und eine Rilke-Promenade
Eine Einsiedelei, ein Kletterfelsen und eine Turnstunde
Riva, der Gardasee und Abschied vom »lieben Arco«
Kapitel
II
FLORENZ
Ein Auftrags-Tagebuch
Untergehen im Wellenschlagen fremder Herrlichkeit
»Wahre Hymnen des Lebens«: Benozzo Gozzoli
Herrenabende im Hotel am Lungarno Serristori No. 13FlorenzLungarno Serristori No. 13
Künstler sollten einander meiden: Treffen mit Stefan George
Flucht ans Meer
Der blutige Ursprung des Schönen: Die Geburt der Venus
Kapitel
III
ROM
»Trübe Museumsstimmung«
Selbstgewählte Einsamkeit in der Ewigen Stadt
Der letzte Rom-Besuch
Das Allerschönste in Rom: Brunnen
Römische Fontäne
Kapitel
IV
NEAPEL
Die Unterwasserwelt des Mittelmeers und ein Freskenzyklus: Villa Comunale und Zoologische Station
Massige Marmorstatuen und zarte Wandmalereien: Das
Museo Archeologico NazionaleNeapelArchäologisches Nationalmuseum
Eine lyrische Alternativ-Version des Mythos: Das Relief
Orpheus Eurydike Hermes
und Rilkes Gedicht
Eine »neorealistische Insel« in Rilkes Werk? Die Neapel-Gedichte
»Die Welt da draußen in eine Handvoll Innres verwandeln«: Das Gedicht
Die Rosenschale
Kapitel
V
CAPRI
Geld und andere Dissonanzen
»Und nun Capri. Ach ja«: Rilkes Ankunft auf der Insel
Ein Rosenhäusl in einer maurischen Villa
Ein peinlicher Besuch bei Maxim GorkiGorki, Maxim
Der Süden kann sehr kalt sein: Wind, Felsen und Meer
Anacapri: »è splendida la giornata«
Lieblingsort
I
: Santa Maria a Cetrella
Noch ein Rilke-Gedicht: Sonnen-Untergang
Lieblingsort
II
: Der Monte Solaro
Alles ist Antike
Abschiede: Der Cimitero AccatolicoCapriCimitero Accatolico
Jene Kontur, die es auszufüllen galt
Kapitel
VI
VENEDIG
Sehnsucht
Mimi Romanelli – Eine Liebe im November
Das Arsenal: Venedigs eigentliches Zentrum
Palazzo ValmaranaVenedigPalazzo Valmarana (heute Cini-Loredan): Das MezzaninVenedigMezzanin der Fürstin
Das Ghetto: Die Stadt, die in den Himmel wächst
Santa Maria Formosa: Sich in Venedig verirren
Giardino Eden: Ein Garten schwebender Freiheit
San Giorgo Maggiore: Ein letzter Blick auf Venedig
Kapitel
VII
DUINO
»Es müßte da irgendwo ein Schloß geben …«
Rilke lässt sich chauffieren: Die Fahrt nach Duino
Duino: Ein Schloss voll fröhlichen Kinderlebens
»Tous les petits objets de la femme«
Umzugspläne: Das Gartenhäuschen im Tiergarten
Endlich allein!
Große Krise, Lou und die Psychoanalyse
Aufwärmen:
Das MarienlebenDas Marienleben
Eine Schreibszene
Die Elegien lesen
Italienische Spuren in der ersten Elegie
Abschiede
Duinos letzte Saison
Rilke, der Krieg und die
Duineser Elegien
Duino heute und der Sentiero Rilke
Anhang
Praktische Hinweise
Arco und die Kulturlandschaft des Gardasees
Arco
Riva del Garda
Florenz
Rom
Neapel
Capri und Anacapri
Rilkes Spaziergänge
Venedig
Duino
Literatur- und Quellenverzeichnis
Werke von Rainer Maria Rilke
Briefe
Biografien und Gesamtdarstellungen
Sonstige Quellen
Reisebücher und anderes über Italien
Rilke und Italien
Kapitel
I
Arco und die Kulturlandschaft des Gardasees
Kapitel
II
Florenz
Kapitel
III
Rom
Kapitel
IV
Neapel
Kapitel
V
Capri
Kapitel
VI
Venedig
Kapitel
VII
Duino
Danksagung
Bildnachweis
Werkregister
Ortsregister
Namenregister
Informationen zum Buch
VORWORT»Dieses Gefühl des Aufbruchs«
»Um eines Verses willen muss man viele Städte sehen, Menschen und Dinge« – diese Maxime des Protagonisten im Roman Die Aufzeichnungen des Malte Laurids BriggeDie Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge könnte auch als Motto über Leben und Werk seines Autors Rainer Maria Rilke stehen. Dichten und Reisen gehörten für ihn untrennbar zusammen.
Schon als junger Mensch wurde ihm sein Geburtsort PragPrag zu eng. Nachdem er seine Heimatstadt 1896 verlassen hatte, begann ein jahrzehntelanges Reiseleben, das ihn kreuz und quer durch Europa, vom hohen Norden bis fast in den tiefen Süden führte. »Immer war er am Wege durch die Welt, und niemand, nicht einmal er selbst, wußte im voraus, wohin er sich wenden würde […]. So ergab es sich immer nur durch Zufall, wenn man ihm begegnete. Man stand in einer italienischen Galerie, und spürte, ohne recht gewahr zu werden, von wem es kam, ein leises, freundliches Lächeln einem entgegen«, berichtete Stefan ZweigZweig, Stefan, auch er immer unterwegs.
Dabei ging es Rilke nicht um »Urlaub« und Genuss. Reisen war Arbeit. Überall suchte er Impulse, Ideen, Anregungen für sein Schreiben. Selten erlaubte er sich Ferien – und wenn, dann am liebsten an einem italienischen Strand. Geeignet war ein fremder Ort, insofern er den Dichter inspirierte und zum Arbeiten animierte. »Oh, die Reisen! Der Antrieb plötzlich aufzubrechen, beinahe ohne zu wissen wohin […]. Wie viele Male war mein Leben zusammengefaßt in dieses Gefühl des Aufbruchs, reisen, weit, weit – und jenes erste Erwachen unter einem neuen Himmel! Und sich wieder erkennen, nein dort mehr zu erfahren«, heißt es in einem Brief an eine Freundin.
Italien gehörte zwar nicht zu Rilkes Wahlheimaten wie Frankreich und später die Schweiz, doch von Kindheit an reiste er häufig dorthin. »Italien kannte und liebte ich seit meinem achten Jahr, – es war in seiner deutlichen Vielfalt und Formfülle, sozusagen, die Fibel meines beweglichen Daseins«, resümierte Rilke in seinem letzten Lebensjahr.
Früh zeichnete sich ein Faible des Dichters für luxuriöse Unterkünfte ab. VenedigVenedig besuchte er zum ersten Mal 1897 mit einem amerikanischen Freund. Dort logierten sie im Grandhotel BritanniaVenedigGrandhotel Britannia im Palazzo Tiepolo-ZucchelliVenedigPalazzo Tiepolo-Zucchelli, einem der ersten Häuser der Lagunenstadt. Bezahlt hat das alles der Kommilitone, der aus einer wohlhabenden Familie stammte. Auch später ließ Rilke sich oft und gern einladen. Auf CapriCapri verbrachte er einen Winter in der herrschaftlichen Villa DiscopoliCapriVilla Discopoli, in RomRom liebte er die Abende beim Verlegerehepaar Fischer im Blauen Salon des Hotel de RussieRomHotel de Russie, heute ein Superluxushotel; und auf Schloss DuinoDuinoSchloss Duino (Castello Duino) las Besitzerin Marie Fürstin von Thurn und Taxis-HohenloheThurn und Taxis-Hohenlohe, Marie Fürstin von ihrem Herzensgast jeden Wunsch von den Augen ab.
Mit solchen Vorlieben war es nur logisch, dass Rilke fast ausschließlich die klassischen Reiseziele der damaligen wohlhabenden und aristokratischen Elite wählte: ArcoArco am GardaseeGardasee, FlorenzFlorenz, Rom, Capri, NeapelNeapel, Venedig und schließlich Duino, vor dem Ersten Weltkrieg Treffpunkt von Hocharistokratie, Intellektuellen, Politikern und Künstlern. Diese Orte bilden die wichtigsten Schauplätze von Rilkes längeren Aufenthalten, an ihnen orientiert sich dieses Buch.
Da Rilke Italien während eines langen Zeitraums regelmäßig aufsuchte, lässt sich an der literarischen Produktion dort seine Entwicklung als Dichter verfolgen: von frühen – nicht immer gelungenen – Versuchen über die Neuen GedichteNeue Gedichte, die er auf Capri verfasste, bis zur Meisterschaft der Duineser ElegienDuineser Elegien. Berücksichtigt werden auch Rilkes persönliche Umstände. Alle Orte stehen für bestimmte Phasen und Beziehungen in seinem Leben: Arco am Gardasee besuchte Rilke als junger Student mehrfach mit der »lieben Frau Mama«, Rom an der Seite von (Noch-)Ehefrau Clara; in Venedig inspirierte ihn die lange unbekannte Geliebte Mimi RomanelliRomanelli, Mimi zu seinen schönsten Gedichten über die Serenissima. Doch als ihm diese Beziehung zu eng wurde, floh er Hals über Kopf.
Unangenehme praktische Aufgaben im Alltag delegierte Rilke gern. Doch seine Reisen organisierte er selbst und nutzte souverän die neuesten touristischen Einrichtungen. Meistens fuhr er mit der Eisenbahn, am liebsten natürlich Erster Klasse – eine so rastlose Reisetätigkeit wäre ohne dieses Fortbewegungsmittel nicht möglich gewesen. Über Zugverbindungen informierte Rilke sich in Cooks Reisebüro, wo er auch die Fahrkarten besorgte. Das war bequem und am billigsten. Anschriften von Hotels, Banken und den besten Buchhandlungen vor Ort notierte der Dichter sorgfältig in seinem roten Adressbuch – Tipps, die er freigiebig an Freunde und Bekannte weitergab.
Viel Zeit widmete Rilke vorbereitender Lektüre. Für jemanden, der von sich selbst sagte, er sei »fast ohne Kultur«, war er erstaunlich belesen. Neben neuesten kunsthistorischen Abhandlungen studierte er intensiv literarische Klassiker wie OvidOvid und DanteDante. Für eigene lyrische Interpretationen antiker Mythen informierte er sich mit den damals gebräuchlichen Handbüchern. Selbstverständlich las der Autor auch die Italienische Reise von Johann Wolfgang GoetheGoethe, Johann Wolfgang, kritisierte sie jedoch scharf. Goethe war kein Vorbild für Rilke, der ein eigenes Italienerlebnis suchte. Das war um 1900 gar nicht so leicht. Überall in Italien zeigten sich erste Auswüchse des Massentourismus, in all den geschichtsträchtigen oder besonders schönen Städten tummelten sich immer schon andere Touristen. Manche Orte – wie Capri – lehnte Rilke zunächst gar entschieden ab, weil sie durch Hotels und Ferienvillen verbaut seien. Den MarkusplatzVenedigMarkusplatz in Venedig fand er zeitweilig unerträglich wegen der vielen – meist deutschen – Fremden. Besonders erboste den Dichter, wenn die anderen Touristen die einzelnen Sehenswürdigkeiten »abhakten«, so wie es der Baedeker, seit Mitte des 19. Jahrhunderts der beliebteste Reiseführer der Bildungsbürger, mit seinen »rechthaberischen Sternchen« vorsah. Das hinderte den Autor allerdings nicht daran, dessen detaillierte Informationen manchmal sogar literarisch zu verwerten. Einige Formulierungen in Rilkes frühen Gedichten klingen wie Baedeker in Versen. Doch davon emanzipierte er sich bald als Reisender und als Literat.
Hauptsehenswürdigkeiten ließ Rilke links liegen; auf Capri weigerte er sich beispielsweise standhaft, die Blaue GrotteCapriBlaue Grotte anzuschauen, der die Insel ihre Berühmtheit verdankte. Statt der bedeutenden Skulpturensammlung betrachtete er im Archäologischen MuseumNeapelArchäologisches Nationalmuseum in Neapel lieber stundenlang kleine Grabfunde, Vasen, Gläser und Schmuck. In Kirchen bewunderte er nicht die berühmten Fresken, sondern notierte lateinische Grabinschriften unbekannter Toter. Sein Reise-Motto formulierte der Dichter einmal so: »Das Entzücken-Buchstabieren ist lange hinter mir, und darin besteht ja vielleicht meine ganze Lebensfreude und Lebensaufgabe: daß ich, wenngleich ganz anfängerhaft, unter denen bin, die das Schöne hören und seine Stimme erkennen, selbst wo es sich kaum aus den Geräuschen heraushebt.«
Das konnte die Auslage eines Fischhändlers in Neapel sein, die er wie einen kostbaren Wandteppich schilderte, oder ein einsames Kirchlein auf Capri, dem er einen eigenen Gedichtzyklus widmete. Rilke warf nicht nur einen anderen Blick auf Städte, Kunst und Landschaften. Mit seinen Gedichten, Prosatexten und Briefen können wir vielmehr bis heute Orte und Dinge in Italiens Touristenhochburgen entdecken, die noch nicht vom Massentourismus vereinnahmt wurden.
Kapitel IARCO UND DIE KULTURLANDSCHAFT DES GARDASEES
Die erste Begegnung mit dem Süden
Gerade einmal dreißig Mark hatte der junge Philosophiestudent und Literat René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke in der Tasche, als er am 17. März 1897 um 21 Uhr in München den Nachtzug Richtung Italien bestieg. Die Fahrt stand unter einem besonderen Motto: Aussöhnung mit seiner Mutter. Sophia (Phia) RilkeRilke, Sophia (Phia) war nach der Trennung von ihrem EhemannRilke, Josef 1891 allein nach Wien gezogen und hatte sich kaum um ihren Sohn gekümmert, der in Internaten und bei Verwandten des Vaters in PragPrag aufwuchs. Schließlich brach der Kontakt für mehrere Jahre vollständig ab. Über die Gründe kann man nur spekulieren, aber seit Ende 1896 kam es zu einer Wiederannäherung, und jetzt also diese Reise im Frühling. In den Süden sollte es gehen, in ein milderes Klima, denn wie so oft kränkelte die Mutter, litt an Magenschmerzen oder Migräne, Depressionen oder Erkältungen.
In RoveretoRovereto stieg Rilke am nächsten Morgen in einen Lokalzug um, der über mehrere Stationen bis zum GardaseeGardasee fuhr. Erst wenige Jahre zuvor war diese Bahnlinie für die steigende Touristenzahl aus den Großstädten eröffnet worden. Eine kurze, aber schwierige Strecke von rund vierundzwanzig Kilometern. Um von Norden an den Gardasee zu gelangen, muss ein Felsengebirge überwunden werden. Mit der kleinen Schmalspurbahn dauerte es neunzig Minuten – kaum mehr als heute auf der fast immer überlasteten Autostraße, die seit vielen Jahren den Schienenverkehr ersetzt.
Für die Kurgäste wurde 1891 die Lokalbahn Mori-Arco-Riva eröffnet
Hat man erst einmal den 287 Meter hohen Pass San GiovanniArcoPass San Giovanni erreicht, bietet sich eine wundervolle Aussicht auf eine Landschaft mit Zypressen und Olivenhainen, die Luft wird milder und das Licht strahlt wärmer. Die Bergwelt der Alpen mit ihren schneebedeckten Gipfeln tritt zurück und bildet nun eine beeindruckende Kulisse. In der Sonne glitzern die Wasser des Gardasees verheißungsvoll in der Ferne. Schon VergilVergil rühmte den »Benacus«, wie der See bei den Römern hieß, in der Divina Commedia schilderte DanteDante seine landschaftlichen Schönheiten mit beredten Worten. Viele durchreisende Künstler des Nordens verspürten hier das erste Mal die Faszination des Südens.
GoetheGoethe, Johann Wolfgang hatte 1786 auf seinem Weg nach Rom extra einen Umweg eingeschlagen und wurde belohnt. Hochbeglückt konnte er auf dem Pass ein »köstliches Schauspiel [den] Gardasee« genießen. Danach fuhr er mit der Postkutsche weiter zum kleinen Hafen TorboleTorbole. Bereits in Rovereto hatte der Dichter mit Freude bemerkt, dass die italienische Sprache das Deutsche ablöste. Doch fühlte er sich erst in dem Dorf am See »wirklich in einem neuen Land, in einer ganz fremden Umgebung« mit einer anderen Lebensart: »Die Menschen leben ein nachlässiges Schlaraffenleben.«
Wo der Süden beginnt: Blick auf den Gardasee
Vielleicht kein Zufall, dass der aufstrebende Autor Rilke seiner Mutter bei der Planung ihres Aufenthalts »eines der kleinen Künstlernester am Ufer des Gardasees« vorgeschlagen hatte – »Z. B. Tórbolé, das herrliche!«. Rilke kämpfte sehr darum, von der Mutter anerkannt zu werden, und dabei spielte seine Berufung als Literat eine große Rolle. Er prahlte nicht nur mit »glänzender Ablegung der Matura«, sondern präsentierte sich als Schriftsteller, der erste Erfolge feiern konnte. Das habe ihn reifen lassen: »Ich bin in der Zeit meines Fernseins um zwei Körperjahre, geistig wohl um 10 ältergeworden.«
Doch Rilke kam nicht bis zum Gardasee. Die Mutter, die seine Reise und seinen Aufenthalt bezahlte, hatte sich anders entschieden und das damals österreichische ArcoArco gewählt, das mehrere Kilometer nördlich vom See im Tal des Flüsschens Sarca liegt. Auch das ist ein schöner Ort. Das mittelalterliche Dorf klebt an einem pittoresken Felsen, der an einer Seite steil abfällt. Von oben grüßen die Reste einer imposanten Burg inmitten hoher Zypressen. Rundherum breiten sich jahrhundertealte Olivenhaine aus. Unten verleihen üppige Magnolien, Lorbeerbäume und hohe Palmen einem später entstandenen Quartier südliches Flair.
Atmosphärisch lagen damals allerdings Welten zwischen Arco und dem »Schlaraffenleben« am Gardasee. Denn Arco war der vornehmste Ferienort der österreichischen Monarchie. Statt Laisser-faire und entspannter Lebensart galt das Hofzeremoniell der Habsburger. Der ultrakonservative Erzherzog Albert von ÖsterreichAlbert von Österreich, Erzherzog, höchster Militär und »graue Eminenz« am Hofe von Kaiser Franz JosephFranz Joseph, Kaiser, hatte das Städtchen als Urlaubsdomizil entdeckt. Mit seinem milden Klima bot es ideale Bedingungen für ein ungewöhnliches Hobby seiner Exzellenz: das Sammeln exotischer Pflanzen. Aus allen Erdteilen ließ er Sträucher, Blumen und Bäume herbeischaffen, mit denen er nicht nur den Garten seiner palastähnlichen Ferienvilla schmückte, sondern auch öffentliche Grünflächen und Alleen anlegen ließ. Viele der Pflanzen wie zum Beispiel die Magnolien, die den besonderen Charme Arcos ausmachen, wurden erst im 19. Jahrhundert importiert.
Innerhalb weniger Jahre folgten Hofbeamte, Aristokraten und Unternehmer dem Beispiel des Erzherzogs und bauten herrschaftliche Ferienhäuser, natürlich ebenfalls mit prächtigen Gärten. So entstand in der Ebene ein vom alten Ortskern völlig unabhängiges Viertel mit großstädtischen Villen und Hotels, breiten palmenbestandenen Straßen und Parks mit üppiger südländischer Vegetation. Ökonomisch wie kulturell war die »Kurstadt« eine Art deutsch-österreichischer Ferienkolonie, in der Einheimische nur als Wirtinnen, Hoteliers und Kaffeehausbesitzer vorkamen. Im späten Winter begann die Kursaison. Dann wurde der kleine Ort an der Peripherie des Reiches mondäner Treffpunkt für die Upperclass der K.-u.-k.-Monarchie, für Höflinge, schneidige Militärs und vor allem Angehörige des hohen Adels.
Als Kurschatten der »lieben Frau Mama«
Genau das machte den Ort so attraktiv für Rilkes Mutter, die zeitlebens große gesellschaftliche Ambitionen hatte. Daran war ihre Ehe gescheitert. Statt als Offizier geadelt zu werden, musste ihr Gatte Josef den Militärdienst verlassen und hatte eine Laufbahn als Eisenbahninspektor eingeschlagen. Dem Leben als Beamtengattin zog die ehrgeizige Frau aus einer reichen Prager Unternehmerfamilie das Alleinsein vor. Viele Monate im Jahr war sie auf Reisen, meist ohne Begleitung, was ungewöhnlich für eine Frau ihrer Zeit war. Gebildet und literarisch interessiert, dabei erzkatholisch und konservativ, muss sie eine imposante Erscheinung gewesen sein. Seit ihr erstes Kind, eine kleine Tochter, kurz nach der Geburt gestorben war, trug sie nur schwarze Kleider von ausgewählter Eleganz, mit denen sie einer verwitweten Erzherzogin ähnelte. Und stets war sie auf Kontakt zur guten Gesellschaft bedacht, je adliger, desto besser.
Rilkes Mutter Sophie (Phia) Rilke
Insgesamt viermal wird Rilke seine Mutter in der Zeit von 1897 bis 1901 in Arco besuchen, meist zehn bis vierzehn Tage im März, und dabei verschiedene Unterkünfte bewohnen, die heute nicht mehr existieren: die Villa MantovaniArcoVilla Mantovani, die mondäne Villa FloridaArcoVilla Florida, die schon früh über elektrisches Licht verfügte, und die Villa BrianzaArcoVilla Brianza. Bei der zweiten Reise wird er sich die Vormittagsstunden zum Arbeiten ausbedingen; einmal plante er sogar, sich in Torbole einzumieten. Dazu kam es aber nicht. Die Aufenthalte in Arco blieben von der Mutter geprägt, ihren Vorlieben, ihren Wünschen, denen sich der Sohn anpasste. Die Tage verliefen ähnlich: Mittagessen im Hotel KaiserkroneArcoHotel Kaiserkrone oder im Hotel StrasserArcoHotel Strasser, wo die Mutter eine Art Stammtisch mit alten und neuen Kurbekanntschaften pflegte, dann Ruhen, Nachmittagsspaziergang und Kaffeetrinken, Abendessen mit Bekannten bei FiorentiniArcoFiorentini (Restaurant). 1899 verkündete Rilke seiner Mutter, das Essengehen würde ab jetzt billiger. Er habe dem Alkohol »für immer adieu gesagt. Es gibt weder Wein, noch Bier, noch Schnaps!« Alkohol sei sehr schädlich, hatte ein Professor dem schon früh sehr gesundheitsbewussten Rilke erklärt.
Das größte gesellschaftliche Ereignis war der morgendliche Besuch des Kurkonzerts. Den meisten Besuchern gehe es nur um Sehen und Gesehen-Werden, kritisierte Rilke, begleitete jedoch brav die Frau Mama. Thomas MannMann, Thomas urteilte weitaus schärfer, bemängelte den seichten Musikgeschmack der Konzertprogramme und lästerte über die »auf dem letzten Loch pfeifenden Herrschaften«.
Am hohen Alter der Gäste störte sich Phia Rilke nicht, wenn sie nur bedeutend waren. Stolz berichtete sie in Briefen von gemeinsamen Spaziergängen mit dem greisen Erzherzog Ernst von ÖsterreichErnst von Österreich, Erzherzog, woraufhin ihr Sohn bestätigt, es sei »eine gute Errungenschaft Arcos«, so hochstehende Personen zu treffen. Verbiegen musste Rilke sich dabei nicht, zeit seines Lebens suchte er selbst Kontakt zu Adligen. Regelmäßig durchforstete er in Arco die Kurlisten und beklagte sich 1901 über das fehlende Niveau der Gäste in diesem Jahr: »keine hohen Offiziere, kein Adel, keine vornehmen Fremden«, stattdessen »Gesindel« und »Pack«, »Frauen kleiner Provinzkaufleute, Beamtendurchschnitt«.
Eigene Freundschaften knüpfte Rilke – soweit man weiß – in Arco nicht. Er suchte keinen Kontakt zu Gleichaltrigen. Die einzige Ausnahme stellt Mathilde Nora GoudstikkerGoudstikker, Mathilde Nora dar, die er Anfang 1897 in MünchenMünchen kennengelernt hatte und in Arco wohl zufällig wiedersah. Sie arbeitete als eine der ersten Berufsfotografinnen Deutschlands in einem Münchener Fotostudio, das ihre Schwester SophiaGoudstikker, Sophia zusammen mit der Frauenrechtlerin Anita AugspurgAugspurg, Anita gegründet hatte. Binnen weniger Jahre war ihr »Atelier Elvira« zum Treffpunkt der Münchener Boheme geworden. Rilke hatte es zusammen mit einem amerikanischen Kommilitonen besucht und war beeindruckt von Noras Schönheit, ihren künstlerischen Interessen und ihrer Professionalität. Vorsichtig warb er in Briefen um sie und widmete ihr sogar ein Theaterstück, das allerdings nie aufgeführt wurde. Sie erwiderte seine Gefühle jedoch nicht. Nach wenigen Tagen reiste sie wieder ab.
»Skizzenbücher voll mit Sachen« und eine Rilke-Promenade
»Das liebe und unvergeßliche Sarcatal, das alte Arco, am Rand des Castellberges«
Hier spazierte schon der Dichter: Rilke-Promenade in Arco
Wenn er sich von seiner Mutter loseisen konnte, unternahm Rilke weite Spaziergänge und erkundete die Umgebung des Kurorts, darunter die armen Dörfer ChiaroneArcoChiarone, RomarzolloArcoRomarzollo und VarignanoArcoVarignano, die heute eingemeindet sind. Stets hatte er Notizhefte dabei, immer und überall schrieb er: »Skizzenbücher voll mit Sachen« über »das liebe und unvergeßliche Sarcathal, das alte Arco, am Rande des Castellberges und vor Allem diese stolze Sonnenwarte selbst, der ich Lust u. Lieder – Gott weiß wieviel – verdanke.« Während seiner vier Arco-Aufenthalte entstanden mehr als zwanzig Gedichte. Die meisten dieser Notate, in denen er einen eigenen Ton für den Ausdruck seiner Gefühle suchte, sortierte er aus. Einige veröffentlichte er früh, so erschienen bereits 1897 in der Lyriksammlung AdventAdvent die Gedichte CasabiancaCasabianca, I MuliniI Mulini und ArcoArco:
Arco
Die Hochschneezinne, schartig scharf,
loht auf wie eine Mauerkrone,
in die der lachende Nerone,
der Morgen, seine Fackel warf.
Und wie die Flammen bis ins Blau
sich zu verblühten Sternen strecken,
erwacht das Tal in schönem Schrecken
und taucht empor aus Traum und Tau.
Zwar sind dabei nicht alle Metaphern geglückt (wie z. B. die Anspielung auf Nero, der Rom anzünden ließ, als Personifikation des Sonnenaufgangs). Doch findet Rilke für Arco ungewöhnliche, aber treffende Bilder wie »Hochschneezinne«. Darin verdichten sich so unterschiedliche visuelle Eindrücke wie der Schnee, der im Frühjahr auf den umliegenden Berggipfeln liegt, und die Zinnen des mittelalterlichen Kastells über dem Ort oder andere zinnenähnliche Gebilde wie der steile Felsen des Burgbergs oder die hoch aufragenden Zypressen.
Diese Verse wählte die Gemeinde Arco 2014 als Auftakt für eine reizvolle Rilke-Promenade, die nicht nur für Fans des Dichters einen Abstecher lohnt. Sie führt an Orten entlang, die den jungen Autor literarisch inspiriert haben. Ausführliche Schautafeln präsentieren Briefe und Dichtungen Rilkes aus seinen frühen Jahren, die durch Zitate aus damaligen Reiseführern und historische Fotos ergänzt werden.
Wir starten auf der Piazza San Giuseppe, dem historischen Eingang zum alten Stadtzentrum. Zwischen Mauern und Gemüsegärten geht es durch eine kleine Gasse hoch bis zu den ersten Olivenbäumen, wo sich der Blick ins Freie öffnet. Bänke und kleine Terrassen verlocken mit spektakulärer Aussicht über die Dächer Arcos und Rilke-Lektüre zu längerem Verweilen. Auf steilem, aber bequemem Pfad erreichen wir die pittoresken Ruinen des alten Kastells, seit mehr als tausend Jahren Wahrzeichen des Ortes. Dann entfernt sich der Weg vom Felsen, wir lassen die Burg hinter uns und wandern auf einem gepflasterten Sträßchen talaufwärts zur kleinen Kirche Santa Maria di LaghelArcoSanta Maria di Laghel (Kirche). Damals ein beliebtes Ausflugsziel der Kurgäste und von Rilke mehrfach zusammen mit seiner Mutter besucht, ist das Kirchlein heute ein einsamer Ort. Teilweise auf der alten Via Crucis führt die Passeggiata RilkeArcoPasseggiata Rilke (Rilke-Promenade) durch Wiesen und Olivenhaine wieder zurück in bewohnte Gegenden. Eine der Stationen dort ist der Parco ArciducaleArcoParco Arciducale, den Erzherzog Albrecht hatte anlegen lassen. Mit mehr als zweihundert verschiedenen Pflanzen gilt er als eine der Hauptsehenswürdigkeiten Arcos, war jedoch zum Zeitpunkt unseres Spaziergangs im September 2023 auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ab da verfolgte uns das Pech, wir fanden die Abzweigung zu einer historischen Mühle nicht, die den Dichter 1897 zu seinem Gedicht I Mulini inspiriert hatte.
I Mulini
Du müde, morsche Mühle,
dein Moosrad feiert Ruh,
aus der Olivenkühle
schaut dir der Abend zu.
Der Bach singt wie verloren
Menschenlieder nach,
tiefer über die Ohren
ziehst du dein trutziges Dach.
Eine Einsiedelei, ein Kletterfelsen und eine Turnstunde
Eine der Stationen der Promenade liegt abseits der Route, ist aber durchaus einen Abstecher wert: die Eremo di San PaoloArcoEremo di San Paolo, eine winzige Einsiedelei aus dem 12. Jahrhundert und damit einer der ältesten christlichen Bauten am Gardasee.
Rilke war sie bei einem seiner einsamen Spaziergänge aufgefallen, wie er Nora Goudstikker berichtete: »Auch Eremitagen gibts hier. Die interessanteste habe ich auf dem Wege nach CenigaArcoCeniga, einem kleinen Dörfchen im Sarcatal, entdeckt. Unter einem überhängenden Fels, fast wie von der Wucht des mächtigen Schiefergesteins gedrückt, schimmert ein kapellenartiger Bau, mit steifen Fresken bemalt; unwirtliche Stufen steigen sacht zu dem wildverwachsenen Eingang.« Offensichtlich war die Einsiedlerklause kein lohnenswertes Ziel für die Kurgäste.
»Ich sah die alte, armselige Kapelle im müßigen Dämmer« – die Felsenkirche Eremo di San Paolo
Heute ist die Treppe, die zur Kapelle führt, weit besser gepflegt als damals. Denn hier liegt eine moderne Pilgerstätte, allerdings nicht religiöser, sondern sportlicher Natur. Seit den 1980er Jahren ist Arco mit seinen vielen Kalkfelsen ein Eldorado für Sportkletterer. Unter ihnen genießt die Eremitage di San Paolo einen besonderen Ruf: Hier verläuft die schwerste Kletterroute Italiens, die »Route Erebor«, die Stefano GhisolfiGhisolfi, Stefano 2021 erschlossen hat. Seither haben erst ein Mann und eine Frau diese Wand mit extremem Überhang bezwungen.
Einem solchen Hochleistungssport hätte Rilke nichts abgewinnen können. Im Gegenteil. Seit seiner Schulzeit in verschiedenen Militärinternaten – zunächst der Kadettenanstalt in St. Pölten, dann der Militär-Oberreal-Schule in Mährisch-Weißkirchen, die Robert MusilMusil, Robert wenige Jahre später besuchte – hasste der Dichter Sport. Während er in Sprachen brillierte, im Fechten und Exerzieren gute, im Zimmergewehr-Scheibenschießen sogar sehr gute Noten erhielt, erreichte der junge René im Turnen im Abschlusszeugnis von St. Pölten nur ein »Ungenügend«.
Seine Erfahrungen mit dem Schulsport und seiner Militärerziehung hat Rilke in der autobiografisch grundierten Erzählung Die TurnstundeDie Turnstunde verarbeitet. Der erste Entwurf stammt aus dem Jahr 1899, die endgültige Fassung entstand 1902. In diesem Zeitraum, in dem er seine Mutter in Arco besuchte, beschäftigte er sich intensiv mit seiner Kindheit und Jugend. Eigentlich wollte Rilke sogar einen Militärroman verfassen und hatte sich von ihr alle seine Briefe aus der Schulzeit erbeten. Daraus wurde dann nur eine – allerdings sehr eindrucksvolle – Erzählung.
Die Handlung spielt in einer Militärschule. Mit lakonischen Worten schildert der Erzähler, wie die Schüler zu Übungen eingeteilt werden – die besten ans Reck, die schlechtesten an die Kletterstange, also an ein mindestens ebenso schweres Gerät. Dorthin wird der unsportliche Karl Gruber befohlen (Karl lautete übrigens einer der vielen Vornamen Rilkes). Während der Schüler sonst stets trödelt, klettert er diesmal rasend schnell »das unermeßliche Stück Stange« hoch. Aus Trotz oder weil er den anderen imponieren will? Doch als er unten wieder ankommt, setzt sein Herz aus. Karl stirbt während der Turnstunde. Kein Wort des Mitleids vom schneidigen Oberleutnant-Turnlehrer; schlimmer noch – die Mitschüler reagieren gefühllos und roh. Ein beklemmender Einblick in die Atmosphäre einer Erziehung, bei der »das einsame Herz […] unvernünftige Brutalität« erfuhr, wie Rilke einmal schrieb. Im Militärinternat Mährisch-Weißkirchen (das Robert Musil einige Jahre später besuchte), erkrankte René Maria schließlich so oft, daß ihn die Eltern von der Schule nahmen. Für die Mutter, die den Sohn gern als hohen Offizier gesehen hätte, eine große Enttäuschung, für den Sohn ein Glück. Die Erzählung zeigt die beklemmende Seite einer Militärlaufbahn mit Werten wie Gehorsam und Drill, der sich Rilke damals entzogen hat, die aber in der Gesellschaftsschicht, die die Mutter so verehrte und die in Arco ihre Ferien verbrachte, so hochgehalten wurde.
Riva, der Gardasee und Abschied vom »lieben Arco«
Via del Ponale: Historischer Wanderweg am Gardasee
»Grüß mir nur alle Orte, die etwas von mir wissen. Das Castell vor Allem, das Dorf, die Ponalstraße«, bat Rilke seine Mutter einmal. Die 1851 eröffnete Via PonaleArcoVia Ponale verläuft am nördlichen Westufer des Gardasees und gehörte zu den Lieblingswegen des Dichters. Mit ihren in den Felsen gesprengten Tunneln galt sie als technisches Wunderwerk und erleichterte den Verkehr der einheimischen Bevölkerung mit abgelegenen Tälern. Ende des 19. Jahrhunderts entdeckten die Urlauber den Weg über dem Wasser für ihre Spaziergänge. Die wenigen Autos, die ab 1891 hier fuhren, störten offensichtlich nicht. Seit 2004 ist die Straße nur für Fußgänger und Biker geöffnet und gilt als spektakulärste Wander- bzw. Radstrecke in der Region. Auf der einen Seite ragen die Felsen senkrecht hoch, auf der anderen fallen die Klippen steil zum See ab. Hinter jeder Kurve bieten sich neue Ausblicke auf das Wasser, die Berge und die Dörfer am gegenüberliegenden Ufer. Leider ist der Weg in der Hauptsaison oft hoffnungslos überlaufen und wird überdies von Mountainbikern gern als Rennstrecke genutzt.
Obwohl Phia Rilke sich lieber im vertrauten Arco aufhielt, ließ sie sich von ihrem Sohn zu manchen Ausflügen in Richtung Süden überreden. Mit dem Boot nach MalcesineMalcesine zu fahren, behagte ihr zwar nicht, doch die gute Schokolade bei Frau Aigner verlockte sie sogar zu regelmäßigen Fußmärschen nach Riva del GardaRiva del Garda. Oft zog ihr Sohn jedoch allein los. In einem Brief Rilkes von 1899 heißt es: »Der Himmel ist unermeßlich blau und ich gehe ohne Mantel nach Riva spazieren. Hier ist alles ganz anders. Viel neuer Comfort.«
Das Hafenstädtchen lebte wie Arco vom Kurtourismus der Reichen und Schönen. Kein Wunder, dass Rilke den Ort anziehend fand. Wo gerade eine Sonnenterrasse eröffnet worden war, wusste er, oder dass ein »Pracht-Palasthôtel ›Lido‹ (des Dr. von KießlingKießling, Dr. von)« kurz nach seiner Eröffnung bereits Konkurs anmelden musste.
Eine interessante Location allerdings entging seinem Blick: das Reform-Sanatorium Dr. von Hartungen. 1888 von Christoph Hartung von HartungenHartungen, Christoph Hartung von gegründet, wurde es innerhalb weniger Jahre zu einem großen Therapiezentrum mit mehreren Villen und großzügigen Parks direkt am Uferweg nach Torbole ausgebaut und war eigentlich kaum zu übersehen. Alles war hochmodern und technisch auf dem neuesten Stand: die Zimmer mit Seeblick, eine hervorragend ausgestattete Bibliothek, Musikzimmer und luxuriöse Aufenthaltsräume. Leisten konnten sich das nur betuchte Patienten. Doch überall wehte ein anderer Geist, wie Will JasperJasper, Will in seinem informativen Buch Zauberberg Riva schildert. Während Arco konservative Kreise anzog, die Militärs und Alt- und Möchtegernadligen, suchte hier die geistige Elite der Großstädte Heilung. Künstler wie Thomas und Heinrich MannMann, Heinrich kurten wiederholt am See, Franz KafkaKafka, Franz erhoffte sich Hilfe bei seinen Schreibkrisen, und Sigmund FreudFreud, Sigmund konsultierte den Kollegen wegen mutmaßlich seelisch bedingter Herzprobleme.
Um 1900 zog Riva del Garda als Kurort mit alternativen Heilmethoden viele Künstler an
Die Klinik war spezialisiert auf Psychosomatik und Nervenleiden wie »Neurasthenie«, die Modekrankheit des Fin de Siècle, die man auf moderne Beschleunigung, Konkurrenz und zunehmende Vereinzelung zurückführte. Die zu behandelnden Symptome reichten von Atembeschwerden über Magenschmerzen bis zu tiefen Depressionen – Beschwerden, an denen Mutter und Sohn Rilke selbst immer wieder litten.
Christoph von Hartungen setzte auf Naturheilverfahren, gesundes Essen mit Obst und Gemüse, Verzicht auf Genussmittel und Bewegung an der frischen Luft. Im Angebot waren Schwimm- und Segelkurse, organisierte Gebirgswanderungen oder Luft- und Sonnenbäder für die sehr Erschöpften. Zuweilen griff der Homöopath und Arzt zu unkonventionellen Methoden: Den Brüdern Mann verordnete er gemeinsames Rudern auf dem See, Sigmund Freud verbot er kategorisch das Zigarrenrauchen und riet wenigstens zu besserem Wein, wenn der nicht auf sein tägliches Glas verzichten mochte. Die Patienten waren begeistert, einige wie Heinrich Mann blieben lebenslang mit dem charismatischen Mediziner befreundet.
Zum Programm der Klinik gehörten regelmäßige Vorträge und Gesprächsabende. Man las gemeinsam NietzscheNietzsche, Friedrich, diskutierte über die Probleme der Gegenwart, bezweifelte autoritäre Lebensmodelle und entwarf revolutionäre Ideen für die Zukunft. Im Sanatorium des Dr. von Hartungen muss bei aller Krankheitsschwere eine Stimmung von Aufbruch geherrscht haben. Der Konkurrenz-Kurort Arco hingegen war ganz der Tradition verhaftet. In den Heilanstalten vertraute man altbewährten Behandlungen; das gesellschaftliche Leben der Kurgäste bestimmten Soireen, Theater und Militärmusik, immer unter Wahrung der Etikette.
Die Frage bleibt: Warum bekam Rilke, der in München beharrlich Kontakt zur künstlerischen Avantgarde gesucht hatte und schon früh alles las, was es an aktuellen literarischen und philosophischen Veröffentlichungen gab, davon nichts mit oder wollte von diesem alternativen Ort nichts wissen?
Möglicherweise lag es daran, dass die Zeiten in Arco vom spannungsvollen Verhältnis zu seiner Mutter geprägt wa