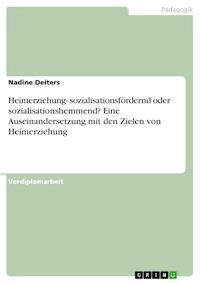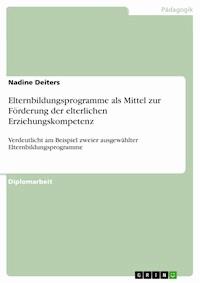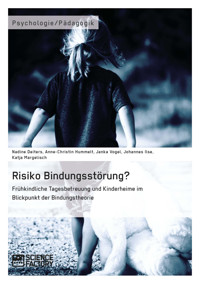
Risiko Bindungsstörung? Frühkindliche Tagesbetreuung und Kinderheime im Blickpunkt der Bindungstheorie E-Book
Nadine Deiters
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bindungen und Beziehungen sind für den Menschen als soziales Wesen elementar. Bereits die ersten zwischenmenschlichen Kontakte beeinflussen die Entwicklung von Persönlichkeit und Vertrauen. Sind daher Kleinkinder, die in einer Tagesstätte oder einem Heim betreut werden, in ihrer Bindungssicherheit gefährdet? Dieser Band stellt die Grundlagen der Bindungstheorie und Ursachen von Bindungsstörungen dar und untersucht, welchen Einfluss außerfamiliäre Betreuung auf die Bindungssicherheit von Kindern hat. Aus dem Inhalt: - Grundlagen der Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth - Frühkindliche Bindungsmuster - Bindungsstörungen bei Kindern - Prävalenz und Komorbiditäten von Bindungsstörung - Tagesbetreuung von unter Dreijährigen - Lebenswelt Heim
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Lektorat: Gina Kacher
Copyright © 2015 ScienceFactory
Ein Imprint der GRIN Verlags GmbH
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: pixabay.com
Risiko Bindungsstörung?
Frühkindliche Tagesbetreuung und Kinderheime im Blickpunkt der Bindungstheorie
Inhalt
Grundlagen der Bindungstheorie von Nadine Deiters
1. Einleitung
2. Historische Wurzeln
3. Grundlagen der Bindungstheorie
4. Bindungsstörungen im Kleinkindalter
5. Schluss
Literaturverzeichnis
Gefährdet die institutionelle Tagesbetreuung die Bindungssicherheit von Kleinkindern? Von Anne-Christin Hummelt
1. Einleitung
2. Außerfamiliale Betreuung von Kleinkindern und ihre Bedeutung für die Bindungsentwicklung
3. Resümee
Literaturverzeichnis
Aufwachsen im Kinderheim. Inwiefern der Heimaufenthalt das Bindungsverhalten von Kindern und Jugendlichen beeinflussen kann von Janka Vogel
1. Einleitung
2. Lebenswelt Heim
3. Das Heim-Milieu unter psychologisch-bindungstheoretischen Gesichtspunkten
4. Erfahrungen von Heimkindern
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Bindungsstörungen bei Kindern (F94.1, F94.2). Erscheinungsformen, Ursachen, Diagnostik, Behandlungsmöglichkeiten von Johannes Ilse
1. Einleitung
2. Definition und Symptomatik nach ICD-10 und Leitlinien KJPP
3. Prävalenz und Komorbidität
4. Ätiologie
5. Diagnostisches Vorgehen
6. Behandlungsmöglichkeiten
7. Fazit
8. Quellen
Bindung und Bindungsstörung. Diagnostische Berührungspunkte zweier distinkter Konzepte von Katja Margelisch
Zusammenfassung
Einleitung
1. Bindungstheorie: Kategorien von Bindungsmustern
2. Reaktive Bindungsstörung (DSM-IV)
3. Berührungspunkte von Bindungstheorie und Bindungsstörungen
4. Limitationen der Bindungstheorie im Verständnis der RAD
5. Diskussion
6. Fazit: Implikationen für weiterführende Forschung und Praxis
7. Literatur
Grundlagen der Bindungstheorie von Nadine Deiters
2008
1. Einleitung
Die Bindungstheorie beschreibt die frühen Beziehungen zwischen einem Kind und seinen wichtigsten Bezugspersonen, die es ständig betreuen. Diese frühen Bindungserfahrungen beeinflussen die gesamte Persönlichkeitsentwicklung. Sie werden vor allem dadurch bestimmt, ob und inwieweit die primäre Bezugsperson angemessen auf die Bedürfnisse und Signale des Kindes reagiert. Bowlby und Ainsworth, die Begründer der Bindungstheorie, haben versucht diese frühen Bindungserfahrungen messbar zu machen. Durch verschiedene Erfassungsmethoden (Fremde Situation, Adult Attachment Interview etc.) ist es gelungen, diese Erfahrungen, die im Menschen in einem Arbeitsmodell mental repräsentiert sind, anhand von unterschiedlichen Bindungsqualitäten zu beschreiben.
Die Bindungstheorie hat auch großen klinischen Wert – vor allem für die Diagnose von Verhaltensstörungen und in der praktischen Arbeit mit Kindern und ihren Familien. Seit vielen Jahren hat die Bindungstheorie in der Wissenschaft mehr und mehr an Bedeutung gewonnen und sich durch empirische Stützung als eigenständige Basistheorie etabliert.
Zum besseren Verständnis der Bindungstheorie werde ich zunächst diese theoretischen Grundlagen erläutern. Dabei stelle ich zu Beginn die geschichtliche Entwicklung und die Grundlagen der Bindungstheorie dar. Zu diesen Grundlagen gehören vor allem das Bindungs- und Explorationsverhalten, die Phasen der Bindungsentwicklung, das Arbeitsmodell von Bindung und die unterschiedlichen Bindungsqualitäten. Zudem werde ich darstellen, inwieweit die mütterliche Feinfühligkeit Einfluss auf die Bindungsentwicklung nimmt und mit welchen Methoden sich die Bindungsqualitäten erfassen lassen.
Im Anschluss an die theoretischen Grundlagen beschäftige ich mich mit Bindungsstörungen im Kleinkindalter. Zum bessern Verständnis werde ich zunächst darlegen, wie diese in den diagnostischen Manualen klassifiziert sind. Im Anschluss werde ich die in den Klassifikationen aufgeführten Diagnosen näher beleuchten und differenzieren. Man unterscheidet hier im Unterschied zu den diagnostischen Manualen sechs Typologien von Bindungsstörungen. Im Anschluss werde ich kurz auf die Ursachen von Bindungsstörungen und auf die Anwendung der Bindungstheorie in klinischen und beratenden Settings eingehen. Aufgrund der Literatur- und Forschungsbandbreite kann ich in dieser Arbeit die Themen nur sehr kurz anreißen und auch nicht das gesamte Themenspektrum der Bindungstheorie aufgreifen.
2. Historische Wurzeln
Die Bindungstheorie wurde von dem britischen Kinderpsychiater und Psychoanalytiker John Bowlby und der kanadischen Psychologin Mary Ainsworth entwickelt. Hauptgegenstand der Theorie sind der Aufbau und die Veränderung enger sozialer Beziehungen über die gesamte Lebensspanne und das Modell von Bindung der frühen Mutter-Kind-Beziehung. „Bindung („attachment“) ist die besondere Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern oder Personen, die es beständig betreuen. Sie ist im Gefühl verankert und verbindet das Individuum mit der anderen, besonderen Person über Zeit und Raum hinweg“ (Grossmann 1997, S. 51 zit. n. Ainsworth 1973). Die Theorie entstand vor allem durch die Forschungen Bowlbys, der im Auftrag der Londoner Tavistock Clinic und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Erklärungen für die Entwicklungsschäden von Kindern aus dem 2. Weltkrieg suchte, die von ihrer Mutter getrennt worden waren. Zudem bediente sich Bowlby bei seiner Theoriegründung der Beobachtungen von Heimkindern von René Spitz, der die Effekte des Entzugs mütterlicher Fürsorge untersuchte. Aus seinen Beobachtungen schloss Spitz, dass Kinder, die in Waisenhäusern getrennt von ihren Mütter leben, „[…] einem hohen Entwicklungsrisiko ausgesetzt sind, weil sie nicht die Art von Fürsorge erhalten, die sie dazu befähigt, enge sozio-emotionale Bande zu knüpfen“ (Siegler 2005, S. 584). Diese Beobachtungen brachten Bowlby bei seiner Theoriebildung entscheidend voran, da sowohl Spitz als auch Bowlby die Mutterentbehrung als entscheidenden Faktor der kindlichen Bindungsentwicklung ansahen. Weitere Anleihen machte Bowlby vor allem bei der Psychoanalyse und der Ethologie. Bowlby, ebenfalls Psychoanalytiker, nahm ähnlich wie Freud an, dass die frühkindlichen Erlebnisse eines Menschen der Schlüssel zur Erklärung seiner gesamten Persönlichkeitsentwicklung sind. Daher leistet die Feinfühligkeit der Mutter, d.h. inwieweit sie sich liebevoll und zuverlässig um ihr Kind kümmert, einen entscheidenden Beitrag zur emotionalen Entwicklung des Kindes. Im Gegensatz zu Freud, dessen Erkenntnisse vor allem auf der Analyse vorangegangener Erfahrungen basieren, bedient sich Bowlby bei seinen Erkenntnissen vor allem der Verhaltensbeobachtung, denn Ethologen nehmen an, dass es zwischen dem Verhalten eines Menschen und den inneren Prozessen Parallelen gibt. Durch die Verhaltensbeobachtung bietet sich die Möglichkeit zur objektiven Erfassung individuellen Verhaltens. Zudem macht John Bowlby Anleihen bei den Untersuchungen zum Bindungsverhalten nichthumaner Primaten von Harry F. Harlow und Robert Hinde. Diese nahmen bei Tieren, ähnlich wie Bowlby beim Menschen, eine starke emotionale Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern an. Diese Annahme basiert auf einer Reihe von Experimenten an Affen, die von Geburt an isoliert aufwuchsen. Wenn diese Affen dann mit anderen Affen zusammengebracht wurden, zeigten sie schwere emotionale Störungen. Die Ergebnisse stützen die Annahme, dass eine gesunde soziale und emotionale Entwicklung in den frühen Interaktionen mit Erwachsenen wurzelt.
Einen entscheidenden Beitrag zur Modifizierung und Weiterentwicklung der Theorie leistete vor allem Mary Ainsworth, die ein standardisiertes, systematisches Instrument zur Erfassung kindlicher Bindung im Säuglingsalter und zum mütterlichen Fürsorgeverhalten entwickelte. Durch dieses Instrument, auch „Fremde Situation“ genannt, gelang es erstmals, Bowlbys Bindungsmodell in einer standardisierten Situation beobachtbar zu machen. Mit zunehmender wissenschaftlicher Akzeptanz und Bekanntheit der Bindungstheorie wurden weitere standardisierte Instrumente zur Erfassung der Bindungsqualität entwickelt. Die Forschungen konzentrierten sich dabei zunehmend auf die Erfassung der Bindung im Jugend- und Erwachsenenalter. In diesem Zusammenhang ist vor allem das Adult Attachment Interview (AAI) zu nennen, durch das Bindungserfahrungen und deren Auswirkungen auf die aktuelle psychische Einstellung gegenüber Bindung untersucht werden können. Das AAI basiert auf der Annahme der Bindungstheorie, dass frühe Bindungserfahrungen eine Auswirkung auf die spätere Einstellung gegenüber Bindung und Beziehungen haben.
Die Bindungstheorie stammte ursprünglich aus klinischer Richtung, wurde aber mit zunehmender Bekanntheit und Akzeptanz auch von Entwicklungspsychologen genutzt.
3. Grundlagen der Bindungstheorie
3.1 Bindungs- und Explorationsverhalten
Das Bindungsverhalten und das Explorationsverhalten bilden zwei komplementäre Verhaltenssysteme, die dennoch voneinander abhängig sind. Zunächst dient die Mutter als sichere Basis für das Kind, zu der es bei Gefahr zurückkehren kann. Auf dieser Grundlage kann das Kind seine Umwelt erkunden. Tritt in einer für das Kind unsicheren Situation eine Veränderung hinsichtlich der Verfügbarkeit der Mutter ein, versucht es durch angeborene Bindungsverhaltensweisen, wie Weinen, Klammern etc., Nähe zur Mutter herzustellen. Diese Verhaltensweisen dienen dazu, ein Sicherheitsgefühl herzustellen, wenn das Kind vor Aufgaben steht, die es alleine nicht bewältigen kann oder wenn es sich unsicher fühlt. Das Bindungsverhalten wird mit zunehmendem Alter immer differenzierter und richtet sich auf einige wenige Bindungspersonen aus. Es kann nur beobachtet werden, wenn das Bindungsverhaltenssystem aktiviert ist. Im Gegensatz dazu tritt das Explorationsverhalten in Erscheinung, wenn das Bindungsverhaltenssystem deaktiviert ist. Dann beginnt das Kind seine Umwelt zu erkunden. Wiederum kann jedoch ohne die Bindungsperson als Sicherheitsbasis kein Explorationsverhalten auftreten. Entstehen beim Kind während des Explorationsverhaltens Angst oder Verunsicherung, wird das Bindungsverhaltenssystem wieder aktiviert und das Kind sucht die Nähe zu seiner Bindungsperson. Mit zunehmendem Alter reichen häufig auch symbolische Nähe bzw. die Bindungsrepräsentation als Sicherheitsbasis. Wie die Beobachtungen Ainsworths in der Fremden Situation belegen, können sich Kinder in ihrem Bindungs- und Explorationsverhalten sehr unterscheiden. Diese Unterschiede können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Als Hauptursache gelten aber vor allem die Feinfühligkeit der Mutter und ihre prompte Zuwendung auf die kindlichen Signale.
3.2 Phasen der Bindungsentwicklung
Im Säuglings- und Kleinkindalter vollzieht sich die Bindungsentwicklung in vier Phasen. Während der Vorbindungsphase (0-3 Monate) ist der Säugling in der Lage, Personen von Gegenständen zu unterscheiden – er kann aber Personen nicht eindeutig voneinander unterscheiden. Zwischen 3 und 6 Monaten vollzieht sich die Entstehung der Bindung. Nun kann das Kind durch die Erfahrungen mit seiner Bindungsperson Personen voneinander unterscheiden und sendet Signale an seine primäre Bindungsperson. Das Bindungsverhalten richtet sich in dieser Zeit zunehmend auf eine bestimmte Person aus. Während der Phase der eindeutigen Bindung (6 Monate bis 3 Jahre) gewinnt die primäre Bindungsperson an Bedeutung und das Kind sucht aktiv die Nähe zu ihr. Es zeigt ihr gegenüber Anzeichen von Bindungsverhalten, während es Fremden gegenüber zurückhaltend ist. Aufgrund der sich entwickelnden Fähigkeit zur Objektpermanenz kann das Kind eine mentale Repräsentation seiner Bindungsperson vornehmen. Ab 3 Jahren vollzieht sich die letzte Phase der Bindungsentwicklung, die zielkorrigierte Partnerschaft. Nun werden die Kinder versierter und sicherer im Falle einer Trennung von der Mutter oder der primären Bindungsperson und können besser mit unbekannten Situationen umgehen. Zudem entwickelt sich beim Kind die Fähigkeit zur Perspektivübernahme. „[…] Es lernt zu verstehen, dass seine Bindungspersonen eigene Gedanken, Gefühle, Vorstellungen, Ziele und Absichten haben, die sich von den eigenen unterscheiden können, während es zuvor „egozentrisch“ gedacht und gefühlt hat“ (Zellmer 2007, S. 10 zit. n. Ainsworth 1972). In dieser Zeit werden wiederholte Erfahrungen mit der Bindungsperson als Skripts (mentale Bindungsrepräsentationen) gespeichert. Dadurch entstehen mentale Bindungsmodelle, die aus den verinnerlichten Erfahrungen des Kindes über sich selbst und über die Bindungspersonen bestehen.
Am Ende der Bindungsentwicklung hat das Kind eine Bindung zur Bezugsperson aufgebaut. Im Falle einer Trennung kommt es daher zu Angst und Kummer. Bei einer längeren oder andauernden Trennung entsteht beim Kind eine Mischung aus Protest, Verzweiflung und Ablösung. Ein sehr früh erlebter Verlust der primären Bindungsperson oder eine mangelnde Verfügbarkeit dieser kann zu deutlichen Beeinträchtigungen in der sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes führen. Dies kann auch noch Auswirkungen auf die Beziehungen im Erwachsenenalter haben (vgl. Grossmann 1997, S. 59).
3.3 Das Arbeitsmodell von Bindung
„Bindungsqualitäten als emotionale Lebenserfahrung sind im Individuum als „Arbeitsmodelle“ (internal working models“; Bowlby, 1973) verinnerlicht“ (Grossmann 1997, S. 59). Im Arbeitsmodell werden Erfahrungen mit der Umwelt, der eigenen Person und der Bindungsperson gespeichert. Diese Erfahrungen beeinflussen später die Qualität der Beziehung zu anderen Menschen. Erst durch die wachsenden kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten und durch die wachsenden Gedächtnisleistungen ist das Kind in der Lage, die Erfahrungen mit seiner Bindungsperson zu mentalen Repräsentationen oder Arbeitsmodellen zusammenzufassen. Während der ersten Lebensjahre entwickeln sich diese Repräsentationen durch die Erfahrung von Zuwendung und Verfügbarkeit der Bindungsperson. Auf der Basis dieser Erfahrungen entwickelt das Kind eine spezifische kognitive Voreingenommenheit von sich, seiner Umwelt und seiner Bindungsperson. Wenn ein Kind die Erfahrung macht, dass es sich in belastenden Situationen auf seine Bindungsperson verlassen kann, wird es diese Situationen besser aushalten können. Die Arbeitsmodelle wirken im Laufe der Entwicklung auch in Abwesenheit der Bindungspersonen (Grossmann 1997, S. 61).
3.4 Mütterliche Feinfühligkeit und ihr Einfluss auf die Bindungsentwicklung
Ainsworth definierte mütterliche Feinfühligkeit anhand von vier Merkmalen:
(1) Die Bindungsperson muss die Befindlichkeit des Säuglings aufmerksam im Blick haben,
(2) Die Bindungsperson muss die Äußerung des Säuglings aus seiner Perspektive richtig interpretieren,
(3) Die Bindungsperson muss prompt auf die Bedürfnisse und Signale des Säuglings reagieren, damit dieser eine Verbindung zwischen seinem Verhalten und dem seiner Mutter erkennen kann, und
(4) die Reaktion der Bindungsperson muss der Entwicklung des Kindes angemessen sein.
In diesem Zusammenhang dürfen jedoch Feinfühligkeit und Überbehütung nicht verwechselt werden. Die Mutter soll dem Kind zwar uneingeschränkt zur Verfügung stehen, darf ihm aber auch nichts abnehmen, was es selbst bewältigen könnte (vgl. Grossmann 1997, S. 62f.). Feinfühligkeit bedeutet zudem, das Kind und seine individuelle Eigenart zu akzeptieren. Längsschnittliche Untersuchungen haben nachgewiesen, dass der Grad der mütterlichen Feinfühligkeit in direktem Zusammenhang zum Bindungsmuster des Kindes steht. So ergibt sich, dass Babys feinfühliger Mütter weniger weinen, bei Leid die Nähe zur Mutter suchen, sich aber auch wieder von ihr lösen, wenn sie getröstet worden sind, weniger aggressiv und ängstlich sind, mehr Vertrauen in die Verfügbarkeit der Mutter haben, eher auf Gebote und Verbote der Mutter eingehen, bessere vorsprachliche kommunikative Fähigkeiten aufweisen und die Mutter als sichere Basis zur Exploration nutzen. Dem gegenüber ergibt sich, dass Babys weniger feinfühliger Mütter in der Trennungssituation eine Mischung aus Unabhängigkeit und Ängstlichkeit zeigen, sich nur schwer beruhigen lassen und weniger auf die Gebote und Verbote der Mutter eingehen (vgl. Grossmann 1997, S. 63).
3.5 Erfassung von Bindungsqualitäten
3.5.1 „Fremde Situation“
Bei der „Fremden Situation“ handelt es sich um ein von Mary Ainsworth entwickeltes entwicklungspsychologisches Experiment, dass die von John Bowlby angenommen Bindungsqualitäten unter Laborbedingungen untersuchen und nachweisen sollte. Diese Testsituation dient als Möglichkeit der empirischen Überprüfung der Bindungstheorie. Das Verfahren eignet sich für Kinder im Alter von 11-20 Monaten. In der „Fremden Situation“ werden Mutter und Kind zunächst in einen fremden aber attraktiven Spielraum geführt und befinden sich dort für einige Zeit allein, damit das Kind die neue Umgebung erkunden kann. Im Anschluss betritt eine fremde Person den Spielraum und versucht Kontakt mit Mutter und Kind aufzunehmen. Daraufhin verlässt die Mutter den Raum und die fremde Person bleibt mit dem Kind allein. Das führt dazu, dass beim Kind das Bindungsverhaltenssystem aktiviert wird. Im Anschluss kehrt die Mutter zurück in den Raum und beschäftigt sich mit dem Kind. Dies führt dazu, dass das Explorationsverhaltenssystem aktiviert wird – die fremde Person verlässt den Raum. Daraufhin verlässt die Mutter mit deutlichem Abschiedsgruß den Raum, woraufhin die fremde Person den Raum erneut betritt. Sie versucht, wenn nötig, das Kind zu trösten. Nach einiger Zeit betritt die Mutter erneut den Raum – die fremde Person verlässt gleichzeitig den Raum. In diesen sich abwechselnden Episoden der „Fremden Situation“ erfährt das Kind in zunehmendem Maße Unvertrautheit und Fremdheit, so dass das Bindungsverhaltenssystem aktiviert wird. Anhand der Reaktion des Kindes auf die Rückkehr der Mutter kann die Bindungsqualität des Kindes erfasst werden.
3.5.1.1 Bindungsmuster
Durch die Befunde der „Fremden Situation“ gelang es Mary Ainsworth, ein Klassifikationssystem zu entwickeln, durch das sich die Mutter-Kind-Beziehung in eine sichere, unsicher-vermeidende und unsicher-ambivalente Bindung unterteilen lässt. Kinder, die keinem dieser Bindungsmuster zugeordnet werden können, werden als desorganisiert-desorientiert bezeichnet. Sicher gebundene Kinder haben qualitativ hochwertige und relativ eindeutige Beziehungen zu ihrer Bindungsperson. In der „Fremden Situation“ weinen sie, wenn sie von der Mutter getrennt werden, suchen aber nach der Rückkehr der Mutter sofort den Kontakt zu ihr und lassen sich schnell beruhigen. Sicher gebundene Kinder nutzen ihre Bindungsperson als sichere Basis, um ihre Umwelt zu erkunden. Unsicher-vermeidend gebundene Kinder zeigen sich in der Fremden Situation gleichgültig gegenüber ihrer Bindungsperson. Wenn sie geweint haben, lassen sie sich schnell von der fremden Person trösten. Unsicher-ambivalent gebundene Kinder klammern sich an ihre Bindungsperson, anstatt ihre Umwelt zu erkunden. In der Fremden Situation sind sie häufig sehr ängstlich und lassen sich nicht von der fremden Person beruhigen. Wenn die Bindungsperson zurückkehrt, zeigen sie ein ambivalentes Verhaltensmuster: Einerseits suchen sie die Nähe der Mutter, andererseits sind sie ihr gegenüber aggressiv und lassen sich nur schwer von ihr beruhigen. Kinder mit einer desorganisiert-desorientierten Bindung lassen sich keinem der drei anderen Bindungsmuster zuordnen. In der Fremden Situation zeigen sie keine konsistenten Verhaltensweisen. Ihr Verhalten ist oft konfus und widersprüchlich. So wird beispielsweise das Nähe Suchen kurz vor Körperkontakt abgebrochen.
Die Bindungsmuster aus der Fremdem Situation konnten wiederum auch durch psycho-biologische Studien nachgewiesen werden: So zeigte sich bei allen Kindern in der Fremdem Situation eine Herzfrequenzveränderung, was darauf hindeutet, dass bei allen Kindern das Bindungsverhaltenssystem aktiviert wird. Dem gegenüber konnte jedoch bei unsicher gebundenen Kindern in der Fremden Situation ein Anstieg von Cortisol, einem Steroidhormon der Nebennierenrinde, beobachtet werden, während bei sicher gebundenen Kindern ein leichtes Absinken des Cortisolhaushaltes beobachtet wurde. Daraus lässt sich schließen, dass es bei sicher gebundenen Kindern nicht zu einer physiologischen Belastung kommt, weil diese über ein angemessenes Bindungsverhaltenssystem verfügen.
3.5.2 Bindungsstatus der Eltern und AAI
Eltern besitzen Bindungsmodelle, die ihre Handlungen gegenüber ihren Kindern leiten und dadurch den Bindungsstatus ihrer Kinder beeinflussen. Die Bindungsmodelle von Erwachsenen basieren auf den Wahrnehmungen der eigenen Kindheitserfahrungen, d.h. auf der Beziehung zu den Eltern. Die Bindungsmodelle von Erwachsenen werden mit Hilfe des Adult Attachement Interviews (AAI) gemessen. Hierbei handelt es sich um ein halb standardisiertes Interview zur retrospektiven Erfassung von Bindungserfahrungen und aktuellen Einstellungen zur Bindung bei Erwachsenen (http://de.wikipedia.org/wiki/Adult_Attachment_Interview). Dadurch können Bindungserfahrungen und deren Auswirkungen auf die aktuelle psychische Einstellung gegenüber Bindung untersucht werden. Im Interview werden bindungsrelevante Kindheitserinnerungen und die Bewertung dieser Erinnerungen erfragt. Mit Hilfe dieser Beschreibungen werden die Erwachsenen Bindungsgruppen zugeordnet. Dabei unterscheidet man zwischen vier Bindungsgruppen: Autonom, abweisend, verstrickt und ungelöst-desorganisiert. Autonome Erwachsene erinnern sich sowohl an positive als auch negative Kindheitserfahrungen. Sie sind der Meinung, dass ihre frühen Bindungen ihre Entwicklung beeinflusst hätten. Abweisende Erwachsene sagen, sie könnten sich nicht an Interaktionen mit ihren Eltern erinnern oder spielen ihre Kindheitserfahrungen herunter. Verstrickte Erwachsene konzentrieren sich intensiv auf ihre Eltern, liefern dabei aber verwirrende und wutgeladene Bindungserfahrungen. Sie können keine zusammenhängenden Beschreibungen geben. Ungelöst-desorganisierte Erwachsene leiden häufig unter posttraumatischen Erfahrungen. Ihre Kindheitsbeschreibungen weisen Fehler in der Argumentation auf (vgl. Siegler 2005, S. 593). Die Auswertungen des Adult Attachment Interviews belegen einen Zusammenhang zwischen der elterlichen Bindungsrepräsentation, der Feinfühligkeit zum Kind und der Bindung des Kindes. So sind autonome Erwachsene sensible Eltern und haben sicher gebundene Kinder.
3.6 Längsschnittliche Zusammenhänge
Längsschnittuntersuchungen haben gezeigt, dass es sich bei der Bindungsqualität um ein sehr stabiles Merkmal handelt, denn das Band zwischen Eltern und Kind bleibt nach Bowlby meist bis ins Erwachsenenalter erhalten – es verändert sich jedoch hinsichtlich Zielrichtung und Intensität. Während der Jugend werden Freundschaften und Liebesbeziehungen zunehmend wichtiger und das Bindungsverhalten zu den Eltern wird weniger häufig und intensiv gezeigt. „Trotz Veränderungen im Hinblick auf Fürsorge und Selbständigkeit werden die Eltern von den Jugendlichen selbst im Vergleich zu Freunden durchaus noch als die primäre Quelle von Sicherheit gesehen (Grossmann 1997 S. 84 zit. n. Greenberg, Siegel & Leitch 1983). Somit bestimmen die Erfahrungen eines Menschen mit seinen Bindungsfiguren von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter seine Bindungsorganisation (vgl. Grossmann 1997, S. 85). Auch Untersuchungen zur Langzeitwirkung der Bindungssicherheit verdeutlichen diesen Zusammenhang. So sind sicher gebundene Kinder psychisch stabiler und sozial kompetenter. Im Detail zeigt sich, dass sie besser mit Emotionen umgehen können, engere und harmonischere Beziehungen haben, weniger aggressiv und antisozial sowie hilfsbereiter, kontaktfreudiger und beliebter sind. Somit hängt die Bindungssicherheit von Kindern sehr stark mit ihrer späteren psychischen, sozialen und kognitiven Entwicklung zusammen – wird aber wiederum auch durch die Qualität der Erziehung beeinflusst (vgl. Siegler 2005, S. 600f.).
3.7 Bewertung der Bindungstheorie
„Die Bindungstheorie Bowlbys ist erst durch die empirischen Untersuchungen von Ainsworth akzeptiert worden“ (Grossmann 1997, S. 91). Denn Bowlby war Kliniker und hatte die Bindungstheorie ursprünglich für die Diagnose und Therapie emotional gestörter Patienten konzipiert. Mit zunehmender empirischer Verankerung fand sie jedoch auch in der Entwicklungspsychologie wachsende Beachtung. Denn sie enthält klare Hypothesen über die emotionale Entwicklung des Menschen, die auch prospektiv untersucht und bestätigt werden konnten. Doch viele Aspekte der Bindungstheorie bedürfen noch weiterer Forschung und Modifizierung. Das Ziel zukünftiger Forschung besteht vor allem in der Präzisierung des Arbeitsmodells und der Analyse von Faktoren, durch die sich die Arbeitsmodelle verändern können Aus psychotherapeutischer Sicht ist es besonders interessant, zu erfahren, wie unangemessene Arbeitsmodelle zu angemessenen verändert werden können. Zudem darf sich die Bindungsforschung nicht nur allein auf die Bindungsbeziehung zwischen Eltern und Kind konzentrieren. Auch andere soziale Beziehungen, wie Freundschaften, leisten einen entscheidenden Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung und müssen daher verstärkt in den Blick bindungstheoretischer Überlegungen gelangen.