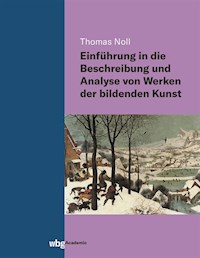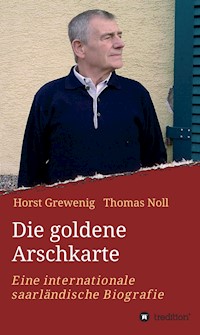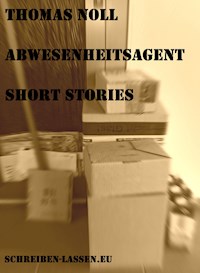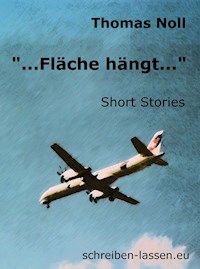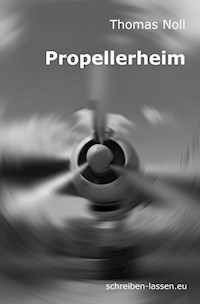0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: buch & netz
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Risiko & Recht macht es sich zur Aufgabe, Rechtsfragen der modernen Risikogesellschaft zu analysieren. Berücksichtigung finden Entwicklungen in verschiedensten Gebieten, von denen Sicherheitsrisiken für Private, die öffentliche Ordnung, staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen ausgehen. Zu neuartigen Risiken führt zuvorderst der digitale Transformationsprozess und der damit verbundene Einsatz künstlicher Intelligenz; des Weiteren hat die Covid-Pandemie Risikopotentiale im Gesundheitssektor verdeutlicht und auch der Klimawandel zwingt zu umfassenderen Risikoüberlegungen; schliesslich geben gesellschaftliche Entwicklungen, u.a. Subkulturenbildung mit Gewaltpotential, Anlass zu rechtlichen Überlegungen. Risiko und Recht greift das breite und stets im Wandel befindliche Spektrum neuartiger Risikosituationen auf und beleuchtet mit Expertenbeiträgen die rechtlichen Herausforderungen unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Risiko & Recht macht es sich zur Aufgabe, Rechtsfragen der modernen Risikogesellschaft zu analysieren. Berücksichtigung finden Entwicklungen in verschiedensten Gebieten, von denen Sicherheitsrisiken für Private, die öffentliche Ordnung, staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen ausgehen. Zu neuartigen Risiken führt zuvorderst der digitale Transformationsprozess und der damit verbundene Einsatz künstlicher Intelligenz; des Weiteren hat die Covid-Pandemie Risikopotentiale im Gesundheitssektor verdeutlicht und auch der Klimawandel zwingt zu umfassenderen Risikoüberlegungen; schliesslich geben gesellschaftliche Entwicklungen, u.a. Subkulturenbildung mit Gewaltpotential, Anlass zu rechtlichen Überlegungen. Risiko und Recht greift das breite und stets im Wandel befindliche Spektrum neuartiger Risikosituationen auf und beleuchtet mit Expertenbeiträgen die rechtlichen Herausforderungen unserer Zeit.
1
Risiko & Recht – Ausgabe 01 / 2023
Editorial
Polizei & Militär
Radikalisierung im Bereich des islamistischen Extremismus: Allgemeine Beobachtungen und ausgewählte Modelle[Thomas Noll / David Hans / Michael Weber]
Umwelt & Gesundheit
Chlorothalonil-Rückstände im Trinkwasser – eine Bestandesaufnahme und rechtliche Einordnung[Tobias Tschumi / Marc Häusler]
Technik & Infrastruktur
Digital Sovereignty in Switzerland: the laboratory of federalism[Yaniv Benhamou / Frédéric Bernard / Cédric Durand]
Tagungs- bericht
6. Fachtagung Bedrohungsmanagement: Umsetzung Istanbul-Konvention[Luca Lehmann / Vivian Stein]
Editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Die Herausgeberschaft von „Sicherheit & Recht“ hat sich Ende 2022 entschieden, das Konzept der Zeitschrift sowohl inhaltlich als auch formal zu überdenken. Inhaltlich ergab sich das Bedürfnis, auf neue Sicherheitsszenarien zu reagieren, formal sollten vor allem neue, digitale Vertriebsmöglichkeiten aufgegriffen werden. Das Resultat unserer Überlegungen ist die Nachfolgerin „Risiko & Recht“, eine thematisch breiter angelegte Fachzeitschrift, die als Open Access eJournal sowie gedruckt im Wege des Print on demand vertrieben wird.
Inhaltlich macht es sich Risiko & Recht zur Aufgabe, Rechtsfragen der modernen Risikogesellschaft zu analysieren. Berücksichtigung finden Entwicklungen in verschiedensten Gebieten, von denen Sicherheitsrisiken für Private, die öffentliche Ordnung, staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen ausgehen. Zu neuartigen Risiken führen zuvorderst der digitale Transformationsprozess und der damit verbundene Einsatz künstlicher Intelligenz; des Weiteren hat die Covid-Pandemie Risikopotenziale im Gesundheitssektor verdeutlicht und auch der Klimawandel zwingt zu umfassenderen Risikoüberlegungen; schliesslich geben gesellschaftliche Entwicklungen, u.a. Subkulturenbildung mit Gewaltpotenzial, Anlass zu rechtlichen sowie interdisziplinären Überlegungen. Risiko & Recht greift das breite und stets im Wandel befindliche Spektrum neuartiger Risikosituationen auf und beleuchtet mit Expertenbeiträgen die rechtlichen Herausforderungen unserer Zeit. Neben wissenschaftlichen Beiträgen wird Risiko & Recht auch Rechtsprechungsanalysen, Tagungsbeiträge und Literaturbesprechungen umfassen.
Formal setzt Risiko & Recht auf neue digitale Vertriebs- und Marketingmöglichkeiten, um eine breitere, internationale Leserschaft zu erreichen und aktuelle Beiträge schneller und unkompliziert verfügbar zu machen. Die digitale Vertriebsform umfasst zum einen die Lese- und Download-Option der Zeitschrift auf der Verlagswebseite (www.eizpublishing.ch) und weiteren Internet-Plattformen sowie den Versand der Zeitschrift in Gestalt von E-Mails für jede einzelne Ausgabe. Printexemplare können direkt beim Verlag oder auch im Buchhandel bestellt werden. Geplant sind drei Ausgaben pro Jahr. Da die Finanzierung von Publikationsprojekten im Open Access-Zeitalter nicht mehr durch den Verkauf von Printexemplaren erfolgt, freuen wir uns über jegliche Unterstützung unseres Projekts für die Wissenschafts-Community und interessierte Kreise. Eine hilfreiche Unterstützungsform bilden Print-Abonnements (CHF 200.00 pro Jahr) sowie Gönner-Abonnements (CHF 400.00 einschliesslich Einladung zu einem jährlichen Event mit Vortrag und Networking-Möglichkeiten).
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, Inputs sowie Anregungen und hoffen, Sie künftig zu unserer Stammleserschaft zählen zu dürfen.
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre der ersten Nummer von Risiko & Recht!
Tilmann Altwicker Goran Seferovic Franziska Sprecher Stefan Vogel Sven Zimmerlin
Polizei & Militär
Radikalisierung im Bereich des islamistischen Extremismus: Allgemeine Beobachtungen und ausgewählte Modelle
Thomas Noll; David Hans; und Michael Weber
Islamistische Attentate sind seltene, aber für Betroffene und Gesellschaft sehr einschneidende Ereignisse. Im Interesse von Forschung und Praxis steht insbesondere die „radikalisierte“ Täterschaft. Im vorliegenden Beitrag werden einige der wichtigsten Radikalisierungsmodelle vorgestellt. Begriffe wie Radikalisierung, Extremismus und Jihadismus werden erläutert und verschiedene Annahmen wie diejenige, dass bei islamistischen Anschlägen religiöse Ideologien handlungsleitend seien, kritisch diskutiert.
Inhalt
EinleitungAllgemeine BeobachtungenInzidenz islamistischer AnschlägeTerminologieRadikalisierung als Zusammenspiel von Individuum, Ideologie und UmweltSpezifische RadikalisierungsmodelleSocial Identity PerspectiveAttitudes-Behavioral Corrective ModelTwo Pyramids ModelFour Stage ModelStaircase ModelSignificance Quest ModelPräzisierungenRadikalisierungsmodelle und Rational Choice Theory: Ein Widerspruch?Einordnung bestehender RadikalisierungsmodelleZusammenfassungLiteraturEinleitung
In seinem jüngsten Lagebericht beurteilt der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) die Terrorbedrohung für die Schweiz als erhöht. Die Bedrohung wird primär vom islamistischen Extremismus geprägt, insbesondere durch Personen, die von jihadistischer Propaganda inspiriert werden.[1] Das Problem der Radikalisierung ist also real. Es darf andererseits aber auch nicht überschätzt werden, da eine solche Haltung rasch zu überschiessenden Reaktionen seitens des Staats und zu unverhältnismässigen Freiheitsbeschränkungen für bestimmte Teile der Bevölkerung führen kann.[2] Wichtig für die staatlichen Stellen, die sich mit jihadistischer Radikalisierung beschäftigen, ist eine umfassende Kenntnis des aktuellen Forschungsstandes. Terminologische Präzision bei den Begriffen Radikalisierung, Extremismus und Terrorismus ist von zentraler Bedeutung. Gewissen Experten zufolge ist Radikalisierung „what goes on before the bomb goes off“.[3] Dass dies zu kurz greift, wird im folgenden Text dargelegt. Es werden zunächst zentrale Erkenntnisse zu jihadistischen Anschlägen in Europa und zur Radikalisierung im Allgemeinen präsentiert. Dabei wird auf typischerweise benutzte Begrifflichkeiten wie Terrorismus, gewalttätigen Extremismus oder politisch motivierte Gewalt eingegangen. Es werden einige der verbreitetsten theoretischen Modelle zur Radikalisierung im Kontext des islamistischen Extremismus vorgestellt und kritisch diskutiert. In einer allgemeinen Kritik an bestehenden Radikalisierungsmodellen wird erläutert, dass die Modelle prototypische Entwicklungen zu erklären vermögen, sich aber aufgrund der geringen Spezifität ihrer Merkmale wenig für Risikoeinschätzung bzgl. gewalttätigem Extremismus eignen.
Allgemeine Beobachtungen
Inzidenz islamistischer Anschläge
In Europa haben im vergangenen Jahrzehnt bereits in verschiedenen Grossstädten – Madrid, London, Berlin, Brüssel, Paris, Nizza, Wien – islamistisch motivierte Anschläge mit zahlreichen Todesopfern stattgefunden. Während z.B. die Bombenanschläge auf Madrider Vorort-Züge am 11. März 2004 das Ergebnis einer konzertierten Aktion der Terrororganisation al Qaida waren, ist die überwiegende Mehrheit der aktuelleren Gewaltdelikte im öffentlichen Raum, die in Europa durch Personen mit islamistischem Hintergrund begangenen worden sind, mit einfachsten Mitteln wie z.B. dem Einsatz von Messern erfolgt. Derartige Attacken werden als „jihadistisch inspiriert“ bezeichnet, da häufig keine formale Anbindung der Täter an eine extremistische Organisation bestand[4] und zugleich das eigentliche Ziel des gewalttätigen Jihadismus (dem sog. „kleinen“ Jihad), das islamische Herrschaftsgebiet mit Gewalt auszudehnen und zu verteidigen, nicht immer im Fokus der handelnden Personen gestanden hat.[5] Nach der Definition von Europol sind aber auch derartige Delikte, darunter ein tödlicher Messerangriff auf eine Verwaltungsbeamtin in einer französischen Polizeistation am 23. April 2021 oder eine Messerattacke auf Reisende in einem deutschen Fernverkehrszug am 6. November 2021 mit fünf Verletzten, als jihadistische Terroranschläge zu werten.[6]
Unabhängig von der dahinterliegenden Ideologie ist in Europa die Wahrscheinlichkeit für eine Einzelperson, einem terroristischen Attentat zum Opfer zu fallen, sehr gering. So hat etwa in England im vergangenen Jahrzehnt das Risiko, bei einem terroristischen Anschlag getötet zu werden, 1:11,4 Millionen pro Jahr betragen.[7] Zum Vergleich: Die jährliche Wahrscheinlichkeit, bei einem Strassenunfall zu sterben, hat in England in der Periode 2020-2021 1:48’000 betragen,[8] war also ca. 240-mal höher. Das Risiko, in Europa einem islamistischen Anschlag zum Opfer zu fallen, ist nochmals deutlich reduziert: Lediglich 15% der zwischen 2015 und 2021 in der Europäischen Union begangenen terroristischen Anschläge hatten einen islamistischen Hintergrund – durchschnittlich 19 Attentate pro Jahr in diesem Zeitraum.[9] Im jüngsten Berichtszeitraum 2021 sind dadurch zwei Personen ums Leben gekommen (2020: 12 Todesopfer).[10] In der Schweiz hat es in der jüngeren Vergangenheit genau ein islamistisch motiviertes Gewaltdelikt gegeben, infolgedessen ein Todesopfer zu beklagen war, nämlich am 12. September 2020 in Morges.[11] Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, in der Schweiz einem islamistischen Terroranschlag zum Opfer zu fallen, sehr gering.
Dass die Gefahr terroristischer Handlungen, und hierbei insbesondere die Furcht vor islamistischem Terrorismus, in der Wahrnehmung der Bevölkerung dennoch so präsent ist,[12] hat unter anderem mit der sog. Verfügbarkeitsheuristik zu tun. Dabei handelt es sich um die Tendenz von Menschen, bei Entscheidungen Informationen zu verwenden, die schnell und einfach verfügbar sind.[13] In der Presse ist das Thema Terrorismus unverhältnismässig häufig repräsentiert, da die Medien um aufmerksamkeitsstarke Schlagzeilen konkurrieren.[14] In der Folge erscheint das Risiko, Opfer eines terroristischen Anschlags zu werden, unverhältnismässig hoch. Das Thema gewinnt an politischer Bedeutung, weil es in aller Munde ist. Die Reaktion des politischen Systems richtet sich nach der Intensität der öffentlichen Stimmung. Zusammengenommen können diese Tendenzen in der Bevölkerung eine irrationale Sensibilität auslösen, die bis hin zu Forderungen nach Abschaffung oder Einschränkungen von bestimmten Grundrechten verdächtiger Bevölkerungsgruppen führen kann. Die Verfügbarkeitsheuristik hat damit die Prioritäten neu gesetzt.[15] In der heutigen Welt sind Terroristen „die bedeutendsten Praktiker in der Kunst der Verfügbarkeitsheuristik“.[16]
Diese Überlegungen ändern aber wohlverstanden nichts daran, dass terroristische Anschläge vorkommen, immenses Leid verursachen und bestmöglich verhindert werden müssen.
Terminologie
Als Konsequenz diverser Anschlagsgeschehen sind Schlagwörter wie Radikalisierung, Extremismus und Terrorismus zu prägenden Begriffen des medialen, politischen und gesellschaftlichen Diskurses geworden. Eine allgemeingültige oder uneingeschränkt akzeptierte Definition dieser Begriffe existiert jedoch nicht.[17]
Als kleinster gemeinsamer Nenner der zahlreichen verschiedenen Definitionen[18] kann Radikalisierung als ein Prozess definiert werden, bei dem sich jemand zunehmend zu einer revolutionären, militanten oder extremistischen Person wandelt.[19] Meist ist eine bestimmte Ideologie in der Definition enthalten. Radikalisierung im Kontext des Islamismus wäre demnach die Hinwendung zu (möglicherweise gewalttätigem) Extremismus in (zumindest vordergründiger) Verbindung mit einer islamistischen bzw. jihadistischen Interpretation des Islam.[20] Jihadismus kann hierbei als Unter-Variante von islamistischem Extremismus verstanden werden, deren primäres Ziel in der kriegerischen/ gewaltsamen Ausweitung und Verteidigung des islamischen Herrschaftsgebiets besteht (der sog. „kleine“ Jihad, in Abgrenzung zum sog. „grossen“ Jihad, welcher das übergeordnete geistig-religiöse Bemühen der Gläubigen mit dem Ziel eines gottgefälligen, moralisch einwandfreien Lebens meint).[21] In der jüngeren Vergangenheit wird Jihadismus oft in Verbindung gebracht mit Jihad-Reisenden in syrische oder irakische Krisengebiete, die sich dort dem bewaffneten Kampf gegen die örtlichen Regierungen anschliessen. Die Rolle derartiger auch geopolitisch geprägter Bestrebungen ist häufig jedoch unklar bei den oben genannten niederschwellig durchgeführten Attentaten durch Einzeltäter, die sich in der Regel durch eine komplexe Motivlage auszeichnen.[22]
Das Ergebnis des Radikalisierungsprozesses besteht somit zunächst in einer mehr oder weniger feststehenden extremistischen Überzeugung. Diese ist normativ definiert als Abweichung von einer innerhalb einer bestimmten Zeit und innerhalb einer bestimmten Population als „normal“ geltenden Geisteshaltung; im Fall des Islamismus umfasst eine solche abweichende Haltung z.B. das Höhersetzen religiöser über staatliche Gesetze, die Ablehnung „westlicher“ Werte wie Liberalismus, das Etablieren von Feindbildern wie Feministinnen und Feministen, Juden und Jüdinnen, Christinnen und Christen und rivalisierende islamische Glaubensrichtungen sowie die Ablehnung der universellen Menschenrechte. Je nach Definition beinhaltet eine extremistische Überzeugung auch das Befürworten von Gewaltanwendung oder das willentliche Ausleben normabweichenden Verhaltens.[23]
Von Terrorismus hingegen wird nach gängiger wissenschaftlicher Definition erst dann gesprochen, wenn im Rahmen einer fest strukturierten und arbeitsteilig organisierten Struktur Gewaltdelikte im öffentlichen Raum durchgeführt werden, die einen Botschaftscharakter haben und in der Regel stellvertretend gegen Zivilpersonen gerichtet sind, um auf diese Weise Verunsicherung und Panik in der Bevölkerung auszulösen.[24] Dass diese enge Definition nicht auf sämtliche als islamistische Terroranschläge bezeichneten Angriffe der jüngsten Zeit zutrifft, dürfte bereits beim Lesen des vorigen Abschnitts aufgefallen sein.
Mangels klarer Definitionen erscheint es umso wichtiger, möglichst exakt zu beschreiben, mit welchen Prozessen und mit welchen Personen man sich befasst. So führt nicht zuletzt das Vermischen von Personen, die die Handlungen einer extremistischen Organisation gutheissen, mit Personen, die im Ausland kämpfen wollen, aber niemals eine terroristische Operation im Inland durchführen würden (Ausreisende in Kriegs- und Krisengebieten) sowie mit den wenigen Personen, die tatsächlich Gewalt anwenden, zu vollkommen anderen Zahlen bezüglich dieser unterschiedlichen Gruppen an „radikalisierten“ bzw. „extremistischen“ Personen.[25]
Um das Risiko einer Fehldeutung von gewalttätigem Verhalten als zwangsläufiges Ergebnis von radikaler, Gewalt rechtfertigender Ideologie zu verringern, wird statt von „Radikalisierung“ zum Teil auch von der „Hinwendung zu politischer Gewalt“ gesprochen.[26] Die Hinwendung zu politischer Gewalt ist das, was man gemeinhin unter dem Begriff „Terrorist werden“ versteht,[27] und demnach die Bereitschaft umfasst, ideologisch motivierte Gewalt auszuüben. Gleichwohl berührt eine solche Auffassung zeitgeschichtlich geprägte Interpretationen dessen, was gerechtfertigte und nicht gerechtfertigte politische Gewalt darstellt.[28]