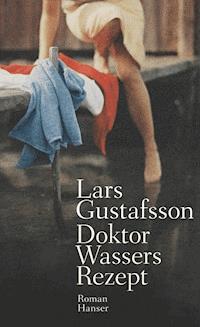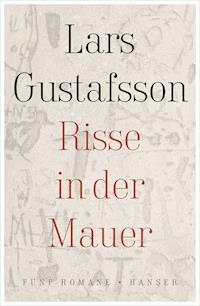
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hanser, Carl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Wir fangen noch mal an. Wir geben nicht auf" - das ist das Leitwort für die fünf Romane, in denen Lars Gustafsson ein weit angelegtes Zeitgemälde über die Wirklichkeit der ausgehenden sechziger Jahre entworfen hat: die Autobiographie 'Herr Gustafsson persönlich', das Jugenddrama 'Wollsachen', der prophetische Ökothriller 'Das Familientreffen', 'Sigismund' und der 'Tod eines Bienenzüchters', in dem ein Lehrer den Krebstod erleidet. Nun liegen die immer noch aktuellen Werke in einem Band vor - zusammen sind sie eine bewegende Geschichte des Umbruchs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1306
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hanser E-Book
Lars Gustafsson
Risse in der Mauer
Fünf Romane
Herr Gustafsson persönlich
Wollsachen
Das Familientreffen
Sigismund
Der Tod eines Bienenzüchters
Aus dem Schwedischen von
Verena Reichel
Carl Hanser Verlag
Herr Gustafsson persönlich
Titel der Originalausgabe: Herr Gustafsson själf, Albert Bonniers, Stockholm 1971
© Carl Hanser Verlag München 1972
Wollsachen
Titel der Originalausgabe: Yllet, Albert Bonniers, Stockholm 1973
© Carl Hanser Verlag München 1974
Das Familientreffen
Titel der Originalausgabe: Familjefesten, Albert Bonniers, Stockholm 1975
© Carl Hanser Verlag München Wien 1976
Sigismund
Titel der Originalausgabe: Sigismund, Norstedts Förlag, Stockholm 1976
© Carl Hanser Verlag München Wien 1977
Der Tod eines Bienenzüchters
Titel der Originalausgabe: En biodlares död, Norstedts Fo˚rlag, Stockholm 1978
© Carl Hanser Verlag München Wien 1978
ISBN-13: 978-3-446-24258-6
Alle Rechte für diese Ausgabe:
© Carl Hanser Verlag München Wien 2006/2013
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/HanserLiteraturverlage oder folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/hanserliteratur
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Inhalt
Herr Gustafsson persönlich
Wollsachen
Das Familientreffen
Sigismund
Der Tod eines Bienenzüchters
Herr Gustafsson persönlich
Zur Erinnerung an Hector Berlioz
In most books, the I,
or first person, is omitted;
in this it will be retained.
Henry David Thoreau
I
Trauerarbeit
Im Schraubstock der Mächte
Über den Flußtälern von Rhein und Main lag die bleigraue Schicht der schwefeldioxydvergifteten Luft wie ein Deckel. Frankfurts chemische Industrien mischten eine tückische kleine Dosis von tödlichem Gift in die Luft; wie ein unsichtbares Gift drang meine eigene Müdigkeit immer tiefer in die feinen Gefäße und Schichten des Organismus ein.
Ich fühlte eine Müdigkeit, die größer war als Jahre und Tage, und ich wußte, daß sie tieferen Quellen entsprang als nur der Luft, dem Ort und der Stunde.
Noch einige Tage zuvor hatte ich die schwache Hoffnung genährt, daß mein Freund E., dieses kluge reptilartige Geschöpf, der nach seiner jahrelangen Tätigkeit als Ratgeber bei Fidel zuletzt aus der kubanischen Gemeinschaft ausgestoßen worden war und nun wieder einsam in einer abgeschiedenen Villa in Friedenau seine Manuskripte ordnete, mir einige Tage der Ruhe würde schenken können, eine Atempause, eine kleine Weile jener kostbaren und seltsamen Kühle, über die nur er verfügt.
Einige wenige Reptilien sind freundliche Geschöpfe. Sie betrachten uns mit ihren ruhigen, klügeren Augen, sie hören uns geduldig an.
Sie verstehen uns nicht, ebensowenig wie wir sie verstehen, aber sie betrachten uns ohne Verachtung und ohne Liebe.
Schon jetzt am Nachmittag, zwei Stunden vor dem Abflug nach Berlin, begann ich die Sinnlosigkeit meines Entschlusses zu erkennen. Und ich sah mich selbst als ein mechanisches Wesen, ein aufgezogenes Blechmännchen mit einem Schlüssel im Rücken, das seinem festgelegten Programm folgt und es nicht mehr aufhalten kann.
Einige Tage zuvor hatte ich den Hotelportier am Telefon einige Worte auf polnisch sagen hören, und am gleichen Nachmittag, während ich wartend vor seiner geschmacklos eleganten Loge saß, hatte ich aus Spaß einige der wenigen mir bekannten polnischen Wendungen vorgebracht.
Diese Worte hatten uns zu Landsleuten gemacht. Und als ich jetzt meine Rechnung bezahlen wollte, beugte er sich vertraulich über die Theke und ließ durchblicken, als würde er mir damit eine besondere Gunst erweisen, daß er für zwanzig Mark bereit sei, mir ohne weitere Umstände ein Zimmer für die Buchmesse des nächsten Jahres zu besorgen. Mit einem plötzlichen Kältegefühl im Zwerchfell erkannte ich das ganze Ausmaß meiner Leere, meiner Verzweiflung. Nächstes Jahr!
Allein der Gedanke, daß jemand die leichtfertige Kühnheit, den blinden Optimismus besitzen könnte, an so etwas wie den Oktober des nächsten Jahres zu denken, ließ mich mit schmerzenden Lungen Atem holen.
Ich gab ihm zehn, was ihn offenbar erstaunte, ohne daß ich ausmachen konnte, ob er darüber staunte, daß die Summe groß oder daß sie klein war. Wir trennten uns mit ein paar höflichen Phrasen, und als ich endlich draußen auf der Straße stand, in dem immer schwerer lastenden Nebel, der blau war von Auspuffgasen, hatte ich einen Augenblick lang das Gefühl, als wäre meine letzte Verbindung zur Menschheit abgebrochen.
Nicht unähnlich einem Ballon, der das letzte seiner locker befestigten Schleppseile abgestreift hat, fühlte ich mich in eine immer größere Leere hineintreiben.
Montags geht der Linienflug der Pan American von Frankfurt am Main nach Westberlin um 18:10. Man reist von der Inlandhalle ab, und das ist mir immer paradox erschienen. Zwei Länder könnten sich nicht mehr voneinander unterscheiden als das narbige, das kluge Berlin mit seinem lebhaften, scharfen Intellekt, mit seinen revolutionären Gruppen, marxistischen Kinderläden, anarchistischen Kommunen, seinen blauen, roten, weißen Pamphleten, seinen Straßencafés und Buchhandlungen, Berlin, diese geheimnisvolle Schmiede zukünftiger Kräfte, eingesperrt hinter hohen Mauern und Minengürteln inmitten endloser Kartoffeläcker, dieses Berlin, das alles weiß, alles erfahren und seit langem seinen Zustand akzeptiert hat, und die dumme, geldstrotzende Bundesrepublik mit ihren Supermärkten, ihren transportablen Fernsehgeräten und ihren knarrenden Prachtmöbeln, schweren Teppichen, gläsernen Tischplatten und Sesseln aus schwarzem Leder und Stahlrohr.
Aber man reist nach Berlin, mit der Maschine der Pan American um 18:10 Uhr, von der Inlandhalle in Frankfurt ab.
Ich gab meine bleigraue Reisetasche am Schalter auf, mit dem Gefühl, daß das eine völlig sinnlose Maßnahme sei, daß mir aber auch nichts Sinnvolleres einfallen würde. Prinzipiell hätte ich (da ich eine amerikanische Kreditkarte in der Tasche hatte) ebensogut einen Flug nach Rom, Tel Aviv, Karachi oder Söndre Strömsfjord auf Grönland buchen können – es hätte keinen Unterschied gemacht. Ich hätte auch zur Autobahn gehen und nach Heidelberg trampen können (wenn meine Tasche nicht so schwer gewesen wäre, aber die hätte ich andererseits leicht in der Wartehalle des Flugplatzes stehenlassen können), um mich in irgendeinem schäbigen Motel an der Autobahn Richtung Bonn oder Karlsruhe als Kellner anstellen zu lassen und zu vergessen, wer ich bin und wer ich war.
In regelmäßigen Abständen wurde die Decke der Wartehalle von den explosionsartigen Geräuschen der Jetmaschinen erschüttert, die über mich hinwegflogen. Und mit sinnlosem Neid dachte ich an die gewaltige Kraft, die freigesetzt die großen Motoren der Boeingmaschinen antrieb, an die freigesetzten Flammen von expandierendem Gas in ihren Verbrennungskammern, an die ungeheure Geschwindigkeit der mit Karbid legierten stählernen Schaufelräder im Inneren ihrer Motoren.
Bis zum Abflug der Maschine war es noch so lang hin, daß man nur zögernd meine Tasche angenommen hatte. Ich saß zusammengesunken auf einem Stuhl in der Wartehalle, eine ungeöffnete Ausgabe der Zeit auf dem Schoß, und überlegte, ob es überhaupt noch einen Sinn für mich hätte, zu dem kleinen Tabakladen links neben dem Eingang der Wartehalle zu gehen und ein rotes, altmodisches Päckchen Rothändle zu kaufen, diese starken Zigaretten, die man nur in Deutschland bekommt und die mit ihrer bitteren Nikotinladung das Wurmblut in meinen Adern noch in einem zumindest bewegungsähnlichen Zustand halten konnten.
Dies war der Zustand am Montag, dem 13. Oktober 1969, um 16:35 nachmittags, mitteleuropäischer Zeit.
Hier beginnt nun ein Roman. Gott weiß, wie er enden wird!
Dreiunddreißig Jahre alt, also inmitten meines Lebensweges, wie es früher hieß, fand ich mich in einen dunklen und finsteren Wald versetzt, nein, ein Wald war es nicht, sondern etwas, das einem Wald glich, ein dunkler und düsterer Ort, kalt von all dem Beton, in Kästchen eingeteilt, die zu verschiedenen gewaltigen Flugzeugriesen führten, und wo die Decke von dem ungeheuren Spiel der Kräfte erschüttert wurde, weil der rechte Weg abhanden gekommen war.
Hatte es ihn jemals gegeben? Ich weiß nicht. Der rechte Weg, ein Weg für mich? Und welcher Weg ist heute der rechte?
Niemand soll mir mangelnde Gewissenhaftigkeit vorwerfen.
Die Wege, die ich ging, bin ich gründlich gegangen. Ich habe immer die Karten zu Rate gezogen, die zur Hand waren, ich habe nach bestem Vermögen versucht, die Abweichungen des Kompasses in getrennten Kraftfeldern auszugleichen.
Im Jahr 1936 geboren, von stärkeren Klassenkameraden in einer riesigen ziegelroten Volksschule mißhandelt und malträtiert, als Einzelkind in einer exzentrischen Familie von Einsamkeit geplagt, für dumm bis zur Lernunfähigkeit gehalten, als vermutlich geistesschwach zum Schularzt geschickt und der ganzen Verachtung ausgesetzt, die einem kraftlosen und vielleicht auch debilen Kind zukommt, veränderte ich mich rasch, als in der Pubertät ein heimliches und der Wissenschaft noch unbekanntes Gift sich in einem versteckten Winkel meines Körpers bildete und mein großes träges Gehirn befruchtete, das einen allzu großen Raum beanspruchte, um von einem Anstaltsinsassen oder einer verblödet grinsenden Hilfskraft in dem Kartoffellager eines einsamen Vorstadtviertels herumgeschleppt zu werden. Und jenes Gift befruchtete diesen trägen Gallertklumpen, entzündete ihn, wie man eine Lötlampe entzündet.
An die Zeit vor der Pubertät (sie begann übrigens ein paar Jahre früher als bei den Schulkameraden, und ich erschreckte sie beim Turnen fast zu Tode durch den plötzlichen starken Haarwuchs um meine Männlichkeit herum) habe ich dunkle, runde, wolkenähnliche Erinnerungen, in die hie und da, wie eine Nadel in einem Polster, etwas Scharfes eingebettet ist, ein Frosch aus grünem Blech, der hüpfen konnte, wenn man ihn aufzog, meine Angst vor Motorrädern, eine Schlange, die sich durchs Gras windet, wie ich einmal fast bis zur Taille in einem vom Regen aufgeweichten lehmigen Acker versank und von einem vorbeikommenden freundlichen Onkel gerettet wurde. Nach der Pubertät ist jede Erinnerung glasklar; eine gleichmäßig helle Beleuchtung war in den Raum gekommen. Von meiner Einsamkeit nach dieser seltsamen Veränderung ebensosehr geplagt wie davor, wurde ich nun in der Schule als großes Licht behandelt, verließ das Gymnasium mit einem Ehrenstipendium, wurde an der Universität als junges Genie begrüßt, studierte in Uppsala und Oxford die ausgefallene, aber notwendige Wissenschaft, die sich in Ermangelung einer treffenderen Bezeichnung Philosophie nennt, wurde aber von Verzagtheit ergriffen angesichts dieses ganzen Handwerks, schrieb unter dem Einfluß einer unklaren, einer unglücklichen Liebe einen Roman, wurde plötzlich begrüßt als Teil des besonderen, unterbezahlten und zweifelhaften Betriebs, den man die schwedische Literatur nennt, schrieb weitere Bücher, noch viele weitere, wurde von einigen Kritikern als Genie gefeiert, von anderen für einen Dorfidioten gehalten, zwei Auffassungen, die sich beide mit dem Bild decken, das ich selbst von meinem Leben habe, bekam Freunde und Feinde, schrieb Tausende von Zeitungsartikeln, geriet in eine immer unklarere Beziehung zu meinem Professor und zu den geheimnisvollen Machtsphären der Universität und faßte vor neun Jahren Wurzel bei der klugen Familie Bonnier, in deren Verlagshaus ich eine Freistatt gefunden habe.
Ich weiß – das erklärt gar nichts, erklärt auch nicht, warum ihr mich in diesem düsteren Wald findet.
Die dunkle Decke aus schwarzgrauem Beton vibrierte unter den Schallwellen der riesenhaften Lötlampen. Um mich herum drängelten sich Geschäftsleute mit Specknacken, uralte, krumme Damen, amerikanische Touristen, ein Herr mit einem Papagei in einem Käfig und kleine, erschreckend vitale Kinder, die ihre Puppen und Bären mit den Händen umklammert hielten.
So viele entschlossene, zielstrebige Menschen, alle in ernsthaften Angelegenheiten unterwegs! Und ich selbst kaum mehr als eine sinnlose Posse.
Und von der Einsamkeit wie von einem Glasgefäß umgeben, nicht unähnlich einem mittelalterlichen Homunculus in seinem Kolben, den gerade ein unvorsichtiger Alchimist durch sein allzu leichtferti-ges Spiel mit Säuren und Scheidewässern erzeugt hat, in einem Zustand jenseits von Angst und Hoffnung, ließ ich mich im Flugzeug auf einem Fensterplatz nieder, zusammengerollt wie ein Embryo auf dem allzu engen Sitz, umgeben von dem Geruch durchnäßter Wollsachen.
So zusammengekrümmt und in mich gekehrt lieferte ich mich unbekannten Mächten aus, wie Flugpassagiere sich immer im Augenblick des Starts unbekannten Mächten mehr oder weniger ausliefern.
Immer noch zusammengekauert und geschüttelt von einer Kälte, die eher von innen kam als aus der kleinen Ventilationsdüse an der Decke über mir, sah ich in zehntausend Meter Höhe, mit der dicken bleigrauen Wolkendecke im Dunkel unter mir, den zarten Schimmer der Abendröte die dünne Luft färben.
Und da im gleichen Augenblick, hörte ich eine tiefe Altstimme neben mir
– Ah!
sagen, mit einem so deutlichen Ausdruck ästhetischen Genusses, daß dasselbe Gefühl sich einen Moment lang auf mich übertrug. Und ich erinnerte mich ganz genau, daß ich früher einmal, als ich noch den Namen Lars Gustafsson trug und mit menschlichen Lungen atmete und nicht wie jetzt embryonal zusammengekauert in einem Glaskolben reiste, etwas Ähnliches gefühlt hatte und daß es wie ein Rausch gewesen war.
Ich blickte vorsichtig nach rechts und konnte eine rotblonde Haargardine ausmachen, die jetzt im letzten Abendlicht einen deutlichen Goldton annahm.
Die Atmosphäre um uns herum hatte sich merkbar verändert.
Was heißt »uns«?
Von der Dame neben mir strahlte geheimnisvoll eine dunkle, eine erdbraune, eine mütterliche Kraft auf mich aus, als sei der Erdgeist selbst in weiblicher Gestalt, heraufbeschworen von meiner eigenen Leere, meiner eigenen Verzweiflung, mir zu Hilfe gekommen.
Meine nackte, trockene, harte Müdigkeit begann plötzlich in eine gewöhnliche, triviale Schläfrigkeit überzugehen. Ich seufzte tief auf und rollte mich in meiner embryonalen Haltung noch fester, noch hilfloser zusammen, aber diesmal hatte ich den Kopf leicht an die Schulter der fremden, ungesehenen Dame gelehnt, die eine dunkelbraune, flauschige Strickjacke trug.
Durch mein offenes Ohr strömte eine milde, geheimnisvolle Wärme. Und unter dem Ohrläppchen konnte ich deutlich die äußerste Spitze ihres Schlüsselbeins wahrnehmen und schwach, sehr schwach, aber doch spürbar, das ferne Schlagen ihres starken Herzens.
Ich schloß die Augen und ließ mich im Halbschlaf durch das Luftmeer tragen, von dieser unbekannten Mutter umschlossen und geborgen wie ein richtiger Embryo in dem Körper seiner ihm ebenso unbekannten Mutter.
Ich muß eingeschlummert sein, ich muß fünf, zehn Minuten geschlafen haben. Als die starke Boeingmaschine auf ihren breiten Flügeln in einem turbulenten Sonnenuntergangswind zehntausend Meter über Preußen erzitterte, erwachte ich und merkte, daß mein Kopf im Schoß der fremden Dame ruhte. Offenbar mit großer Mühe balancierte sie in der einen Hand eine Tasse Tee und ein Stück Mürbekuchen, alles sehr vorsichtig, um mich nicht zu stören. Und endlich sah ich ihr Gesicht.
Es war nicht schön. Aber auch keineswegs abstoßend. Über einer wohlgeformten Nase mit breiten, sensiblen Nasenflügeln wölbte sich eine breite, eine schöne Stirn, wie man sie fast nur bei großen Mathematikern und Philosophen findet. Ihr Mund mit den ungewöhnlich vollen, sinnlichen Lippen war von jenem feinen Netzwerk von Falten umgeben, das nur extrem kultivierte Menschen haben, die mit äußerst genauer Artikulation sprechen. Und diese kleinen Fältchen sagten mir, daß sie etwa in meinem Alter sein müßte, zwischen dreißig und fünfunddreißig Jahren.
Und an der einen Schläfe, diskret unter einer Locke des rotbraunen Haares verborgen, zeichnete sich deutlich, als rote Erhebung auf der leicht sommersprossigen Stirn, eine Narbe ab, die ich aus irgendeinem Grund mit dem Schlag eines Gummiknüppels in Verbindung brachte.
Sie ist also Studentin, oder vielleicht eher noch Hochschullehrerin in Berlin. Es ist die Spur eines Polizeiknüppels, dachte ich.
In diesem Moment bemerkte ich ihre Augen, ihre wunderbaren Augen. Durch die leichten kleinen Wölbungen der Kontaktlinsen blickten mich mit wunderbarer Klarheit, mit blauer, nicht eisiger, eher zerstreuter Freundlichkeit, ruhig und durchdringend, die intelligentesten Augen an, die ich je gesehen habe.
Diese Augen nahmen sich Zeit, es war nicht die geringste Spur von Angst darin, ihr Ausdruck erinnerte mich an den Blick eines feinen alten Botanikers, der auf einem abgelegenen Felsbord in den lappländischen Bergen endlich die seltene Carexart findet, die er schon seit langem dort vermutet hat.
Die großen Nasenflügel weiteten sich ein wenig, es war ein Lachen in diesen Augen, aber auch etwas Ernstes, etwas, das mich aufforderte: ich solle die Welt verändern oder zumindest ihrer Veränderung nicht entgegenarbeiten, etwas, das mir sagte, daß diese Augen nicht nur mich wahrnahmen, sondern auch meinen Platz in der Geschichte, in der Wirklichkeit, im dialektischen Zusammenhang.
Sie sahen mich an, sanft und klug, nicht wie ein fremdes Insekt, das einem an einem Sommertag mit gebrochenen Flügeln auf das Fensterbrett flattert, sondern wie etwas, das auch im Prinzip voll und ganz zu begreifen und aus seinen historischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen zu erklären war.
In diesem Augenblick, wurde mir schmerzhaft bewußt, daß mein Nacken auf der harten kleinen Armlehne zwischen unseren Sesseln ruhte und daß, während mein eines Ohr noch die milde Wärme der großen, mütterlichen Brust dieser Fremden einatmete, ja, wirklich: einatmete, mein anderes Ohr völlig zerknautscht wurde von dem Aschenbecher, den die Boeing Inc. in weiser Voraussicht in diese Armlehne eingebaut hatte. Die infernalischen Blechkanten waren nun gerade dabei, wie ein gieriger, eifersüchtiger junger Schäferhund an meinem Ohr herumzukauen.
Ich richtete mich auf, machte im Sitzen eine leichte Verbeugung:
– Verzeihung,
und ließ mich an das runde Flugzeugfenster zurücksinken, benommen und glücklich, als sei ich nach einem großen und stürmischen Fest nach Hause gekommen.
Die Dame antwortete mit einem verbindlichen Nicken, trank dann, von meinem mageren Gewicht befreit, ihren Tee aus, reichte der Stewardeß die Tasse zurück und begann in der großen geflochtenen Basttasche zu kramen, die die ganze Zeit über zu ihren Füßen gestanden hatte. Zum Vorschein kamen der Reihe nach
Horkheimer-Adorno »Dialektik der Aufklärung«
Elias Canetti »Die Blendung«
Georg Lukács »Geschichte und Klassenbewußtsein«
Und nach einer kurzen Unterbrechung, die dem entzückten Herumblättern, Abschmecken, Beriechen, Prüfen diente und dazu noch einem kleinen Lachen über etwas, das offenbar ganz oben auf einer rechten Seite in dem Roman des alten sephardischen Meisters Canetti stand, und nach einer weiteren Pause, um irgendwelche Nasentropfen in die große, empfindliche Nase zu inhalieren, folgten rasch hintereinander zwei kleine Bücher aus Carl Hansers berühmter gelber Reihe.
Wolf Wondratschek »Früher begann der Tag mit einer Schußwunde« und, zu meiner aufrichtigen Verblüffung, mein eigenes verzweifeltes kleines Buch, mein frostklirrender, unwirklicher, düsterer Roman
»Der eigentliche Bericht über Herrn Arenander«,
den sie mit leicht gerunzelter Stirn und mit jenem nachdenklich prüfenden Gesichtsausdruck betrachtete, wie man ihn oft bei jemand antrifft, der unvorbereitet ein Stück aus einem arabischen Prosatext lesen soll. Sie nieste kurz, als hätte ein winziges Staubkorn zwischen den kleinen Seiten des Buches ihre sensible Nase irritiert, und dann verschwand »Der eigentliche Bericht über Herrn Arenander« wieder in der Basttasche. Darauf vertiefte sie sich in Wondratscheks avancierte, labyrinthische Prosa.
Und ich, der ich meinen jüngeren Kollegen niemals getroffen, nicht einmal etwas von ihm gelesen habe, Wolf Wondratschek, geboren 1943 in Rudolstadt/Thüringen, z.Zt. wohnhaft in Frankfurt am Main, das wir eben in Finsternis und Verzweiflung hinter uns gelassen hatten, Verfasser mehrerer Stereohörspiele und 1968 mit dem »Leonce und Lena-Preis« ausgezeichnet für sein Gedicht
»Als Alfred Jarry merkte, daß seine Mutter eine Jungfrau war, bestieg er sein Fahrrad«
Ich hätte diesen Wolf Wondratschek töten, auslöschen, vernichten und seine Buchstaben ins Meer streuen können.
Was hat Wolf Wondratschek mir voraus?
Und ich war wieder daheim in der kalten Nacht meiner Verzweiflung, daheim in meiner Melancholie, meiner Sinnlosigkeit, meiner Trauer.
Wir durchflogen nun auf 2000 Meter Höhe eine gewaltige Wolkendecke, und bald breitete sich unter uns, mit Hunderttausenden von Lichtern illuminiert, das furchtbar erfahrene, das kluge, das schizophrene Berlin aus.
Vor meinen müden, starren Augen glitt nun der schwere Kopf der lesenden Dame mit seiner roten Haarmähne vorbei, ihre mächtige Denkerstirn, ihre großen, geheimnisvollen Ohren, verborgen unter den schweren Haargardinen: sie lehnte sich über mein Knie hinweg, um die Stadt unter sich durch das Fenster in Besitz zu nehmen. Meine Nase streifte ihr Haar mit seinem milden Duft nach Moschus, nach Moschusochse, und beim Anblick der Stadt unter uns sagte sie zum zweiten Mal
– Ah!
Beide beugten wir uns mit derselben Bewegung zum Fenster vor. Vollkommen glücklich betrachteten wir die Stadt unter uns. Gewaltige, breite Straßen glitten vorbei, Rauch stieg aus den Schornsteinen auf, die Kirchtürme trugen kleine Kränze aus roten Warnlichtern.
Es war plötzlich Nacht geworden und sternklar. Mit zurückgenommener Schubkraft glitt die Maschine über die letzten Dächer auf Tempelhof zu, und plötzlich fiel mir ein, daß wir noch kein einziges Wort gewechselt hatten, daß sie nichts gesagt hatte außer zweimal dieses tiefe »ah«.
Fieberhaft suchte ich nach einem Satz, nach einem Anhaltspunkt. Müde, unglücklich sah ich die Lichter der Landebahn unter uns herangleiten, spürte, wie die Räder aufsetzten, sah die Markierungslichter unter uns verschwinden, jedes gleich einem vertanen Tag, fühlte alle Kräfte verebben und alle Möglichkeiten schwinden und dann wieder die aufsetzenden Räder.
Homunculus in seiner Flasche. Rings um mich her liegt Berlin. Und in seiner großen einsamen Villa in Friedenau wartet mein Freund E. auf eine Nachricht von mir.
Die Passagiere stehen auf, Wollmäntel fegen mir über die Nase, sie hebt ihre geflochtene Tasche auf und geht, ich bleibe noch sitzen und lasse ihr höflich Platz, damit sie ihren duffelcoatartigen Mantel anziehen kann. Und in dem Augenblick, als sie auf den Ausgang zugeht, dreht sie sich zu mir um und sagt mit warmer, lebhafter Stimme, als glaubte sie daran:
– Auf Wiedersehen!
Kleiner Stachel der Verzweiflung im Herzen, scharfe Spitze, die tief eindringt, schwarze Strudel der Ohnmacht! Die einzige freundliche Macht, die einzige Wurzelfaser, die mich noch in der Wirklichkeit festhält, gibt mich auf und verschwindet.
Und immer weiter hinab auf dem dunklen Wasser...
In meinem Leben sind bei zwei oder drei Gelegenheiten Wunder geschehen. Ich habe mich immer geweigert, an sie zu glauben, weil damit Konsequenzen für alle übrigen persönlichen Glaubensvorstellungen verbunden sind, Spekulationen über Gottheiten, Mächte, niedere und höhere Gewalten und Strukturen, die meine Vernunft nicht beherrscht. Der Wunderglaube führt rasch zu einem unkontrollierbaren Irrationalismus, einem System von Ordnungen jenseits des Menschen, die für mich erschreckend sind und verboten.
Gleichwohl habe ich sie zwei oder drei Mal geschehen sehen: und das seltsame ist, daß sie sich so deutlich von jedem anderen Ereignis unterscheiden, wenn sie sich begeben, daß man sie keinen Augenblick lang verkennen kann.
Eins dieser Wunder geschieht jetzt.
(Und mit dem seltsamen Gefühl, daß es als eine Art wohlwollende Machtdemonstration eintraf, daß das Ganze als freundlicher, aber ernstgemeinter Fingerzeig für mich bestimmt war, der ich vor meiner eigenen Rettung davonzulaufen versuchte, sah ich es kommen.)
Ein Großteil der Passagiere war jetzt aufgestanden, ich sah das mütterliche Wesen, das mich vor kurzem beschützt hatte, nach dem freundlich gemeinten »Auf Wiedersehen« sich auf den Ausgang zubewegen. Da scheppert es im Lautsprecher, und ich höre die sonore, metallische Stimme der Stewardeß: – Meine Damen und Herren! Eine Maschine, die direkt vor uns steht, muß starten. Aufgrund der Sicherheitsvorschriften muß ich Sie deshalb leider bitten, sich freundlicherweise noch einen Augenblick auf Ihre Plätze zu setzen.
Wir setzen uns, wir setzen uns wie zwei Begnadigte. Und atemlos sage ich:
– Sie sind in Frankfurt gewesen?
– Ja. Ich war auf der Buchmesse.
– Ich auch. Aber ich bin davongefahren.
– Kennen Sie den Dozenten Janos Elbert in Budapest?
(Ich habe sie einmal, viel später, gefragt, wie sie auf die wahnwitzige Idee kommen konnte, diese Frage zu stellen, und da hat sie mir versichert, das sei absolut die einzige gewesen, die ihr überhaupt ein-fiel.)
Im letzten Frühjahr hatte ich zwei Wochen in Budapest verbracht, auf die Einladung des ungarischen Schriftstellervereins hin hatte ich nächtelang in verräucherten Cafés bei Czardasmusik und leisen Gesprächen mit ungarischen Intellektuellen gesessen, ich hatte den PEN-Club und den Schriftstellerverein besucht, ich hatte atemlos dem mageren, intensiven Georg Lukács in seiner Wohnung in Budapest gelauscht, ich hatte die seltsamen blauen Nebel gesehen, die in der Dämmerung die unwirklich breiten Boulevards einhüllen. Ein paar schöne Frühlingstage lang war ich durch das grüne Hügelland gefahren, vorbei an der Donaubiegung, wo langmähnige Pferde auf den Sandbänken des Flusses weiden, über das schöne Visjagrad mit den Ruinen von König Matthias’ rotem Palast, immer weiter flußabwärts bis in die Gegenden, wo der seltsame Balaton mit seinem milchweißen Wasser alles Licht zum Himmel zurückwirft.
Ich hatte Dutzende von Intellektuellen getroffen, Verleger, Redakteure, Journalisten mit gelbgefleckten Fingern, liebenswerte alte Lyriker, die darüber klagten, daß es unmöglich sei, Limericks in ungarischer Sprache zu verfassen. Ich hatte gehört, wie die Regierung gepriesen und verflucht wurde, wie die neue ökonomische Politik als terroristisch dargestellt wurde oder als Riesenfortschritt, als stalinistisch, als liberal, als freidenkerisch.
Zusammen mit dem alternden Meister Tibor Déry hatte ich einen blühenden Feigenbaum betrachtet und hatte ihn reden hören über seine Müdigkeit und darüber, daß er keinen Hunger auf die Welt mehr habe, daß keine Reise ihn mehr locken könne, hatte ihn erzählen hören vom Glockenklang, der am Feiertagabend in Wellen an den Weinbergen des frühlingshaften Balaton entlangschwebt.
Und auf all diesen Reisen, bei all diesen Gesprächen hatte ich einen Mann zum Begleiter, der mir nicht von der Seite wich, den klugen, freundlichen Dozenten für Slawistik und Redakteur bei Nágyvilag, Doktor Janos Elbert.
Janos Elbert mit den häßlichen, vortretenden Vorderzähnen, die einen in den ersten beiden Tagen unentwegt dazu brachten, sich zu fragen, wie er es anstellen mochte, ein Käsebrot zu essen, Janos Elbert, der jahrelang im Nachtzug die hundertzwanzig Kilometer lange Strecke zwischen Zagreb und Budapest fuhr und von einem englischen Kollegen gefragt wurde:
– Did you get time to get your pyjama on, really?
Janos Elbert mit seiner schönen Frau Susie, die einer dunklen Madonna auf einem mittelalterlichen ungarischen Altar glich, der kleine Janoˇcka mit seinem sprudelnden Geplapper und seinem kleinen abgenutzten Spielzeugauto unterm Arm
und wie noch von der Terrasse des Flughafengebäudes der kleine Janoˇcka mir mit seinem roten Auto zugewinkt hatte...
– Ja, antwortete ich. Den Dozenten Janos Elbert kenne ich sehr gut. – Was halten Sie von seinen Zähnen?
Das Haus an der Fregestraße
Graubrauner Nebel wälzte sich draußen vor den hochgewölbten Rundbögen Tempelhofs, dieses nazistischen Gebäudes, das einst der Architekt Ernst Sagebiel entworfen hatte. Bald würde kein Flugzeug mehr landen können.
Noch ganz benommen wickelte ich mir den Schal zweifach um den Hals und fror in meinem leichten Herbstmantel, fror und bewachte meine Reisetaschen und Aktenmappen, meine liebe, erfahrene, mütterliche braune Aktenmappe, die mich auf so vielen Kongressen in so vielen Teilen der Welt begleitet hat, auf so vielen Reisen im Triebwagen durch die Ebene von Uppland, bei so vielen ländlichen Vortragsveranstaltungen, so vielen Universitätsseminaren, und die schweigend so viele fremde Manuskripte in sich aufgenommen hatte und dazu noch die kleine schwarze Tasche für den Rasierpinsel, den Rasierapparat, Zahncreme und Kopfwehtabletten. Ja, diese braune Aktenmappe mit dem unbegrenzten Fassungsvermögen hatte sogar einmal als Angeltasche bei einer Forellentour zum glasklaren Panther Lake in The Adirondacks gedient, und einmal, als sie auf dem Rücksitz eines israelischen Taxis stand, hatte sie nach einem Überfall der Al Fatah auf die West-Jordanbank das 9-mm-Geschoß einer Handfeuerwaffe weich aufgefangen und es, leicht verformt und gequetscht, wieder von sich gegeben. Als ich nun diese Aktenmappe und meine große graue Reisetasche bewachte, hatte ich plötzlich noch eine unter meine Obhut bekommen, eine kleinere aus solide gegerbtem Rindsleder, die sich vertrauensvoll an meine große graue lehnte, während ihre Besitzerin, die marxistische Philosophiedozentin Johanna Becker, auf dem labyrinthischen Parkplatz verschwand.
Wer war sie? Wer hatte im letzten Augenblick diese gütige, rettende Macht zu meiner Hilfe geschickt? Sollte ich mich geirrt haben? Existierten trotz allem Engel?
Und welcher furchtbaren Bedrohung war ich ausgesetzt, welche übermenschlichen Aufgaben erwarteten mich, da man zu meinem Schutz eine so außergewöhnliche Maßnahme ergriffen hatte? Und wer war »man«?
Und was meinte ich übrigens mit diesem »im letzten Augenblick«? Meinte ich es ernst?
Ich hatte das unklare Gefühl, einer Katastrophe entronnen zu sein, ohne daß ich herausfinden konnte, worin diese eigentlich hätte bestehen können.
So wartete ich am Rand des Bürgersteigs, fünf, zehn, fast fünfzehn Minuten lang. Der Nebel wurde dichter. Plötzlich fiel mir auf, daß der Verkehr an dem großen Flugplatz, der eben noch so lebhaft war, unglaublich schnell abgenommen hatte, seit das Landeverbot bekannt geworden war. Nur ab und zu tastete sich ein vereinzeltes Taxi durch den Nebel, die Scheinwerfer verdunkelt von dem Dunstkreis millionenfacher, plötzlich aufleuchtender Feuchtigkeitströpfchen.
Mir wurde die plötzliche Veränderung bewußt: beim Einflug nach Berlin war das Wetter noch klar gewesen. Jetzt war es nach neun Uhr, und der Nebel wurde dichter. In seinem großen, leeren Haus an der Fregestraße wartete sicher mein Freund E. seit einer halben Stunde. Hätte ich gleich ein Taxi genommen, wäre ich schon dort...
Schritte kamen näher und verhallten im Nebel. Manchmal schienen sie von weither zu kommen, dann war es wieder, als seien sie direkt hinter meinem Rücken. Mit angespannten Sinnen spähte ich in das Dunkel. Mit klammen Fingern stopfte ich meine Pfeife und zündete sie an.
Es kam mir in den Sinn, daß ich so unvorsichtig gewesen war, beim Aussteigen auf der Gangway laut und deutlich zu sagen, zu wem ich unterwegs war. In Berlins revolutionärer Welt ist E. kein unbedeutender Mann, ebenso verhaßt bei der CIA wie bei den kleinen fanatischen Agitationsgruppen am Rande der APO. Die geheimen Informationen, die er über Kuba besitzt, könnten eine ganze Abteilung des State Department monatelang beschäftigen.
Und ich selbst? Ich selbst, unverbesserlicher Kleinbürger, Hypochonder, Lyriker: hatte ich nicht tatsächlich in vielen revolutionären Zellen persönliche Freunde, Kontakte, Einblicke; Guerillakämpfer aus Goa, unterwegs über Stockholm, um sich der FRELIMO in Angola anzuschließen, spanische Marxisten, die Anarchistische Allianz in Malmö, die Revolutionäre Förderation in Oslo, die Black-Panther-Gruppen in London, die entschlossene und unsentimentale Gesellschaft für Sozialen Fortschritt in der Odengatan, die scheue und geheimnisvolle Väster Våla Kommunale Befreiungsgruppe mit ihren schweigsamen Männern in Regenmänteln, die manchmal aus Mooren oder schmalen Bachbetten in der Gegend hinter dem Landsberg auftauchten und mich und meinen Hund prüfend musterten, bevor sie mich mit einem grimmigen Lächeln des Wiedererkennens meinen misanthropischen Spaziergang fortsetzen ließen!
Es gehört zu meinem Schicksal, meinem Charakter, meiner historischen Situation, daß ich, jämmerlicher Spießbürger, der ich noch im letzten Jahr 24 Iggesund-Aktien besaß (die ich verkaufte, um ein Auto anzuschaffen, nachdem ich zuvor einen Industriellen in meinem Freundeskreis über die Entwicklung auf dem Großmarkt befragt und erfahren hatte, daß Iggesund noch in diesem Dezennium zum Untergang verurteilt und von der Liquidation kaum weiter entfernt ist als Ramnäs Bruk), ich, der ich in meinem ganzen Leben noch nichts Radikaleres getan habe, als der FNL Fünfzigmarkscheine zu schicken, mich kaum rühren kann, ohne mit Revolutionären in Kontakt zu kommen. Sie lieben mich. Irgend etwas an mir läßt sie mich als einen natürlichen Verbündeten, fast als Freund betrachten. Irgend etwas an mir sagt ihnen, daß ich im Grunde genommen zu genau den Menschen gehöre, die sie zu befreien haben, ja, daß ihr verzweifelter und entschlossener Kampf gegen die lähmende kolonialistische oder postindustrielle Übermacht auf geheimnisvolle Art insgesamt verfehlt wäre, wenn er nicht auch dazu beitragen könnte, mich ein ganz klein bißchen weniger melancholisch zu machen.
Und während die Feuilletonschreiber der großen Zeitungen mit Abscheu und Verachtung von meiner unklaren, halbliberalen Ichsucht sprechen, finde ich mich nicht selten bei schwarzem, kräftigem Tee, pechschwarzem Kaffee und Tequila in spärlich beleuchteten Räumen, zu denen die Liberalen von gestern, die die Taschenbuchausgaben von Antonio Gramsci aufgeschlagen auf dem Nachttisch liegen haben, nicht einmal im Traum Zutritt bekommen könnten.
Unsere gemeinsame Verweigerung der bestehenden Wirklichkeit gegenüber, unsere gemeinsame tiefe, dunkle, trotzige Überzeugung, daß der Mensch, daß der Intellekt letztlich die Geschichte zu formen vermag, verbindet uns und macht uns zu Freunden.
Jetzt kam mir in den Sinn, daß jemand, der tatsächlich wußte, wie viele derartige Freunde ich habe, und außerdem wußte, daß ich jetzt ohne einen offensichtlichen äußeren Anlaß unterwegs war, um E. in seiner Villa an der Fregestraße zu besuchen, daß dieser Jemand dann leicht die Situation mißdeuten könnte.
Hinter der hohen Ligusterhecke waren wieder Schritte im Nebel zu hören. Ich konnte ein Schaudern nicht unterdrücken und wickelte mir den wollenen Schal noch ein weiteres Mal um den Hals. Während der Stunden, in denen der Flugverkehr wegen des Herbstnebels stillgelegt wird, ist der große Platz vor Tempelhof also ein sehr einsamer Ort. Ich begann das Warten unerträglich zu finden. Was bereitete man vor?
Wer »man«? Und diese Johanna, wer war sie? Warum hatte sie mich hier zurückgelassen mit dieser eigentümlich maskulinen, bauchigen Rindsledertasche, die von breiten Lederriemen wie von Sattelgurten umspannt wurde?
Ich spähte so angestrengt in den Nebel hinter mir, daß es eine Weile dauerte, bis ich bemerkte, daß ein sehr mitgenommener Volkswagen hinter mir gehalten hatte. Sowohl seine vorderen wie seine hinteren Kotflügel wiesen kräftige Beulen auf, die offenbar ganz frisch waren, denn der Rost hatte sich noch nicht hineingefressen.
Mit einem Seufzer der Erleichterung entdeckte ich Johanna Becker, die schon dabei war, unsere Taschen in den Kofferraum zu laden.
Im Inneren des kleinen Autos herrschten Licht und Wärme. Ihre schwere rotblonde Haargardine leuchtete im Schein der kleinen Deckenlampe, die jetzt brannte, weil die Tür noch halb offenstand, und aus dem Autoradio kam der dunkle, männliche und trotzige Marsch aus Hector Berlioz’ »Symphonie Phantastique«. Es war ein Gefühl wie nach Hause zu kommen, und mit einem Seufzer des Wohlbehagens machte ich den vergeblichen Versuch, mich in dem kleinen Auto wieder zu meiner embryonalen Haltung zusammenzurollen. Die nackten, spitzen Finger hatten wieder nach meinem Herzen getastet, und wieder hatten sie ihr Ziel verfehlt. Ich atmete aus.
Johanna Becker betrachtete mich aufmerksam, mit jener alles durchschauenden Liebe, die in dem Luftraum über Preußen einen Augenblick lang an meine innersten Wurzeln gerührt hatte.
– So können Sie nicht sitzen, sagte sie mit ihrer tiefen Altstimme. Sie müssen die Sicherheitsgurte umschnallen!
– Warum denn?
– Weil ich erst vor acht Tagen meinen Führerschein gemacht habe.
– Und da fahren Sie schon im Berliner Verkehr?
– Ja; um die Angst zu überwinden. Nach diesen Worten ließ sie mit einem kurzen, unbeschreiblichen kleinen preußischen Lachen den Wagen in den Verkehr hinausgleiten, kreuzte mit verbissener Miene eine riesige Chaussee, wo kreischende Bremsen anzeigten, daß es nicht allen so leicht fiel wie ihr, die Angst zu überwinden.
Mit einer Geschwindigkeit von achtzig Stundenkilometern bewegten wir uns durch den dichten abendlichen Verkehr, durch Steglitz auf das idyllische Friedenau zu.
Man konnte in diesem Nebel kaum etwas von der Außenwelt erkennen; wir durchquerten unbekannte Vorortviertel, bis plötzlich die rote Backsteinkirche, die zu den vernehmlichen architektonischen Schönheiten Friedenaus zählt, aus dem Nebel auftauchte.
Hier passierte der erste Zusammenstoß. Er war nur ganz leicht; ich hatte sie gebeten, unvorsichtigerweise, könnte man meinen, aber im nachhinein hat man gut reden, mir die hegelianischen Wurzeln des marxistischen Mystifikationsbegriffes zu erläutern.
Mit dem gleichen unbeschreiblichen, kurzen preußischen Lachen wie vorhin kletterte sie aus dem Auto, stellte fest, daß der rechte elegante Kotflügel des parkenden Sportwagens verbeult war, daß er aber bestimmt von dem Gummihammer eines erfahrenen Autoklempners wieder gerichtet werden könnte, und steckte mit einer Geste, die von beachtlicher Übung zeugte, eine Visitenkarte aus ihrer imponierenden Handtasche unter den Scheibenwischer des fremden Wagens.
Nach weiteren fünfzehn Minuten mußten wir beide feststellen, daß wir offenbar in einem unüberwindlichen Labyrinth von Einbahnstraßen gelandet waren. Sie lachte wieder ihr preußisches Lachen – ein Mittelding zwischen einem kurzen Schnauben und einem Niesen, und stellte fest:
– Es sieht so aus, als hätten wir Schwierigkeiten, die Fregestraße zu finden.
– Ich könnte eine Ewigkeit hier drinnen bei Ihnen sitzen. Lassen Sie sich Zeit.
Auf diese Erwiderung hin ließ sie sich mit einem warmen, perlenden weiblichen Lachen über das Steuer nach vorn fallen, und dann, nachdem sie lange in dieser Stellung weitergefahren war, sah sie mit vor Lachen tränenfeuchten Augen zu mir auf.
In diesem Augenblick passierte der zweite Zusammenstoß.
Seltsamerweise war es wieder ein roter Sportwagen, aber diesmal komischerweise ein Volvo, dem der hintere Kotflügel eingedrückt worden war.
Wir waren gerade dabei, die Visitenkarte unter dem Scheibenwischer zu befestigen, als ich aufsah und das Haus hinter der Gitterpforte wiedererkannte.
Ich lud meine Taschen aus, setzte mich wieder in den Wagen, legte den Kopf in ihren Schoß und flüsterte:
– Wir müssen uns wiedersehen!
Mit ihrer starken, sommersprossigen Hand strich sie mir übers Haar, griff rasch in ihre Handtasche und reichte mir noch eine ihrer offenbar zahllosen Visitenkarten. Ich steckte sie in meine Hemdtasche.
Machtlos sahen wir einander einen Augenblick lang an, mit uralter Vertrautheit strichen wir einander übers Haar.
Mit einem Kreischen verschwand der kleine Wagen um die Ecke, und ich kehrte zu meinen Taschen am Straßenrand zurück, der erfahrenen Aktenmappe und der großen grauen. Ein magerer Mann in weißen Hosen aus englischem Leder und einem weißen Sweater lehnte sich nachdenklich über den Zaun und betrachtete mich. Er mußte schon lange dort gestanden haben. Mit uraltem Eidechsenglanz leuchteten die Augen in seinem Reptilgesicht.
– Du bist ziemlich spät dran, sagte er und nahm meine Tasche. Endlich stand ich vor meinem Freund E.
– Du hast dich nicht verändert, sagte er.
– Ich habe einen Bart, sagte ich.
– Ich glaube nicht, daß dieser Bart etwas Besonderes bedeutet, sagte er.
Mit tiefer Zuneigung betrachtete ich dieses seltsame Geschöpf. Er hatte mich schon mindestens einmal gerettet.
In dem riesigen, hellen Wohnzimmer wartete bereits die Teekanne auf uns.
Kurze Unterbrechung der Erzählung
Die sechziger Jahre waren zu Ende gegangen. Frühling und Herbst zugleich, die Zeit, als der Wind zu wehen begann! Die Zeit, als unsere kollektiven Träume sich veränderten und uns tief in den nächtlichen Schlaf hinein verfolgten mit ihren schwachen, deutlichen Warnsignalen, diese Zeit des beginnenden Sturms, des blankeren Eises, der größeren Einsamkeit; und die Zeit, als die Menschen einander wieder fanden; wie kurz, wie bedeutungslos erschien nicht diese Zeit, als sie plötzlich zu Ende war! Ist sie vielleicht doch nur eine Schwelle gewesen?
Nach und nach triumphierte in den Ländern Europas die durch Gesetze geregelte Ordnung der Welt. Die präzise geeichten Mechanismen der Kompromisse, der Lügenmaschinerien, der schändlichen Absprachen, mit denen die Macht herrscht und der erste Frost fällt, die empfindlichen Uhrwerke, die im Inneren der Staaten die Zeit bemessen, waren für ein paar kurze Jahre in der Mitte des Dezenniums aus dem Gleichgewicht geraten. 64 veränderten sich sogar unsere Träume; das Bild Nixons verschmolz mit dem Bild von Rudolf Hess, der noch in seiner abgelegenen Zelle gefangen saß. Bei unserem Erwachen änderte sich der Tonfall.
1967 wurde es allen bewußt, daß der Traum und die Wirklichkeit wiederum ein Zwiegespräch begonnen hatten. Es war die Zeit der Ketzer, der geschlossenen Gesellschaften, der geheimen Sekten, der kollektiven Großfamilien. Oh, wie es stürmte!
In der ganzen Welt stürmte es: es pfiff durch alte morsche Gebäude! In Asien brannten und tobten die Kriege, und der Geruch nach verbrannten Wäldern, verbrannten Häusern wehte mit dem starken, gleichmäßigen Wind über die Hügel Asiens. Die mörderischen Geschwader, die einst das unschuldige Dresden angeflogen hatten, flogen nun Tag und Nacht ihre Angriffe auf Hanoi, es war eine Zeit für Mörder, eine mörderische Zeit, eine blutige, entsetzliche Zeit, aber auch eine Zeit der Hoffnung, eine glückliche Zeit der Verneinung.
Wir hingen an unseren Fernsehapparaten und sahen, wie unsere Welt sich veränderte, und zuinnerst begannen wir zu ahnen, daß der kleine Schimmer von Wahnsinn, die kleine, unterdrückte gelbe Flamme der Schizophrenie, die in uns allen brennt, nicht vergebens gewesen war, daß der kleine Rest von Wahnsinn, den wir durch die Kindheit, durch die Wehrpflicht, durch die kultivierten Seminare an alten Universitäten mit eichengetäfelten Wänden hindurch gerettet hatten, doch irgendwie im Recht war. Daß er da war, weil wir ihn einmal brauchen würden.
Es war eine dieser Zeiten, in der die Schizophrenie zu ihrem Recht kommt, weil sie, nur sie, dem Zustand der Welt entspricht.
Mächtig erhoben sich alte, fast vergessene Schriften aus dem Dampf der Lokomotiven und dem Kohlenstaub des vergangenen Jahrhunderts: Marx, Bakunin, Tschernyschewski, und hinter ihnen ein noch längeres Gefolge, das fast kein Ende nehmen wollte, ein mächtiger Zug von Geistern und Ideen.
Wir sahen, wie die japanischen Studenten mit ihren langen starken Knüppeln Sturm liefen, wie sie sich auf dem Schlachtfeld der Straße gegen die Übermacht schlugen, nicht zu Hunderten, sondern zu Zehntausenden. Und in einem Land nach dem anderen liefen die schwarzen Brigaden der Polizei mit ihren Wasserwerfern, Tränengasbomben, Panzerwagen Sturm. Am 20. Dezember 1967 wurden die Demonstranten in einem Hinterhalt in der Barnhusgatan eingekesselt, es war die Nacht, in der man Jan Myrdal seine Brille herunterschlug, die Nacht, in der die junge schwedische Generation ihre Lektion in Gemeinschaftskunde auf eine für die Zukunft entscheidende Art auslernte und abschloß. Überall marschierten die schwarzen Polizeiarmeen, die Panzerwagen rasselten, die Helikopter warfen ihre seltsamen insektenhaften Schatten auf Harvard und Cornell, auf Frankfurt und Amsterdam. In Berlin wurde die dreiunddreißigjährige Dozentin für theoretische Philosophie Johanna Becker von einem Polizeiknüppel bewußtlos geschlagen, der gegen ihre rechte Schläfe gerichtet war, aber zu weit hinten traf, um den dünnen Schädelknochen zu zerschmettern.
Da die Gruppe, zu der sie gehörte, in einer wilden Flucht begriffen war, ließ man sie im Rinnstein liegen und begnügte sich damit, nach ihr zu treten. Am Anfang der fünfziger Jahre, als sie auf ähnliche Weise bei einer Demonstration in Paris zusammengeschlagen wurde – damals ging es um Algerien –, hatten freundliche Menschen sie fast unmittelbar darauf in den Schutz eines Treppenhauses gezogen. In Berlin gibt es diese Tradition nicht.
Ich stelle mir ihr wunderbares rotblondes Haar vor, wenn sie da liegt, von Blut und Schmutz befleckt. Dieses Haar habe ich gestreichelt.
Und das Frühjahr 1968! Das Frühjahr, in dem der adrette schwedische Lektor an der Sorbonne, der geistreiche Privatmann Jan Ifvarsson auf die Straße hinaustritt und seinen netten kleinen BMW ordentlich und unwiderruflich in eine Barrikade eingebaut findet, die gerade von der Gendarmerie mit Granatfeuer dem Erdboden gleichgemacht wird! Das Frühjahr, in dem Traum und Wirklichkeit einander so nahe kamen, daß es einen Augenblick, lang schien, als würde sich die alte Wirklichkeit tatsächlich auflösen, und wo mitten unter den gewaltigen Inschriften auf Wänden und Bretterzäunen das eine, das mächtige alchimistische Wort auftauchte, das die politische Polizei dazu brachte, mit dem Verbrennen ihrer Papiere zu beginnen, und das de Gaulles Kanzleibeamte zu dem Versuch veranlaßte, mit stumpfen Federmessern ihre Namen von den schlimmsten Dokumenten zu kratzen:
DER TRAUM IST WIRKLICHKEIT
ausgerechnet in diesem Frühjahr war es auch schon zu Ende. Unerbittlich tickten die feinen Uhrwerke weiter in ihrer sicheren newtonschen Zeit. Ihre heimlichen Unruhen hatten sich verschoben, die Bremsblöcke waren in ihren mächtigen Ketten herabgefallen, die Gewichte, Zehntausende von Tonnen schwer, zeigten wieder nach unten.
In Piranesis bitteren Gefängnissen spielt sich alles im Innenraum ab, und wird eine Öffnung sichtbar, ein Gewölbe, das das Tageslicht hereinläßt, dann bemerkt man gleich dahinter ein weiteres Gewölbe.
Sekten tauchten auf. Finstere Ketzergruppen gediehen. In abseits gelegenen Wohnungen in Östermalm sonderten sich fanatische Jugendliche ab, die sich eben noch Seite an Seite mit den anderen auf der Barnhusgatan geschlagen hatten, schalteten das Radio aus, zerrissen die Zeitungen und begannen mit methodischer Langsamkeit und nicht ohne jenes Quentchen von Gewalt und ausgeklügelter Grausamkeit, das ein Kennzeichen der heiligen Inquisition ist, einander methodisch auszumerzen.
Man setzte die Volksschullehrerbrille auf, zog ein sektiererhaftes Gesicht und sprach von unser aller Schuld und Sünde. Da war ein Zischen wie von Schlangen, ein Seufzen wie auf Gebetsversammlungen.
Der alte Feind war wieder da, aber diesmal kam er von einer ganz unerwarteten Seite, und bald hatten wir wieder das gewohnte alte tabakbraune skandinavische Gebetshaus statt der neuen, der freien Kathedrale der erträumten Welt. Wir hatten geglaubt, nur noch um Haaresbreite von einer ästhetisch-erotischen Gesellschaft entfernt zu sein, und drückten doch schon die Armesünderbank.
(Du lügst, du Teufel! Du hast nicht recht!)
Die sechziger Jahre waren zu Ende gegangen. Die Kriege dauerten an, die Gegensätze nahmen zu. Die Demonstranten verschwanden von den Straßen, Sekten und Ketzergruppen verschwanden in einem Laubhaufen zusammen mit dem braunen Laub des Vorjahres, das unter den von Abgasen halb erstickten Bäumen der europäischen Boulevards zusammengekehrt wurde.
Aber etwas blieb zurück. Der lange Marsch durch die Institutionen begann. In seit langem versteinerten Körperschaften begann man wieder miteinander zu reden. Funktionäre, die seit der Nachkriegszeit selbstgefällig auf ihren Floskeln des Einverständnisses herumgekaut hatten, spürten eine Unruhe, ahnten in der Abenddämmerung etwas fast Vergessenes. Es entstand eine Unruhe, sie kam und ging, aber sie war da.
Und die Sprache, wie veränderte sie sich nicht! Wie viele tote alte Phrasen, wieviel morsches Lügenwerk wurde da nicht ausgemerzt!
Es war, als hätten die Menschen zu guter Letzt miteinander zu reden begonnen, als wäre nur noch wenig Zeit übrig, als hätten sie es alle eilig.
1964 hatten wir nachts Träume anderer Art zu träumen begonnen.
Aber im Laufe des Dezenniums sollte es noch einmal zu einer Veränderung unserer Träume kommen.
Die verborgene Gesellschaft unter der sichtbar triumphierenden; das Vertrauen, das ursprüngliche naive Vertrauen war ein für allemal erschüttert, aber das Vertrauen auf die Sprache, auf die kompromißlerischen Phrasen, auf die Versicherungen der Machthaber, daß wir in der besten aller Welten lebten, war auch bei den Machthabern selbst erschüttert, so daß jeder sich schließlich umblickte, als hätte er jemand anders hinter sich stehen.
Und im Herbst 1969, als die Zeitungen sich rasch umorientierten, die Formulierungen sich änderten, die Löwen der großen Worte sich wie verschreckte Mäuse in ihre Löcher verkrochen angesichts der Androhung einer Handelsblockade von seiten der mächtigen und kriegführenden USA, ja, da war es, als wäre niemand imstande gewesen, dieses Schauspiel (wie viele solche kleine Pantomimen hat die Geschichte nicht schon gesehen) anders zu nennen als bei seinem rechten Namen.
Und da war niemand, der nicht innerlich über dieses abgeschmackte Spektakel höhnisch gelacht hätte.
Und gerade in den letzten Jahren dieses Dezenniums war es, als ob inmitten all dieser Verwirrung, all dieser Lügenhaftigkeit, die ihre Blöße mit ihren eigenen Lumpen nicht mehr bedecken konnte, sich etwas anderes hören ließe, eine schwächere Stimme, aber eine kristallklare.
Die Mystik, die wie die allerschwächste Flöte vom Beginn des Dezenniums an zu hören gewesen war, in den Seminaren der Logik verirrt, wie die Erkennungsmelodie einer Radiostation vom Rauschen starker Störsender über stacheldrahtbeladene Grenzzonen hinweg gestört, in unklarem Eklektizismus verwaschen und verdreht, im dummen derben Marktgeschrei der Happeningkunst ertrunken, von neubekehrten Pamphletisten in blindem Eifer mit einem Achselzucken abgetan, diese Musik verschaffte sich zu guter Letzt auf seltsame Weise Gehör.
Nicht umsonst hatten Traum und Wirklichkeit einander einen Augenblick lang berührt, nicht umsonst war einen Augenblick lang das Unwirkliche in unserer eigenen Welt (stinkender Rauch, tote Augen, Bombergeschwader, der Höllenlärm der Fabrikhallen) deutlich hervorgetreten und hatte sich eine andere, eine kommende Welt als die wirkliche abgezeichnet.
Im Frühjahr 1969 malt Ulla Viggen ihr liebevolles und seltsames Porträt des jungen Poeten Peter Cornell.
Der Porträtierte ist auf diesem Bild bleicher und introvertierter, als er in Wirklichkeit erscheinen mag.
Seine Augen sind geöffnet. Er hat einen Gesichtsausdruck wie jemand, der gerade sehr nahe daran war, sich an etwas zu erinnern, das er schon so vollständig vergessen hatte, daß er sich nicht entsinnen kann, es vergessen zu haben.
Im Hintergrund taucht ein sehr blaues, ganz endloses Meer auf, von einer unsichtbaren Sonne beschienen.
In diesem Bild offenbart sich die neue Stockholmer Malerei zum ersten Mal ganz und gar, wird sie in all ihrem Botticellischen Glanz sichtbar. Helligkeit, Liebe, offenes Meer.
Die sechziger Jahre waren zu Ende gegangen. Und ich? Von welchem Beobachtungsposten aus, auf welcher Walstatt hatte ich diese Kämpfe mit angesehen?
Von der Kulisse aus. Wie die Artisten unter der Zirkuskuppel: ratlos.
Ein Privatmann, nicht besonders erfolgreich, am Ende der sechziger Jahre
Der Herr, den E. mit seinen kalten, klugen, eisblauen Augen immer noch aufmerksam betrachtete, stand nach wie vor unschlüssig, von seinen Taschen umgeben, in dem großen, weißen Eßzimmer des Hauses.
Sein Haar war noch zerrauft von Johanna Beckers sommersprossiger, mütterlicher Hand.
Als nun der Duft von starkem Tee und getoastetem Brot ihn erreichte, breitete sich ein Ausdruck zögernden Glücks auf seinem Gesicht aus; er legte den grauen Mantel und den rotbraunen Schal ab.
Ein landendes Flugzeug glitt in geringer Höhe über die Hausdächer hin und brachte für einen Augenblick die Fensterscheiben zum Klirren.
(Tatsächlich wiederholte sich dies alle zehn Minuten in dem Haus an der Fregestraße, und es verlieh allen Gesprächen, die dort geführt wurden, einen willkürlichen, aber nicht einseitigen Charakter. Einige Argumente, und man wußte im voraus nie, welche, waren von vornherein dazu verurteilt, in dem majestätischen Dröhnen der landenden Flugzeuge unterzugehen.)
Die runde Brille mit der braunen Fassung war am 13. Dezember 1963 in Turin gekauft worden.
Er war eher klein als hochgewachsen. Aber trotz seiner Kleinheit und seiner auffallenden Magerkeit – eine intimere Betrachtung hätte enthüllt, daß alle Rippen deutlich zu spüren und zu zählen waren, sogar auf dem Rücken – war er bemerkenswert muskulös. Seine breiten Handgelenke und die großen kräftigen Hände machten ihn zu genau der Person, die jeder gern zur Hand hat, wenn Glaskonserven mit allzu fest aufgeschraubten Deckeln geöffnet werden sollen.
Auffallend war der dichte braune Bart, von dem E. vorhin gesagt hatte, daß er nichts Besonderes bedeute.
Er irrte sich.
Im Laufe von zehn Jahren hatte ich gesehen, wie die Fotografien, die meinen Rezensionen in den Zeitungen beigegeben wurden, sich veränderten. Am Anfang des Dezenniums stellte man mich noch als eine Art anämischen, bebrillten Jüngling dar; Hilfspfarrer oder außerordentlicher Anwärter auf das Lehramt.
Es war eine relativ idyllische Zeit, als meine Bücher für exzentrisch und im Prinzip unverständlich, aber selbstverständlich für völlig statthaft gehalten wurden. Meine Verleger brachten sie mit zerstreuter Gleichgültigkeit heraus. Kein Mensch erwartete, daß ich damit fortfahren würde, welche zu schreiben.
Ich lebte in Frieden und Teeduft in einem Zimmer mit Vorplatz im vierten Stock, in der Öfre Slottsgatan 5 in Uppsala. Meine Fenster lagen im Schatten eines mächtigen Ulmenwipfels.
Gegenüber, auf der anderen Seite der Straße, wohnte ein zierliches dunkelhaariges Mädchen, und zur Winterzeit pflegte ich mit Schneebällen an ihre Fensterscheibe zu klopfen, die ich vorsichtig von meinem Fenster aus hinüberwarf.
Die Jahre vergingen.
Dann begann sich dieser bleiche Lehramtsanwärter in den Zeitungen schrittweise zu verändern. Ich weiß weder, wo man die Bilder herbekam, noch weiß ich, wie man sie Schritt für Schritt zu verändern wußte, aber an einem Frühlingstag im Jahre 1969 merkte ich, daß die Entwicklung abgeschlossen war.
Aus jeder Zeitung sah mir jemand entgegen, der angeblich ich sein sollte, der aber tatsächlich so etwas war wie ein böser Zwerg, der kaum mehr sein Wasser halten konnte, ein boshafter Gnom, der aber unbedingt Pipi machen mußte, eine Art Inbegriff aller Kälte, Abstraktion und Teufelei, eine Art schiefmäulige, gefühllose Mißgeburt.
Da legte ich mir meinen großen, dichten, starken Vollbart zu, nicht unähnlich dem braunen Fell eines Bären.
Damit habe ich mich ein für allemal von dem Bild distanziert, das die Öffentlichkeit von mir hat. Macht nur weiter mit euren schiefmäuligen Monstren! Wer, wenn er meinen Namen hört, sich einen boshaften Zwerg vorstellt, der kaum mehr sein Wasser halten kann, mag das jetzt nach Lust und Laune tun.
Bitteschön! Greift zu! Mir könnt ihr nichts vormachen!
Ich kenne euch wohl! Ich weiß Bescheid über euch, ihr kreischenden und grinsenden Wasserspeier unter den Regenrinnen der Zeit, ich kenne euer teuflisches Gelächter. Noch ist eure Frist nicht abgelaufen, noch seid ihr nicht zu schön geformtem Sandstein erstarrt!
Ich kenne dich wohl, du kläffende, bellende, winselnde Hundemeute!
Verwachsene Windhunde mit eigentümlich tränenseligen, großen blutdürstigen Augen, Ulmer Doggen mit roten geifernden Lefzen, triefend vor Gier! Bizarre Köter, aus verschiedenen Rassen gemischt, die nur ein heiseres, krächzendes Bellen zustande bringen, und Möpse, massenhaft Möpse, unglaubliche Mengen von fetten, kurzbeinigen kleinen Möpsen – wer hätte gedacht, daß ihr so schnell laufen könnt? Und Schoßhunde sind dabei, die niedlichsten Schoßhunde mit kleinen roten Schleifen und Bändchen, chinesische Schoßhündchen, alle müssen sie dabeisein! Schnell, schnell!
Jäger, blas in dein Horn! Es knistert in der verharschten Schneedecke, es leuchtet silberhell auf den verschneiten Feldern, es riecht nach Menschenfleisch. Heute nacht kriegen wir ihn! Schnell, schnell!
Heute nacht kriegt ihr mich nicht.
Kurz und gut: deshalb habe ich meinen Bart.
Unruhig näherte ich mich dem gedeckten Tisch. Die Brotscheiben dufteten in ihrem Korb, die ambrafarbene Apfelsinenmarmelade glänzte, der Tee dampfte in seiner braunen Kanne. Da ich während des ganzen Fluges geschlafen oder zumindest in einer Welt geruht hatte, die dem Schlaf sehr nahe ist, begann ich nun deutlich zu spüren, daß der Hunger wie ein Sturm in mir wütete. Und ohne unser Gespräch fortzusetzen, stürzte ich auf den großen einladenden Tisch zu.
Ich bin hungrig, immer hungrig, ungeduldig, schnell. Fast alle Ereignisse gehen mir zu langsam. Ich stampfe mit dem Fuß auf und zähle die Minuten, wenn der Zug an einem Zweigbahnhof hält, ich drehe die Telefonstrippe zu einer Spirale, wenn ein wortreicher oder allzu schwerfälliger Mensch mir etwas zu erklären versucht, was ich schon längst begriffen habe. Wenn das Schreiben eines Zeitungsartikels so viel Zeit braucht, daß es sich bis zum Mittagessen hinzieht, werfe ich ihn mit einem Fluch in den Papierkorb und greife das Thema nie wieder auf, im Rundfunkstudio weigere ich mich, die Sendung abzuhören, die ich gerade gesprochen habe. Ich verbrauche alles, Bücher, Freunde, Ideen, als wäre es etwas, das man essen kann.
(Ich? Oder mein lächerliches Schattenbild? Nicht immer. Nicht immer Ich.)
Ich bin hungrig. Immer hungrig. Meine Metabolismen brennen wie eine Azetylenflamme.
Ich esse den ganzen Tag vom Erwachen gegen sechs Uhr morgens an bis zum Schlafengehen um zwölf Uhr nachts. Um Haaresbreite bin ich stets vom äußersten Hunger entfernt, aber mehr auch nicht. Gelingt es mir nicht, eine ständige, gleichmäßige Zufuhr von Essen zu sichern, waschbeckengroße Tassen mit Tee, Beefsteaks, Käsebrote, gerate ich leicht in einen überreizten, zornigen Zustand, der erst in Wutausbrüche übergeht und dann in Apathie.
Ich bin davon überzeugt, daß ich in tiefe Ohnmacht versinken und dann sterben würde, wenn man mich vierundzwanzig Stunden lang ohne Essen lassen würde. Ich bin friedlich, wie alle größeren Säugetiere, solange man mich nicht angreift, aber ich weiß mit Bestimmtheit, daß ich für Nahrung würde töten können.
Jetzt hatte ich seit sechs Stunden nichts gegessen. Es mußte eine Veränderung geschehen sein, ich muß sozusagen in einem anderen geistigen Klima geweilt haben, einem bedächtigeren, einem glücklicheren als meinem gewohnten, mit einer tieferen Atmung, einer ruhigeren Wärme.
Jetzt wurde ich wieder in mein eigenes Dasein zurückgerissen, und der Hunger machte sich über mich her.
Ich erinnere mich an diesen Hunger seit meinem dritten Lebensjahr.
Auch die sechziger Jahre hatte ich hungernd verbracht.
Ich erinnere mich an die seelenlose Prosa, in der wir am Anfang des Dezenniums miteinander redeten, in Uppsalas schrecklichen Cafés mit ihrem seltsamen Duft von verfaulendem Holz. Wir hausten in der angelsächsischen Erkenntnistheorie, wie man in einem heruntergekommenen Hotel haust, ohne Enthusiasmus, aber froh, überhaupt eine Wohnstatt zu haben. Seitdem habe ich auch in den Philosophien des Kontinents gewohnt, habe an anderen Töpfen geschnuppert. Ich fühle mich fast ebenso heimisch bei Hegel und Marx, bei dem stolzen Bakunin wie bei dem kleinen eigensinnigen, schiefäugigen Sartre und dem klugen Lukács... Er sei gesegnet! In seiner dunklen Wohnung, hinter schweren Gardinen, in der V. Beograd in Budapest sah er mich lange mit seinen großen, braunen Rehaugen an und sagte:
– Junger Mann, Sie müssen Geduld haben. Wir können uns nicht aussuchen, in welcher Geschichtsperiode wir leben wollen.
Ich sah den Sturm langsam kommen. Er machte mir nicht angst, sondern er machte mich frei. Er entsprach einem Sturm in mir selbst.
Aber ich handelte nicht.
Ich sah Ideen kommen und sah sie sich blamieren.
Ich selbst blamierte mich nicht.
Ich sah die Einsicht kommen und sah sie zu Sentimentalität verfaulen, zu schalen und glücklichen Schuldgefühlen.
Ich selbst blieb verschlossen.
Wie fing es an? Wenn ich mich nur erinnern könnte!
Treuloses Gedächtnis! Wenn ich dich darum bitte, dich zu erinnern, dann erinnerst du dich statt dessen an etwas anderes! Wenn ich versuche, mich an meine Ungeduld zu erinnern, dann erinnere ich mich plötzlich nur an Ruhe. Wenn ich versuche, mich an mich selbst zu erinnern, dann erinnere ich mich nur an die Welt, die mich umgibt.
Immer größer wurde die Macht der öffentlichen Lüge. Es begann mit kleinen Rissen, Unstimmigkeiten, einem mikroskopischen Abstand zwischen der Welt, von der man redete, und der Welt, die tatsächlich da war.
Der Morgenzug sollte laut Fahrplan um 9:40 in Stockholm ankommen, aber er kam niemals früher als 9:50. Eine Kleinigkeit, könnte man meinen, aber sie war da. Die Züge wollten nicht mehr so recht mit dem Fahrplan übereinstimmen, weil man so tun wollte, als gingen die Züge schneller, als es tatsächlich der Fall war.
Die Alltagsprosa hatte seit langem ihre Rolle als Sprache des Realismus, als Sprache der Wissenden, der Eingeweihten ausgespielt. Jene, die wirklich Bescheid wußten, jene, die an Macht und Einfluß teilhatten, sprachen die Verwaltungssprache mit ihren geheimnisvollen Abstraktionen und Abkürzungen, eine Sprache, die Schwarz zu Weiß machen konnte und an der nur jemand, der Mitglied war, jemand, der über die streng bewachten Schlüssel verfügte, ablesen konnte, daß Nein war, was alle als Ja auffaßten, und daß das, was alle Unwissenden und Außenstehenden als Nein auffaßten, ein heimliches Ja war.
So waren die großen Universitätsreformen der sechziger Jahre durchgesetzt worden, unter dem Motto: Erkenntnis für alle; tatsächlich aber bedeuteten sie eine Einschränkung des Wissens, das zugleich der Schlüssel zur Freiheit, zur Einsicht, zu einer besseren, weniger unpersönlichen Zukunft war.
So waren die gewaltigen Kompromisse im Inneren des Staatsgefüges eingebaut und vor der Außenwelt verborgen worden: unter dem Deckmantel des Pluralismus, des Wirtschaftslebens, der Gewerkschaftsbewegung, der Interessengruppen verbarg sich eine einzige, gewaltige, zentralistische Macht. Regionalpläne wurden ausgebreitet, staatliche Zentren abgerissen, die Landgemeinden wurden entvölkert, bis ihr allmählicher Verfall mit rostenden Maschinen auf den Ackern, mit einstürzenden Dächern und windschiefen Gebäuden schließlich zum Inbegriff der ländlichen Siedlung überhaupt wurde. Innerhalb von Schwedens Grenzen wurden die Landgebiete langsam ausgeräumt und von einer unsichtbaren Besatzungsmacht, die sie in ihrer Gewalt hatte, in weiße, blaue und rote Zonen aufgeteilt.
Die Risse weiteten sich, immer größer wurde der Abstand zwischen Sprache und Wirklichkeit: da war eine Lügenmaschinerie am Werke, und die Lüge breitete sich aus wie eine Infektion und drang in alle Ecken und Ritzen ein.
Mächtig tobten die Oktoberstürme in jenem Jahr; 1969. Der Wald wurde abgemäht wie Gras, die Telefondrähte ringelten sich um gebrochene Masten, es klapperte und heulte in rissigen Bauwerken.
Jetzt kamen Wahrheiten zutage. Das elende Spekulationsgeschäft mit dem Wohnungsbau in den fünfziger und sechziger Jahren, wo die Decken mit Büroklammern befestigt und die Wände mit Tesafilm aneinandergeklebt wurden, zeigte sein wahres Gesicht. Da brachen die Wände heraus! Da flogen die Dächer davon!
Die Experten sprachen von einem neu entdeckten Gesetz: dem Vacuumeffekt.
Der Vacuumeffekt galt nicht für die 103 Meter hohe Turmspitze Nicodemus Tessins des Jüngeren in Västerås, die jahrhundertelang allen Blitzen des Himmels getrotzt hatte, er galt nicht für die Peterskirche in Rom, er galt nur für die Spekulationsbauwerke der fünfziger und sechziger Jahre.
So überlistete die Witterung zu guter Letzt die Grammatik.
Und als 1969 um die Weihnachtszeit die Bergarbeiter in den Erzgebieten im Norden aus ihren Gruben herauskamen und erklärten, sie hätten genug, da geschah etwas Bemerkenswertes: ihre Syntax war einfach, rein, verständlich, und die Funktionäre, die Bergwerksdirektoren, die Minister konnten sich nicht mehr verständlich machen, da ihre Sprache im Vergleich zu dieser verworren, dunkel, vieldeutig, schamlos verschlüsselt war.
Da wurde auch eine Wahrheit offenbar.
Und jene Augen! Jene mütterlichen und durchdringenden Augen, die mich ein paar Minuten lang auf meiner Reise so ruhig und forschend betrachtet hatten.
Sie hatten mich etwas gefragt. Und ich wußte, was.
Wie groß war mein eigener Anteil an der Lüge? Wie tief war die Ansteckung, war das Virus in mich selbst eingedrungen?
Welchen parallellaufenden Prozessen bei mir selbst entsprach dies alles? War ich ein Lebender oder ein Toter? War ich ein kleines Pelztier, das den Frost im tiefsten Winter verschläft und sich im Schlaf regt? Oder war das alles schon nicht mehr möglich? War der kleine kalte Punkt da drinnen schon gewachsen, hatte er schon so viele von den feinen Schichten der Seele erobert, daß es kein Zurück mehr gab?
Hungrig. Ruhelos. Wie ein Holzwurm Bücher und Manuskripte durchfressend. Unterwegs in den mit weichen Teppichen belegten Gängen des mütterlichen, höhlengleichen Bonnierschen Verlagshauses. Verfasser einer Reihe von Büchern, die einander nach und nach wiederaufnahmen, bis nichts mehr übrigblieb. Warm und kalt zugleich, unfähig zu festen zwischenmenschlichen Beziehungen und zugleich furchtbar treu und blind ergeben demjenigen, der mich ein einziges Mal gesehen hatte.
Jetzt war ich gesehen worden; aus der tiefsten Gleichgültigkeit, aus der totalen Nichtigkeit, die für mich das natürliche und selbstverständliche Ende des Dezenniums bedeuteten, war ich zu verzweifelter Aufmerksamkeit erwacht, als mich schließlich jemand angesehen hatte.
Daran klammerte ich mich, wie ein Ertrinkender sich an den dünnsten schwächsten Weidenzweig des Ufers klammert.
In dem Haus an der Fregestraße tickten die Uhren. E. sah nachdenklich zu, wie ich ein Butterbrot nach dem anderen aß und wie der Inhalt des Marmeladentopfes merkbar zusammenschrumpfte. In der rechten Hand balancierte er versonnen ein scharfgeschliffenes, breites halbmeterlanges Messer, eine Zuckerrohrmachete aus Kuba.
Äußerlich war mir nichts anzusehen. Mit ihren seltsamen, klugen und liebevollen Augen hatte die fremde Dame mich aus der Tiefe der Gleichgültigkeit geweckt. Zwei Stunden lang hatte ich mich vollkommen ruhig gefühlt.
Jetzt kam der Schmerz, der der Preis des Wachseins ist.
E. fragte:
– Und was tust du eigentlich in Stockholm?
Ich sah von meiner Teetasse auf, ein Privatmann, nicht besonders erfolgreich, am Ende der sechziger Jahre, und antwortete:
– Ich erlebe meine Zeit, ich zerhacke meine Zeit in kleine Stücke, ich laufe hungernd von einem Teil meines Lebens zum anderen. Ich sehe in ziemlich deutlichen Umrissen, was geschieht, was geschehen wird und muß, aber ich überschaue es nicht.
Ich schreibe Essays, ich rezensiere Theaterpremieren, ich lese vergessene Philosophen an meinem Kaminfeuer in Västerås, ich habe an ein sehr langes Gedicht letzte Hand angelegt: ich werde es dir zeigen, es heißt »Liebeserklärung«.
– Weshalb?
– Weil es eine Liebeserklärung ist.
– An wen.
– Oh, an irgend jemand. An jemand.
– Natürlich an jemand.
– An einen besseren Menschen, der kommen muß, an eine bessere Menschheit – und es ist meine feste Überzeugung, daß die Zeit gekommen ist, wo man wählen muß zwischen Untergang und Gemeinschaft.
– Wer war sie?