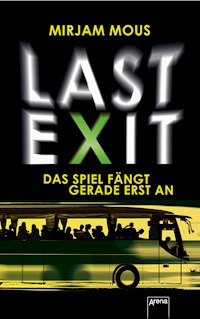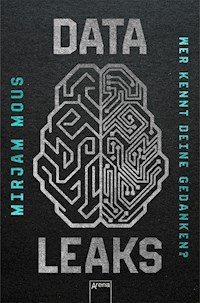4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Fin sitzt in einer Zelle der spanischen Polizei, weil man ihm vorwirft, eine Frau ermordet zu haben. Nur Valerie kann ihm helfen, seine Unschuld zu beweisen. Seit ihrer gemeinsamen Reise durch Spanien, denkt Fin nur noch an sie. Aber Valerie ist verschwunden und die Polizei findet immer mehr Beweise für Fins angebliche Tat. Allmählich wird ihm klar, dass Val nicht die ist, für die er sie bisher gehalten hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Die Autorin
Mirjam Mous, geboren 1963, arbeitete als Sonderschullehrerin, bevor sie hauptberuflich Schriftstellerin wurde. Sie schreibt Bücher für Kinder und Jugendliche und ist besonders bekannt für ihre mitreißenden Thriller.
Impressum
Erste Veröffentlichung als E-Book 2012 © für die deutsche Ausgabe 2012 Arena Verlag Würzburg Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Vals Spel« bei Van Holkema & Warendorf, Houten. © 2010 Van Holkema & Warendorf/Unieboek The Netherlands Alle Rechte vorbehalten Aus dem Niederländischen von Verena Kiefer Die Übersetzung dieses Buches wurde von der Stiftung für die Produktion und Übersetzung niederländischer Literatur NLF gefördert. Covergestaltung: Frauke Schneider ISBN 978-3-401-80142-1www.arena-verlag.de Mitreden unter forum.arena-verlag.de
Titel
Mirjam Mous
Room 27
Zur falschen Zeit am falschen Ort
Aus dem Niederländischen von Verena Kiefer
Erste Hälfte
Zu Fall gebracht
I’m caught in a trap I just can’t believe that There’s no turning back
(Fragment aus dem SongtextCaught in a trap von Love Equals Death)
1
Zeit: heute Ort: Polizeiwache Francaz – Spanien
Sie glauben, dass ich jemanden umgebracht habe.
Die Vorstellung allein ist schon so lächerlich, dass sie fast witzig wäre, würde ich nicht in einer Gefängniszelle hinter echten Gittern sitzen, als wäre ich eine Art Dr. Hannibal Lecter. Aber in Wirklichkeit habe ich weder einen Schulabschluss noch einen akademischen Titel und es steht auch noch in den Sternen, ob ich überhaupt studieren will. Schon wieder Schule? Außerdem graut es mir vor Fleisch, also wird man mich auch nicht so mir nichts, dir nichts einen Schädel auslöffeln sehen. Die einzigen lebenden Wesen, die ich im Laufe meines Daseins um die Ecke gebracht habe, sind Insekten – die Mücke steht mit Abstand auf Platz eins meiner Liste mit Todesopfern, aber wenn man so provozierend summt, fordert man das ja auch regelrecht heraus.
Ich habe um nichts gebeten. Gerade saß ich noch vollkommen entspannt hinter dem Mäuerchen am Pool und dann plötzlich – als würde ich hochgebeamt und irgendwo anders abgeworfen – in einem Polizeiauto. Okay, zwischendurch ist natürlich schon so das eine oder andere passiert, aber: So schnell ging’s! Ich durfte nicht einmal mehr mit Val reden. Na ja, der Polizeibeamte schüttelte jedenfalls den Kopf, als ich nach ihr fragte. Im Nachhinein betrachtet, kann es natürlich auch sein, dass er den Kopf schüttelte, weil er meine Frage nicht verstand. Ich spreche höchstens zehn Wörter Spanisch und die guardia civil noch weniger Englisch und erst recht kein Niederländisch.
Aber rasen können sie. Wir fuhren durch die sonnigen Straßen, als wäre uns ein Tyrannosaurus Rex dicht auf den Fersen. Vielleicht wollten die Polizisten nur rechtzeitig für irgendein wichtiges Radrennen zurück sein, denn sobald wir auf der Wache waren, deponierten sie mich bei einer dicken Frau in Uniform und verzogen sich wieder.
Ich habe noch nie zuvor in einer Zelle gesessen. Ich habe nicht einmal gedacht, dass ich jemals in einer landen könnte. Noch besser: Hätte mich gestern einer gefragt: »He, Fin, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemals in den Bau wanderst?«, hätte ich ohne Zögern »null« gerufen. Aber nun ja, ich verliere auch immer bei Kartenspielen wie Siebzehn und Vier oder Poker. Wenn es ums Raten geht, habe ich nie eine Chance. Ich liege fast immer falsch.
So eine Zelle ist übrigens ganz sicher kein Drei-Sterne-Hotel. Ich hocke auf etwas, das man mit viel Fantasie ein Bett nennen könnte. Die Schaumstofffüllung hat sich aufgelöst, sodass nur ein Brett in einer viel zu großen Hülle übrig geblieben ist. Darauf einzuschlafen, wäre selbst für einen geübten Fakir eine gewaltige Herausforderung. Und dann hängt auch noch eine widerliche Mischung aus Alkoholdunst und Urin in der Luft, wahrscheinlich von dem schlafenden Obdachlosen auf dem zweiten Bett in der Ecke. Hoffentlich gehört der nicht wirklich in die Kategorie Hannibal Lecter und hat Appetit auf ein Fin-Häppchen.
»Mannomann, du steigerst dich da wieder total in was rein«, würde Val sagen.
Aber Valerie ist leider nicht hier. Die habe ich in ihrem Liegestuhl zurückgelassen. Inzwischen wird sie sich wohl fragen, wo ich bleibe. Ich sollte nur kurz diesen Geldbeutel abgeben, aber ich konnte doch nicht ahnen, dass dort eine Leiche…
Es nervt mich immer total, wenn mein Hirn an etwas denkt, was ich am liebsten so schnell wie möglich vergessen will. Und das macht es ziemlich häufig, also nervt es mich entsprechend oft. Ich will lieber an positive Dinge denken. Zum Beispiel daran, dass Val hierherkommt und nur kurz zu erklären braucht, wie ich in dieses Hotelzimmer kam und so. Und dass diese dicke Polizistin sich dann hunderttausendmal entschuldigt und mich danach gehen lässt.
Eigentlich kapiere ich sowieso nicht, weshalb sie mich festgenommen haben. Mit ein bisschen Menschenkenntnis kann man doch sofort sehen, dass ich der Falsche bin.
Ein Beispiel: Ich wiege im Supermarkt Tomaten ab, ein Mitarbeiter kommt vorbei und schaut mich durchdringend an. Und – zong! – sofort steht mein Kopf in Flammen, bloß weil er denken könnte, ich wollte anschließend noch ein paar dazustecken.
Noch ein Beispiel: Ich rasiere mich einmal pro Vierteljahr mit dem Apparat, den ich von Martijn zum Geburtstag bekommen habe. Aber das mache ich bloß zur Schau und für Martijn, denn ich habe überhaupt nichts, was ich rasieren könnte; auf meinem Kinn sprießt höchstens ein wenig Flaum. Und zu allem Überfluss habe ich eigentlich schwarze Ringellocken, die meine Mutter für niedlich hält. Sie glaubt übrigens immer noch, der Rest der Welt schließe sich dieser Meinung an, aber meine Kleinkindphase ist Jahrhunderte her.
Mit niedlichem Haar beeindruckt man keine Mädchen. Deswegen lasse ich es immer so kurz schneiden, dass es sich fast nicht mehr lockt. Der einzige ganz passable Teil meines Körpers ist mein Adamsapfel. Der sorgt jedenfalls dafür, dass mich die Leute nicht für ein Mädchen halten. Deshalb habe ich allen Rollkragenpullovern abgeschworen, selbst bei zehn Grad unter null.
Das braucht man hier ja nicht zu befürchten. Manchmal kann man dem Quecksilber im Thermometer buchstäblich beim Klettern zusehen. Gestern waren es fünfunddreißig Grad. Im Schatten! Als ich heute Morgen aufwachte, wusste ich schon, dass es wieder ein heißer Tag werden würde. Dann gehen Val und ich meistens schwimmen, also zog ich gleich meine Badehose an und darüber die Jeans mit den abgeschnittenen Hosenbeinen, außerdem mein dunkelblaues Lieblings-T-Shirt von Salty Dog und meine Badelatschen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich ein paar Stunden später vor den Augen einer dicken Polizistin alles wieder ausziehen müsste. Nach meinem Strip hat sie meine Kleidung – und meinen Geldbeutel aus der Gesäßtasche meiner Hose – in eine Plastiktüte gesteckt und mitgenommen. Wahrscheinlich zur Untersuchung oder so. Nur die Badehose durfte ich anbehalten.
Es ist nicht angenehm, nur mit einer Badehose bekleidet in einer Zelle zu sitzen. Vor allem nicht, wenn allerlei scheußliches Ungeziefer über den Zellenboden kriecht. Kakerlaken kann ich fast ebenso wenig leiden wie Mücken. Sie schießen immer in alle Richtungen, nur nicht in die richtige – wie diese große, dicke braune, die scheinbar gerade meinen nackten rechten Fuß anpeilt. Mit ihrem harten Panzer sind sie fast nicht kaputtzukriegen. Will man mit dem Schuh eine Kakerlake plätten, muss man stundenlang hin- und herdrehen, bevor sie wie eine Walnuss knackt. Mit bloßen Füßen hat man von vornherein keine Chance. Ich ziehe die Beine hoch – hoffentlich sind das hier Kakerlaken mit Höhenangst –, setze mich in den Schneidersitz und lege meine Hände auf die Knie. Meine Fingerspitzen und Nagelränder sind schwarz. Bevor sie mich eingesperrt haben, hat die dicke Polizistin meine Fingerabdrücke abgenommen. Ich spucke auf die Tinte und versuche, sie am Bezug meines sogenannten Bettes abzureiben. Weil ich sowieso nichts Besseres zu tun habe, halte ich das eine ganze Weile durch: reiben, spucken, reiben.
Vergeblich. Wahrscheinlich hält diese Sorte Tinte lebenslänglich.
Ich wünschte, Val würde sich ein wenig beeilen. Sie wird doch nicht in aller Ruhe auf den Bus warten, wenn sie hört, dass ich in einem Gefängnis sitze? Wenn die Rollen umgedreht wären, würde ich notfalls einen Motorroller klauen, um so schnell wie möglich bei ihr zu sein. Vorzugsweise mit einem englisch sprechenden Spanier am Lenker, damit ich ihm – sorry, sorry! – erklären kann, warum wir jetzt wirklich zur Polizeiwache rasen müssen und so.
Trampen ginge natürlich noch schneller. Vor allem, wenn man so aussieht wie Val. Wenn sie mit erhobenem Daumen am Straßenrand steht – in Shorts mit ihren langen braunen Beinen in Cowboystiefeln –, muss man schon stockblind oder völlig verrückt sein, wenn man an ihr vorbeifährt.
Fuck, jetzt muss ich auf einmal an Highway Killings denken – einer der geschmacklosesten Filme, die ich je gesehen habe. Es geht um einen Lastwagenfahrer, der unschuldige Mädchen von der Autobahn mitnimmt, um alles andere als unschuldige Sachen mit ihnen zu machen. Mädchen wie Val also.
Ich schwöre es, ich habe niemanden umgebracht. Folglich ist der wahre Täter noch immer auf freiem Fuß. Es ist nicht unmöglich, dass Val ihm zufällig begegnet und zu ihm ins Auto steigt…
Wie mich das alles gerade nervt! Eingesperrt sein, ist der Laune nicht gerade zuträglich.
Positiv denken! Stefano lässt Val bestimmt nicht irgendeinem Monster in die Hände fallen. Ich muss einfach ein bisschen mehr Geduld haben, dann stehen sie gleich mit einem Grinsen von hier bis Tokio vor der Tür. Und vielleicht ist auch noch gar nicht so viel Zeit verstrichen, wie ich denke. Meine Armbanduhr ist im Rucksack und von hier aus kann ich nirgends eine Uhr hängen sehen, ich muss also weiterraten, wie lange ich hier schon eingesperrt bin. Eine Gefängniszelle hat nicht unbedingt den Unterhaltungswert eines Vergnügungsparks. Eine Stunde kann einem hier durchaus dreimal so lang vorkommen. Vor allem, wenn man so grottenschlecht im Raten ist wie ich.
2
Zeit: heute Ort: Polizeiwache Francaz – Spanien
Schlurfende Schritte. Mein Kopf federt hoch.
Es ist die dicke Polizistin in ihrer grünen Uniform. Ihr gigantischer Bauch wogt auf und ab. Sie erinnert mich an Barbalala – genau, die grüne von den Barbapapas. Ich hatte als Kind ein Bilderbuch von denen. Im Normalzustand sehen die Barbapapas aus wie Riesenbirnen, aber sie können ihren Körper mit einem einfachen Zauberspruch in jede gewünschte Form verwandeln. Ich wünschte, ich besäße diese Gabe auch. Dann würde ich mich spaghettidünn zaubern und könnte durch die Gitterstäbe flutschen.
Ich brauche keine Zauberei. An Barbalalas Gürtel hängt ein Schlüsselbund. Sie schaut kurz zu dem schlafenden Obdachlosen hinüber und öffnet dann die Zellentür. Ihr runder Kopf gibt mir ein Zeichen, dass ich ihr folgen soll.
Endlich! Ich stelle die Füße auf den Boden, ohne weiter auf die Kakerlaken zu achten. Ich weiß, dass sie noch dort sitzen, aber es interessiert mich nicht mehr.
Barbalala verschließt die Zellentür wieder hinter mir. Dann geht sie vor mir her den Gang hinunter.
Ich habe dasselbe befreite Gefühl wie nach dem letzten Klingeln vor den Schulferien. Val ist hier, ich bin ganz sicher. Gleich bekomme ich meine Kleider zurück und dann darf ich gehen.
Barbalala führt mich über einen Flur in ein Büro mit einem großen Schreibtisch, auf dem sich Pappordner stapeln, umgeben von einem Laptop, einem gelben Memoblock, einem Igel mit Stiftstacheln, zwei Plastikbechern mit Wasser und einer großen, viereckigen Schachtel. Hinter dem Schreibtisch steht ein gepolsterter Lehnstuhl auf Rädern mit verstellbaren Armlehnen. Er klagt nicht, als Barbalala ihren enormen Leib in ihn fallen lässt.
Der Stuhl vor dem Schreibitsch ist aus hartem dunklem Holz. Der ist also für mich. Es ist die Art Stuhl, bei der man ganz von selbst gerade sitzt, vor allem, wenn man nichts trägt außer einer Badehose. Aus irgendeinem Grund muss ich an den elektrischen Stuhl denken. In Amerika gibt es immer noch Staaten, in denen die Todesstrafe verhängt wird. Wie ist das eigentlich in Spanien? Na ja, manche Sachen möchte man gar nicht wissen.
Das Büro wirkt genauso verschlissen wie meine Zelle. Weil eine normale Klimaanlage fehlt, kreist über meinem Kopf ein Ventilator. Ein kupferfarbenes rotierendes Gerät mit dunkelbraunen Flügeln. Ich hasse Ventilatoren. Vor allem, wenn sie an einer niedrigen Decke kreisen und die Aufhängung, statt stabil und vertrauenswürdig auszusehen, hin und her schlackert wie bei diesem Exemplar. Ich muss die ganze Zeit daran denken, was passieren kann, wenn er sich losreißt – drehende Flügel, die sich in Messer verwandeln –, mein Kopf in Scheiben, Hirnklümpchen an der Wand…
Ich versuche, den Ventilator aus meinen Gedanken zu verbannen, indem ich mich auf andere Dinge konzentriere. Die Uhr an der Wand, die fünf vor halb zwölf zeigt. Der zweite Schreibtisch in der Ecke, der Wasserspender, der Kalender, dessen Blätter schon seit Monaten nicht mehr abgerissen wurden, die Pinnwand mit Zeitungsausschnitten und einem Plakat. Ich kann nicht entziffern, was darauf steht.
»Wo ist Val?« Meine Stimme ist seltsam heiser.
Barbalala schiebt mir einen Becher Wasser hin. Plötzlich merke ich, wie durstig ich bin. Ich schütte den Inhalt in einem Zug hinunter und frage dann erneut: »Wo bleibt Valerie?«
Meine Stimme klingt jetzt um einiges besser, aber Barbalala versteht mich nicht oder will mich nicht verstehen. Sie zeigt auf die Schachtel und sagt etwas auf Spanisch. Ich nehme an, dass sie Pizza enthält und sie wissen will, ob ich Hunger habe, also nicke ich.
Zum zigsten Mal schaue ich mich um. Ich entdecke noch eine Tür hinten im Raum, daneben eine Garderobe, aber Val ist wirklich nirgends zu sehen. Es sei denn, sie hätte sich hinter dem zweiten Schreibtisch versteckt, um gleich hervorzuspringen. »Überraschung!« Valerie liebt Spielchen.
Barbalala klappt die Schachtel auf. Es ist tatsächlich Pizza drin. Mit Tomate, Champignons, Käse und leider, leider auch mit Schinken. Hat sie mich deswegen aus der Zelle geholt?
»Ich esse kein Fleisch«, sage ich zuerst auf Niederländisch, und als sie mich glasig anschaut, auch auf Englisch.
Sie versteht es nicht.
Hätte ich es nur nicht immer Martijn überlassen, alles Sprachliche zu regeln, dann wäre mein Spanisch nicht so armselig. Eine Frage reiner Bequemlichkeit, die mir jetzt einen Strick dreht.
Ich nehme ein Pizzastück und versuche, den Schinken abzuschaben, was ziemlich eklig aussieht, wenn man so schwarze Fingernägel hat wie ich. »Kein. Fleisch.« Ich schüttele wild den Kopf, zeige auf den Schinken, auf mich und wieder auf den Schinken.
Barbalala zuckt die Schultern und nimmt sich auch ein Stück Pizza.
Mein knurrender Magen trägt den Sieg über meine Prinzipien davon. Ich nehme einen Bissen vom knusprigen Rand.
Barbalala saugt mit ihren fleischigen Lippen das gesamte Pizzastück auf einmal ein und dann bewegt sich ihr Kiefer. Wie eine Häckselmaschine im Dauerbetrieb. Würde man einen Zweig reinstecken, wäre der in null Komma nichts zerkleinert. Also, was ich sagen will: Innerhalb weniger Sekunden hat Barbalala die Nahrung vollständig zermahlen. Es ist ein schrecklich unappetitlicher Anblick. Der Teig bildet einen Kloß in meinem Mund und ich muss würgen.
»Agua?«, fragt Barbalala.
Wasser! Das ist eins der ungefähr zehn Wörter, die ich kenne. Ich nicke erleichtert.
Sie füllt meinen Becher am Wasserspender, stellt ihn vor mich und setzt sich wieder hin. Ich trinke und sie isst. Oder besser: schlingt. Noch zweimal fragt sie mich etwas auf Spanisch. Dann ist die Pizza in ihrem Magen verschwunden und sie faltet die Schachtel, um sie anschließend im Papierkorb zu versenken. Aus einer Schreibtischschublade fischt sie ein Päckchen Papiertaschentücher. Ich bekomme auch eins als Serviette. Sobald sie ihre Finger abgewischt hat, zerknüllt sie das Tuch und schnippt es zur Schachtel. Sie schiebt den Laptop näher und macht ihn auf. »Nombre?«
Das verstehe ich noch. »Fin van Toor.«
Sie versucht, meinen Namen zu wiederholen. »Fanfan Toro.«
Ich schüttle den Kopf. »Fin. Van. Toor.«
Sie schiebt mir den Memoblock rüber, nimmt einen Stift aus dem Igel und bedeutet mir, meinen Namen aufzuschreiben. Danach tippt sie ihn ab. »Dónde vives?«
»Holandés«, sage ich. »No hablo español.« Ich spreche kein Spanisch. Das ist so in etwa der einzige Satz aus dem Sprachführer, an den ich mich erinnern kann. »Inglés, sí.«
Aber wie schon befürchtet, spricht Barbalala kein Englisch. Sie rattert in dieser unverständlichen Sprache los, die hundert Wörter zu brauchen scheint, um eine einzige kleine Sache zu beschreiben.
»No hablo español«, sage ich dann eben noch einmal.
Jetzt fängt sie auch noch an, wie ein Gebärdendolmetscher zu gestikulieren. Ihre fleischigen Arme pendeln vor meinem Gesicht und in ihren Achseln erscheinen Schweißflecken. Manche Menschen sollte man dazu verpflichten, Deodorant zu verwenden.
Meine Augen wandern zum zigsten Mal zur Tür.
Wo bleibt Val denn bloß? So allmählich könnte sie doch wirklich hier sein. Ob sie überhaupt weiß, dass ich hier bin? Vielleicht hat ihr niemand erzählt, dass die Polizeibeamten mich mitgenommen haben, und es dauert noch Stunden, bis sie dahinterkommt?
Oder noch schlimmer: Tage.
Barbalalas laute, schrille Stimme schweigt endlich. Sie sieht mich leicht resigniert an. Über meinem Kopf schwirrt unaufhörlich der Ventilator. Durch den Luftzug hat sich eine Ecke meines Papiertaschentuchs angehoben. Es zittert wie eine kleine weiße Flagge im Wind, bis ich meine Hand darauf lege.
Ehrlich gesagt bin ich ziemlich verzweifelt. Nur der Gedanke an Val hält mich noch aufrecht. Sie kann mich retten. Sie ist mein Alibi und meine Dolmetscherin.
Wenn sie irgendwann mal noch auftaucht, nervt eine Stimme in meinem Kopf.
Und dann denke ich auf einmal etwas ganz Schreckliches. Was, wenn sie gar nicht vorhätte zu kommen? Mich sogar nie mehr sehen möchte. Dass sie mich bewusst im Stich gelassen hat, weil die Polizisten ihr weisgemacht haben, dass es stimmt. Dass ich wirklich jemanden ermordet habe…
3
Zeit: drei Monate früher Ort: Fins Dachbodenzimmer Den Haag – Niederlande
Ich hatte es mir mit meinem Laptop und der Webcam in meinem Zimmer gemütlich gemacht, den Rücken ans Bett gelehnt, die Beine im Schneidersitz und den Computer auf dem Schoß. Das Dachfenster stand offen und ließ einen Streifen Sonnenlicht herein. In der Kastanie, die fast bis an den Dachfirst unseres Hauses reicht, hockte eine Amsel, die sich wohl für die Reinkarnation von Michael Jackson hielt. Weiter weg erklang Verkehrslärm von Autos und das Klingeln einer Straßenbahn.
»Brüderchen.« Auf dem Bildschirm mir gegenüber lächelte Martijn in seinem neuen spanischen Haus, ein wenig langsamer und verschwommener als in Wirklichkeit.
»Bruder.« Ich grinste zurück. Wahrscheinlich auch etwas unscharf und träger als sonst, aber reden ging immer noch schneller als tippen.
Martijn ist zehn Jahre älter als ich. Eigentlich sind wir keine Brüder, sondern Halbbrüder – derselbe Vater, andere Mutter –, lange Geschichte.
»Hast du sie?«, fragte Martijn.
Ich hielt sie an den Schnürsenkeln hoch. Meine nagelneuen Bergschuhe. »Aus wasserdichtem und doch atmungsaktivem Gore-Tex®«, imitierte ich den übermäßig begeisterten Verkäufer.
»Aber einlaufen«, sagte Martijn. »Sonst bekommst du bombensicher Blasen.«
Ich zog sie sofort an und hielt meine beschuhten Füße vor die Webcam. »Die bleiben jetzt an den Füßen, bis ich in Spanien bin. Ich gehe damit schlafen und duschen.«
Er grinste. »Einlaufen. Der Rest hat wenig Sinn.«
Ich stellte die Sohlen mit dem dicken Profil wieder auf dem Boden ab. »Hast du die Strecke schon ausgetüftelt?«
»Moment, ich hole gerade die Karte.«
Die noch kahle Wohnzimmerwand kam ins Bild. Ein paar Tage zuvor hatte Martijn sein kleines Appartement in der Stadtmitte gegen einen Bungalow in einem ruhigen und bewachten Vorortviertel eingetauscht. Man könnte sagen, er sei für seine Arbeit umgezogen, aber eigentlich war er nur geflohen.
Nach der Schauspielschule war alles noch normal; Martijn spielte in ein paar Werbefilmen und modelte ein wenig. Das Elend hatte vor einem halben Jahr angefangen, als er zum exklusiven Gesicht von Deseo wurde, einer spanischen Herrenduftlinie. Plötzlich konnte er nicht einmal mehr einkaufen gehen, ohne angesprochen zu werden. Wirklich, man glaubt kaum, wie ungehobelt manche Leute sein können. Sie wollten mit ihm fotografiert werden, in seine Muskeln zwicken, ihn beschnuppern und fühlen, ob sein sagenhaftes Sixpack – im bekanntesten Spot robbt er nur mit Jeans bekleidet aus dem Meer – keine Trickaufnahme war. Wenn Martijn sich weigerte, wurden sie manchmal sogar wütend. Er versuchte, sich noch eine Zeit lang mit Sonnenbrillen, Baseballkappen und Kapuzen zu vermummen, aber es gab immer jemanden, der vollkommen hysterisch wurde, wenn er vorbeiging. In seinem neuen Haus ließ man ihn wenigstens in Ruhe, sagte Martijn. Die Nachbarn im Viertel legten wie er viel Wert auf ihre Privatsphäre und ein Schlagbaum mit Pförtner hielt alle unerwünschten Besucher vom Gelände.
»Da bin ich wieder.« Martijn setzte sich und hielt sich die Karte vor die Brust. »Wir lassen das Auto in Torla.« Er zeigte auf einen winzigen Punkt. »Dort beginnt unsere Wanderung.« Sein Zeigefinger glitt über ein Stückchen Schlängellinie in einem braunen Flecken – die Pyrenäen. »Wir folgen hauptsächlich dem Großen Wanderweg 11. Je höher wir kommen, desto schwieriger wird es.« Dabei machte er ein Gesicht, als könne er sich nichts Schöneres vorstellen, was wahrscheinlich auch stimmte. »Mittags kann es in den Bergen einen gewaltigen Spuk geben. Wenn es regnet oder gewittert, sucht man besser in einer Berghütte oder im Zelt Schutz. Darum stehen wir jeden Morgen ganz früh auf, damit wir doch ausreichend Kilometer schaffen.«
»Ähem.« Ich verdrehte die Augen. »Und ich dachte, Ferien wären zum Ausschlafen da!«
»Faultier.« Er legte die Karte neben sich auf den Tisch. »Du wirst sehen, wie großartig das wird: Sich erst richtig ins Zeug legen und dann schön was kochen.«
Auf meiner Netzhaut erschien das Bild eines Kuriers, der auf einem Motorroller durch die Berge flitzt. »Können wir uns nicht einfach eine Pizza kommen lassen?«
Er kicherte. »Und wie wolltest du die bestellen? Wir sind mitten in der Natur, an abgelegenen Stellen, wo dein Handy oft keinen Empfang hat.«
Ich wusste nicht einmal, dass es solche Orte noch gab. »Und wenn sich zum Beispiel einer von uns den Knöchel verstaucht?«
»Holt der andere Hilfe.«
»Und wenn ich mich dann verirre?«
»Tja.« Sein rechter Mundwinkel verzog sich spöttisch nach oben. »Dann fressen uns die Wölfe.«
»Haha.«
»Ich trage das Zelt und den Erste-Hilfe-Koffer«, versprach er. »Und wenn es nötig ist, werfe ich mir dich über die Schulter.«
Das würde er sogar schaffen. Martijn trainierte jeden Tag, um seinen muskulösen Körper in Form zu halten. Dass er kein Gramm zunehmen dürfe, stand in seinem Vertrag.
Für Martijn war die gesamte Werbekampagne übrigens nur eine Methode, schnell Geld zu verdienen. Eigentlich wollte er auf der Theaterbühne stehen und griechische Tragödien und Shakespeare und so spielen. Deswegen nahm er gern an Workshops und Meisterklassen berühmter Schauspieler teil.
Jemand kam die Treppe hoch.
»Esther ist zu Hause«, sagte ich. »Ich höre jetzt auf.«
Martijn nickte. »Grüß sie von mir. Bis bald, Brüderchen.« Dann unterbrach er die Verbindung.
Ich entfernte die Webcam, klappte meinen Laptop zu und legte beides unter mein Bett.
Ein Klopfen an der Tür. »Fin?«
»Ist offen.«
Meine Mutter streckte den Kopf um die Ecke. »Hallo, Schatz. Schau mal, was ich für dich habe.«
Ihr restlicher Körper kam nun auch herein. Sie drehte sich um und zeigte mir den großen Rucksack, der um ihre Schultern hing. Die Rückseite war grün mit Schwarz und der etwas verschlissenen Klappe nach war das Gepäckstück schon weit gereist.
»Von Kai«, sagte sie. »Du darfst ihn leihen.«
Kai war ihr Kollege im Büro.
»Nicht schlecht.« Ich stand auf und nahm ihr den Rucksack ab. Er hing lose auf meinem Rücken und wog weniger als meine Schultasche. Das würde sich vollgepackt schnell ändern.
Ich dachte an meine beiden besten Freunde. Menno würde mit seinen Eltern drei Wochen auf einem Campingplatz in Zeeland verbringen und Tom flog mit seiner Mutter und seiner Schwester nach Griechenland, wo sie ein Appartement gebucht hatten. Im Vergleich zu ihnen fühlte ich mich wie ein Entdeckungsreisender. Plötzlich konnte ich es kaum erwarten.
Meine Mutter hatte sich auf meinem Bett niedergelassen und klopfte mit der flachen Hand einladend auf den Platz daneben. Ich setzte mich zu ihr.
»Findest du es wirklich nicht schlimm, dass ich in die Staaten fliege?«, fragte sie.
Während meines Spanienurlaubs, würde sie mit ihrem Freund Carl auf Reisen gehen. Im Stillen nannte ich ihn den Saugnapf. Wenn man ihn einen Abend bei uns zu Hause erlebt hat, weiß man, warum. Meine Mutter scheint ihn unwiderstehlich anzuziehen wie ein Stück Sahnetorte, von dem er nicht die Finger lassen kann. Nicht einmal, wenn ich dabei bin. Eigentlich müsste ein Gesetz erlassen werden, das Leuten über dreißig verbietet, Speichel miteinander auszutauschen.
Ich schüttelte den Kopf. »Warum sollte ich?«
»Na ja.« Sie hielt mich fest. »Es kann immer etwas passieren und dann bin ich nicht zu Hause.«
»Was denn?«
»Was weiß ich. Herunterfallende Felsbrocken. Blutgefüllte Blasen oder ein Mordsstreit mit Martijn.« Sie zog mich fest an sich, als wäre ich sechs und keine sechzehn. »Wenn du dann plötzlich früher nach Hause willst, ist keiner da, um dich vom Flughafen abzuholen.«
»Es gibt auch Züge. Und weshalb sollte ich auf einmal Streit mit Martijn bekommen?«
Sie seufzte. »Du hast natürlich recht. Ich muss mich einfach noch dran gewöhnen, dass ich einen so großen, vernünftigen Sohn habe.« Jetzt küsste sie mich auch noch ab!
»Aufhören!«, rief ich.
Manchmal ist sie eher ein junges Mädchen als eine Mutter. Sie presste ihre Lippen wieder auf meine Wange und ließ es knattern wie einen Furz.
»Mama!!« Ich kringelte mich vor Lachen und ließ mich rückwärts aufs Bett fallen. »Igitt!«
4
Zeit: heute Ort: Polizeiwache Francaz – Spanien
Barbalala hat mich zu meiner Zelle zurückgebracht. Ich habe versucht, ein wenig zu schlafen, aber mein Kopf scheint aus allen Nähten zu platzen. Zu allem Überfluss liegt der Obdachlose jetzt auf dem Rücken und schnarcht mit der Lautstärke einer Motorsäge.
Zum Glück ist mir auch etwas Positives eingefallen. Wenn die Polizisten Val sagen, dass ich ein Mörder bin, wird sie es nie glauben. Sie weiß, dass ich den Geldbeutel nicht stehlen, sondern nur zurückbringen wollte.
Leider ist sie noch immer nicht aufgetaucht. Wenn ich sie nur anrufen könnte. Ich dachte, nach einer Verhaftung hätte man immer das Recht auf einen Anruf, aber Barbalala hat mich nicht danach gefragt. Oder ich habe sie nicht verstanden, aber das glaube ich eigentlich nicht, das hätte sie leicht mit Gebärden darstellen oder mir einfach einen Hörer in die Hand drücken können. Na ja, auch egal. Ich kenne Vals Nummer sowieso nicht auswendig. Sie ist in meinem Handy gespeichert, das ich in meinem Tran in meinem Rucksack habe stecken lassen.
Meine Mutter kann ich schon gar nicht erreichen. Amerika ist Lichtjahre von Spanien entfernt und dann haben sie auch noch irgend so ein lächerliches Telefonsystem, bei dem sie ihr niederländisches Handy eh nicht nutzen kann. Das hat mir zumindest der Saugnapf erzählt. Ich weiß nur, dass sie irgendwo an der Westküste ist, aber ich habe keine Ahnung, in welcher Stadt oder in welchem Hotel. Sie könnte genauso gut auf dem Mond sein oder wie Martijn an einem geheimen Ort.
Ich kann es nicht ändern, auf einmal werde ich von Selbstmitleid überwältigt. Alle denken nur an sich und lassen mich im Stich. Normalerweise bin ich wirklich nie aggressiv. Aber der Gedanke an alle anderen, die ihren Spaß haben, während ich hier mutterseelenallein in der Zelle hocke, löst etwas in mir. Auf einmal überkommt mich ein ganz großes Bedürfnis, mich an dem Brettbett auszuleben. Baff! Dummer Saugnapf. Baff! Fuck Amerika. Baff! Eklige Kakerlaken. Baff! Dreckspenn. . .
»Fin van Toor?«, erklingt eine näselnde Männerstimme.
Meine Faust schwebt in der Luft. Vor mir steht ein Mann, der aussieht, als könne er jeden Moment in Tränen ausbrechen. Das ist nur Schein. Seine Augen bleiben trocken und er schüttelt mir munter die Hand, nachdem er die Zelle geöffnet hat. Wahrscheinlich hat er einfach nur Pech und ist mit einem traurigen Gesicht geboren.
»Ich bin Inspektor Perez«, sagt er, »und ich möchte gern mit dir über das reden, was geschehen ist.«
Es dauert ein paar Sekunden, bis es zu mir durchdringt: Ich verstehe ihn, er spricht englisch! Mann, was bin ich erleichtert. Ich unterdrücke die Neigung, Perez um den Hals zu fliegen, sonst denkt er noch, ich sei schwul. Nicht, dass ich was gegen Schwule hätte, im Gegenteil. Aber ich bin es nun einmal nicht und manchmal sollte man besser klare Verhältnisse schaffen, vor allem, wenn man auch schon beweisen muss, dass man kein Mörder ist.
Wieder werde ich zu dem Büro mit dem Schreibtisch und dem Stiftigel geführt. Der Ventilator hängt noch immer an der Decke, aber Barbalala ist verschwunden. Wahrscheinlich nicht für länger, denn Perez setzt sich nicht auf ihren Stuhl. Er rollt den Bürostuhl vom zweiten Schreibtisch neben den von Barbalala und setzt sich. Der unbequeme Holzstuhl ist wieder für mich.
»Die Klimaanlage im Verhörraum ist kaputt«, sagt Perez. »Dies ist der einzige Raum, in dem man es bei dieser Hitze noch einigermaßen aushalten kann. Ich nehme an, es macht dir nichts aus, dass wir hier reden?«
Er wartet meine Antwort nicht ab und nickt Barbalala zu, die mit einem schwarzen Gerät unter ihrem fleischigen Arm und einer Plastiktüte mit geheimnisvollem Inhalt hereinkommt. Ihr Gesicht ist mit kleinen Schweißtropfen übersät.
»Hast du etwas dagegen, wenn wir dir DNA abnehmen?«, fragt Perez.
Natürlich nicht. Ich bin unschuldig.
»Nein«, sage ich.
Er nimmt die Tüte von Barbalala und leert sie aus. Ich sehe ein Plastikröhrchen mit einem Etikett, Plastikhandschuhe und ein verschweißtes, überdimensioniertes Wattestäbchen, das mich an einen Riesengehörgang voller Ohrenschmalz denken lässt. Perez streift sich die Handschuhe über und packt den Wattestab aus. Er ist nicht für meine Ohren, sondern für meinen Mund gedacht.
»Aufmachen«, kommandiert Perez.
Er schabt ein wenig Schleim von der Innenseite meiner Wangen. Dann steckt er den Stab in das Röhrchen und beschriftet das Etikett.
Barbalala hat mittlerweile das schwarze Gerät auf dem Schreibtisch platziert. Sie drückt zwei Tasten ein, sagt ein paar Worte, spult zurück und hört sich an, ob der Text gut aufgenommen ist. Was ich übrigens für sehr vernünftig halte, denn der Rekorder – das ist es also – sieht aus, als sei er noch vor dem Krieg produziert worden. Dann lacht sie und macht das »Alles-ist-ok«-Zeichen mit Daumen und Zeigefinger. Perez sagt etwas und danach lacht auch er, wodurch ich das Gefühl bekomme, dass sie mich beide auslachen. Ich finde es daher gar nicht schlimm, als Barbalala wieder verschwindet. Das Röhrchen mit meiner DNA nimmt sie mit.
Perez drückt die Aufnahmetasten des Rekorders, nennt unsere Namen und vermutlich – aber das rate ich nur – Datum und Uhrzeit. »Hast du einen Ausweis dabei?«, fragt er. »Damit wir feststellen können, ob dein Name richtig ist.«
»Mein Pass ist in meinem Rucksack.«
»Wo wohnst du?«
Ich erkläre, dass ich aus den Niederlanden komme. »Den Haag.« Ich nenne die Adresse.
»Wer wohnt noch dort?«
»Meine Mutter. Sonst niemand.«
»Wenn du mir die Telefonnummer gibst, kann ich sie darüber informieren, dass du hier bist.«
»Das wird nicht gehen. Ich weiß nicht genau, wo sie ist. Sie macht mit ihrem Freund Carl eine Rundreise durch die USA und ist erst in einer Woche wieder erreichbar.«
»Jemand anderes dann? Dein Vater?«
»Gestorben. Schon vor ein paar Jahren.«
»Wie alt bist du?«
»Sechzehn.«
»Was machst du hier in Spanien?«
»Urlaub. Ich sollte mit meinem Halbbruder in den Bergen wandern gehen, aber…« Sobald ich an Martijn denke, juckt etwas hinter meinen Augen. »Na ja, das klappte also nicht. Dann bin ich allein mit dem Rucksack losgezogen und kam…«
Perez fällt mir ins Wort. »Wo bist du überall gewesen?«
Ich nenne ein paar Orte, an die ich mich erinnern kann. Racotta, Santa Pol und La Lina.