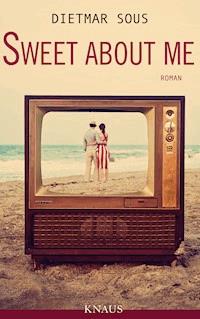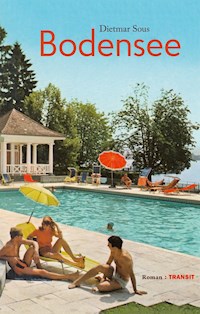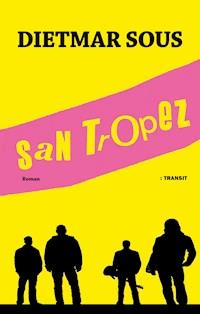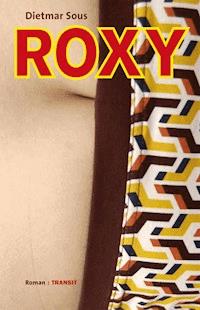
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Transit
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zeit: Die allerbeste, nämlich Mitte siebziger Jahre. Ort: Eine Kleinstadt mit Fußgängerzone, Kino und Autobahnanschluss irgendwo zwischen Köln und Aachen. Held: Roxy (eigentlich Paul), knapp achtzehn Jahre, Außenseiter, Analphabet (deswegen Radio- und Schulfunk-Fan), Hilfsarbeiter, Deserteur und schließlich Zivi im Krankenhaus; verliebt sich ziemlich aussichtslos in Sonja, Tochter aus gutem Hause. Personal: Sonja, Gymnasiastin, trifft bei Hausarbeiten über den Röhmputsch auf Roxy, der alles darüber weiß. Herr Kessler, Fabrikant, erklärt Roxy zum Arbeiterdenkmal, schmeisst ihn raus und trifft ihn, angeblich todkrank, im Krankenhaus wieder. Franz Kafka, Autor der Erzählung »Die Verwandlung«, die Roxy als Vorlage für erste Schreibübungen nutzt. Zippi, Wohngenossin von Roxy und Kämpferin für die Anerkennung der DDR. Schuppe, immer ohne Geld, aber einfallsreich, vermietet seinen Balkon an Voyeure. Han, sehr kleine und sehr höfliche Koreanerin, schützt Roxy vor dem Chefarzt. Adamski, der sich Weihnachten aus Angst vor Einsamkeit ins Krankenhaus schmuggelt. Und viele andere mehr: Mütter, deren Liebhaber, ein Swimming Pool, eine Milchbar, Studenten, die Musik aus Sklavenhalterstaaten nicht mögen, Zigaretten namens Güldenring, Ernte 23, Milde Sorte - und natürlich Roxy Music. Ein Roman über das unangepasste Leben junger Leute, »outcasts« am Rande einer scheinbar sehr heilen Gesellschaft. Geschrieben wie ein Roadmovie: schnell, witzig, schroff und manchmal melancholisch. Mit seltsamen Vögeln, die einem zufliegen, als hätte man sie schon lange gekannt. Mit Geschichten, die so schräg und witzig sind, dass man sie gerne weiter erzählt. Und mit einem Plot, dessen Ende dem Helden trotz hohen Risikos unglaubliches Glück einspielt. Ein Buch, vor dem man warnen muss: Es macht süchtig!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Für Milena
Dietmar Sous
ROXY
Roman
©2015 by : TRANSIT Buchverlag
Postfach 121111 | 10605 Berlin
www.transit-verlag.de
Umschlagabbildung © plainpicture | Doreen Enders
Umschlaggestaltung und Layout: Gudrun Fröba
eISBN 978-3-88747-319-8
Inhalt
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
Erster Teil
1
Nachdem Kroll und ich Rasenmäher, Fächerbesen und zwei leere Kanister aus Stahlblech, in denen Pflanzengift gewesen war, auf der Ladefläche des Hanomag verstaut hatten, fuhren wir zur Firma zurück. Ich zog die Arbeitshandschuhe aus, in meinem rechten Daumen steckte ein Dorn von einer Brombeerranke, den ich nicht rauskriegte.
Gartenbau und Landschaftsgestaltung hört sich nicht schlecht an, klingt vielleicht sogar ein bisschen künstlerisch. Versailles, der Englische Garten und so. Aber Kroll und ich kannten nur Unkrautbekämpfung, Rasen mähen und Heckenkosmetik.
Fahrtwind föhnte meine verschwitzten Haare, kühlte den Sonnenbrand auf den Armen und im Gesicht. Meine Cola hatte Badewassertemperatur. Ich schaltete das Radio ein. Wetter-Gequatsche. Der Mai 1973 war angeblich der heißeste im Rheinland seit 1959. Ich freute mich auf die Dusche und das Hörspiel am Freitagabend im Westdeutschen Rundfunk. Das Totenschiff von B. Traven.
Draußen Frauen, die kaum mehr als Sonnenbrille und Handtasche trugen. Kroll hupte, winkte, pfiff hinterher. Der neue Hit von Elton John wurde wegen der Siebzehn-Uhr-Nachrichten ausgeblendet. Bundeskanzler Willy Brandt hatte in Bonn versprochen, die Krise nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
Brandt gegenüber hatte ich ein schlechtes Gewissen. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr war ich zum ersten Mal wahlberechtigt gewesen. Ich wollte meine Stimme Brandt und seiner Partei geben. Allerdings hatte ich zu der Zeit was mit den Augen. Juckreiz, verschwommene Sicht. Als ich aus der Wahlkabine rauskam, war ich nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht oder nicht doch aus Versehen die CDU angekreuzt hatte. Oder die Nazis. Bohrende Zweifel seitdem.
Auf Sizilien war ein Vulkan aus dem Koma erwacht, meldete der WDR jetzt. Riesenärger in Nahost, und auch in Südamerika gab es Grenzstreitigkeiten. Das brachte mich auf Paraguay und seinen Krieg gegen die Allianz aus Brasilien, Argentinien und Uruguay. Von 1864 bis 1870 hatte sich das kleine Land nicht von den großen Nachbarn unterkriegen lassen, dabei die Hälfte seiner Bevölkerung verloren.
»Das Leben ist eben kein Zuckerschlecken«, sagte Kroll und schaltete auf einen Schlagersender um. Ich bin verliebt in die Liebe. Kroll summte und pfiff. Er parkte ein, zeigte auf eine Hauswand, an der ein Zigarettenautomat hing und reichte mir ein Zweimarkstück.
»Güldenring.«
»Du rauchst doch gar nicht.«
»Für meine Frau. Los, mach schon!«
»Hol dir die scheiß Glimmstängel doch selbst!«
Kroll schlug mit beiden Händen aufs Lenkrad und drohte, dem Chef zu sagen, dass ich faul und zu nichts zu gebrauchen sei. Dass sich ein Hundertjähriger auf Krücken dreimal schneller bewegte als ich.
Es wurde mal wieder brenzlig. Seit ich aus der Schule raus war, hatten sie mich schon dreimal gefeuert. Schrottplatz, Müllabfuhr, zuletzt bei Rheimabau. Das ist die Abkürzung für Rheinische Maschinenbau AG. Eugen Kessler, der Fabrikbesitzer, hatte bei meinem Rausschmiss höchstpersönlich Hand angelegt.
Jeden Freitagnachmittag gegen halb zwei spazierte er mit seinem fünfjährigen Sohn an der Hand durch die Werkshallen, umschwirrt von nervösen Ingenieuren in weißen Kitteln und panischen Meistern in Grau. Kessler sah den Arbeitern über die Schulter, er inspizierte, lobte und rügte. Der Schwarm nickte, lachte oder blickte ernst, wenn der Chef nickte, lachte oder ernst blickte, und zum Schluss gaben Kessler und sein Erbe einem der zweihundert Arbeiter die Hand. Der Senior unterhielt sich ein bisschen mit dem Glücklichen, der nicht selten vor Stolz errötete.
Ich fand das Theater um die wöchentliche Chefvisite zum Kotzen. An meinem letzten Tag in der Fabrik hatte ich wie immer freitags seit sechs Uhr früh gekehrt, geputzt und die Maschinen blank gerieben. Als Vater und Sohn samt Hofstaat einmarschierten, war meine Arbeit getan. Ich wollte nicht kehren, wo es nichts zu kehren gab, nicht aufgedreht wie die anderen wirbeln, nicht vor Eugen Kessler kriechen.
Lächelnd blieb er einen Meter vor mir stehen. So nah war er mir noch nie gekommen. Er war kleiner, als ich gedacht hatte. Dichte graue Haare, weißes Hemd mit kurzen Ärmeln. Sein Sohn: blass, schüchtern.
»Schau mal, Robert! Weißt du, was das hier ist?«
Der Junge schüttelte den Kopf und sah auf seine Schuhe.
Ingenieure und Meister gaben mir hektisch Zeichen, meinen Arsch zu bewegen. Ich wollte mir aber keinen Besen schnappen oder ein Werkstück, es von hier nach da schleppen, dann von da nach dort und zurück von dort nach da und hier.
»Das hier, Robert, nennt man ein Arbeiterdenkmal«, sagte Kessler und zeigte auf mich. »Ein Arbeiterdenkmal will Geld ohne Gegenleistung. Diebstahl nenne ich das. Du doch auch, Robert?«
Der Junge schwieg.
Übereifrige, wahrscheinlich sinnlose Hammerschläge auf Metall. Bohr-, Schleif- und Fräsgeräusche. Da war eine verdammte Hitze in der Halle, und es roch nach Metallspänen und ranziger Kühlflüssigkeit.
»Lauter, Robert, was hast du gesagt? Diebstahl, nicht wahr?«
Der Junge nickte mit gesenktem Kopf. Kessler nahm sich eine Zigarette aus einem silbernen Etui. Beflissen gab ihm einer der Ingenieure Feuer. Dann wischte der Boss mich mit einer knappen Handbewegung weg.
Ich rauchte nicht, weil man davon Mundgeruch und gelbe Zähne kriegt. Ernte 23 kannte ich trotzdem. Leuchtendes Orange und die Zahlen 2 und 3. Die Marke kam 1924 auf den deutschen Markt. Und weil Tabak aus dem Jahr 1923 verwendet worden war, Orienttabak aus Nordgriechenland, hat die Firma Reemtsma ihre neue Sorte Ernte 23 genannt.
Peter Stuyvesant war auch leicht zu erkennen. Weiße Packung mit einem dicken roten Streifen. Der Duft der großen weiten Welt. Bevor meine Mutter angefangen hatte, jeden Pfennig für einen Mercedes-Sportwagen zu sparen, hatte sie Stuyvesant geraucht. Weil in unserem Viertel immer wieder Automaten aufgebrochen und sogar aus der Hauswand gerissen worden waren, gab es, wenn die Geschäfte geschlossen hatten, Zigaretten nur noch bei den Merzenichs. Die hatten einen Automaten in ihrem Schlafzimmer hängen.
Wie alle anderen Kunden musste ich dreimal kurz und einmal lang schellen. Nach einiger Zeit wurde die mit einer dicken Kette gesicherte Haustür einen Spalt weit geöffnet, durch den man das Geld reichte und die gewünschte Marke rief. Dann ging man ums Haus herum und erhielt durch das Schlafzimmerfenster, aus dem manchmal Plumeaus und Kopfkissen zum Lüften heraushingen, sein Päckchen Zigaretten.
Das war lange her, aber jetzt wünschte ich, es gäbe den Service der misstrauischen Merzenichs noch, denn zu Güldenring fiel mir nichts ein. Ich kannte keinen, bei dem ich die Marke schon mal gesehen hatte. Ich konnte mich an keine Fernsehreklame für Güldenring erinnern, an keine Packung in Großaufnahme. Gül-denring, zehn Buchstaben. Kroll hupte, wedelte ungeduldig mit den Händen, rief irgendwas Blödes. Glücksspiel: Ich warf das Zweimarkstück ein, biss mir auf die Unterlippe und zog.
»Milde Sorte?«
»Die sollen sehr gut sein. Und haben auch zehn Buchstaben, genau wie Güldenring.«
»Hast du wieder deine Augenentzündung, Blinder?«
Ich beschäftigte mich mit dem Dorn in meinem Daumen. Kroll hatte kein Kleingeld mehr für einen weiteren Versuch, und ich behauptete, auch keins zu haben. Mein Kollege warf seinen schwarzen Hut aus falschem Leder auf den Boden der Fahrerkabine und starrte mich wütend an. Das Radio sang Schön ist es, auf der Welt zu sein. Kroll war anscheinend nicht dieser Meinung, jedenfalls summte er nicht mit.
Endlich fuhr er weiter, hörte aber nicht auf zu fluchen und mir böse Blicke zuzuwerfen. Das ging so lange, bis ihm ein VW die Vorfahrt nahm. Ich konnte aufatmen: Kroll hatte einen neuen Feind.
»Käskopp! Scheiß Holländer!«
»Vielleicht ist der gar kein Holländer«, sagte ich. »Nicht alle Niederländer sind Holländer. Nur die im Norden, also im Großraum Amsterdam und in der Provinz Zeeland…«
»Du machst, dass ich Migräne kriege!«
Kroll bremste abrupt, sprang aus dem Wagen. Auf dem Gehweg lag ein großer Haufen Sperrmüll. Ich sah, wie Kroll mit einer Sanftheit, die ich ihm nicht zugetraut hätte, über eine Holztruhe mit Schnitzereien strich, sie geradezu streichelte, wie er dann langsam den Deckel anhob und andächtig das Innere besichtigte.
Nachdem wir das rustikale Eichending, das schwer wie ein Sarg plus Inhalt war, aufgeladen hatten, unter Krolls ständigen Appellen, vorsichtig zu sein, bloß kein Krätzerchen, arbeitete er sich weiter durch den Müllberg. Da fing ich auch an zu stöbern. Vielleicht fand ich wie im Film einen prall gefüllten Geldkoffer, einen Picasso. Unter Matratzen mit ekligen Flecken stieß ich auf zwei dicke Bücher, richtige Schinken, außen rot und mit silbernen Buchstaben. Kroll hatte auch noch einen Treffer gelandet. Wie ein Oscar-Gewinner hielt er eine ungefähr dreißig Zentimeter große Figur in die Höhe, eine nackte Afrikanerin mit goldenen Lippen und riesigen Brüsten.
»Für meinen Partykeller.«
Ich versuchte, mir Kroll in Freizeitkleidung vorzustellen, als Gastgeber, flirtender Tänzer. Das klappte nicht. Ich sah ihn immer nur in seiner dunkelgrünen Arbeitsuniform, verkniffen und mit Hut.
»Kannst du also doch lesen«, sagte er und zeigte auf die beiden Bücher unter meinem Arm. Seine Laune war jetzt überragend gut, denn er ließ mich ans Steuer. Er wusste, dass er mir damit eine Freude machte. Allerdings wusste er nicht, dass ich keinen Führerschein hatte.
Am späten Samstagmorgen ging ich Richtung Innenstadt. Enge Jeans, weißes, tailliertes Hemd, weinrote Ledersandalen mit Zehensteg. »Aus Marokko«, hatte die Verkäuferin gesagt.
Marokko wurde 1956 unabhängig von Spanien und Frankreich. Hauptstadt: Rabat. Regierungsform: Monarchie.
Trotz der blöden Maximode wimmelte es wieder vor Miniröcken, Hot Pants und knappen Oberteilen, hinter denen sich Brustwarzen abzeichneten. Mein Ständer tat weh in der engen Hose.
Ungefähr in der Mitte der Fußgängerzone hatten sie einen Hügel aufgeschüttet, mit Rasen und Laubbäumen bepflanzt, die Schatten für vier bunte Bänke spendeten. Weil die Leute dort auf Wunsch des Bürgermeisters ins Gespräch kommen sollten, hatte jemand das künstliche Ding Monte Quasselino genannt. Der Name hatte sich herumgesprochen und war kleben geblieben.
Man saß da wie auf einem Präsentierteller. Mir war das recht und den Nutten, die da abends Streife gingen, bestimmt auch.
Als ich oben ankam, hielten alle den Mund. Drei lasen Zeitung, einer teilte sich sein Wurstbrötchen mit den Tauben. Eine Dunkelhaarige, ungefähr so alt wie ich, schaute, ein Buch auf den gebräunten Oberschenkeln, in den wolkenlosen Himmel. Italienisches Gesicht, viel dichtes Haar, dunkle Augen. Eine gerade Nase mit ein paar Sommersprossen. Spektakuläre, hellrot gefärbte Lippen.
Ich setzte mich ans andere Ende der Bank, streifte Sandalen und Sonnenbrille mit größtmöglicher Lässigkeit ab, legte eins der beiden Bücher neben mich, schlug das andere auf. Ich ließ mir viel Zeit für jede Seite. Einer der Zeitungsleser beobachtete mich verstohlen. Er hätte wohl gern mit mir getauscht: seine billige Zeitung gegen mein zwei Kilo schweres Buch. Zum ersten Mal dachte ich mit Wohlwollen an Kroll. Schließlich war er es gewesen, der den Sperrmüll entdeckt hatte.
»Was machst du denn da?«, rief eine vom Fuß des Monte zu mir hoch. Karin oder Katrin. Letzten Samstag hatten wir in der Disko ein bisschen rumgefummelt und mit den Zungen gefuchtelt, während was von Gary Glitter lief. Irgendwann war ihr besoffener Freund vom Klo gekommen. Da war Schluss gewesen mit den Doktorspielchen, Karin oder Katrin hatte sich schnell in eine auf Alkoholwracks spezialisierte Krankenschwester verwandelt.
»Was ich hier mache?«, rief ich lauter als nötig von oben herab. »Lesen!«
»Soll schlecht für die Augen sein.«
»Aber gut für die Birne.«
Die Freundin des Trinkers verzog sich mit ihrem himmelblauen Röckchen und den weißen Sommerstiefeletten. Einige auf dem Monte schauten mich vorwurfsvoll an, dabei hatte ich doch nur gequasselt.
Gegenüber die Boutique, in der ich neulich mein weißes Hemd gekauft hatte. Aus dem Plattenladen daneben wehte ein Song von David Bowie herüber. Eine Demo, an der mehr Polizisten als Demonstranten teilnahmen, schleppte sich vorbei.
»Sofortige Anerkennung der DDR!«, schrie eine Frau in ein Megaphon, der Rest betete die Parole nach. Zwei Spruchbänder wurden hochgehalten, drei Fahnen geschwenkt. Ich gab einer Taube, die vor meinen nackten Füßen herumpickte, einen leichten Tritt.
»Spannend, dein Buch?«, fragte die Dunkelhaarige vom anderen Ende der Bank. Sie hatte eine warme, leicht rauchige Radiostimme.
»Geht so.«
»Worum geht’s denn?«
Ich überlegte.
»Politik und so«, sagte ich. »Und Geschichte.«
»Dann kannst du mir bestimmt was zur Kriegsschuldfrage sagen.«
Sie rückte näher.
»Erster Weltkrieg. Am Montag schreib ich ’ne Klausur über den langweiligen Mist.«
»Von wegen langweilig. Total spannend!«
»Aber nur, wenn Alain Delon mein Geschichtslehrer wäre.«
Ich holte, vielleicht etwas zu dramatisch, Luft. Franz Conrad von Hötzendorf, Chef des österreichischen Militärs, und Außenminister Leopold Graf Berchtold waren für mich auf Wiener Seite die größten Schufte. In Berlin setzte ich Großmaul Wilhelm II., Helmuth von Moltke, den nervenschwachen Sandkastenstrategen an der Spitze des Großen Generalstabs, und als Dritten im Bunde der trüben Tassen Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg in die erste Reihe der Anklagebank. Nicht unerwähnt ließ ich, dass Monsieur Poincaré und der Zar von Russland alles andere als Anwärter auf den Friedensnobelpreis waren, den Krieg aber nicht – wie die Österreicher und Moltke – um jeden Preis wollten. Im Rahmen dieser Überlegungen zerpflückte ich zusätzlich den total bescheuerten Schlieffen-Plan, der unter anderem den deutschen Überfall auf Belgien vorsah, dessen Neutralität vom Britischen Weltreich garantiert wurde.
Die Dunkelhaarige lächelte. Überrascht, ungläubig, vielleicht sogar bewundernd. Das machte mir Mut, sie nach ihrem Namen zu fragen, aber sie kam mir zuvor.
»Du hältst dein Buch falsch herum.«
Ich war nicht der Typ, der schnell errötet, aber nun passierte es. Feuerwehrrot, sonnenbrandrot, Erkennt-die-DDR-an-fahnenrot, das spürte ich, dazu brauchte ich keinen Spiegel. Ich drehte das Buch ungeschickt um, dabei wäre es mir fast aus den Händen gefallen. Meine Banknachbarin half mir reaktionsschnell beim Auffangen. Unsere Finger berührten sich dabei kurz. Ich schaffte es nicht, in die entsetzliche Stille hinein was von einer Augenentzündung zu faseln. Alle auf dem Monte und in der Fußgängerzone starrten mich an. Es kam mir jedenfalls so vor. Ich tastete nach meiner Sonnenbrille, fand sie nicht. Meine Fingerspitzen versuchten, sich in das Holz der Sitzbank zu krallen. Vor der Boutique wurden jetzt bunte Luftballons verteilt.
»Und Spanisch kannst du auch?«
»Wie – Spanisch?«, antwortete ich schlagfertig wie ein Ziegelstein.
»Das hier ist doch Spanisch!«, sagte die Gymnasiastin und deutete mit spitzem, sexy rot lackiertem Zeigefinger auf die Titelseite meines Buchs. »Miguel de Cervantes. Novelas ejemplares. Findest du nicht auch, dass sich das spanisch anhört?«
Der Wunsch, sie nach ihrem Namen zu fragen, war über alle Berge, zwanzigtausend Meilen unter dem Meer. Und wenn die Sonne so weitermachte, würde sie spätestens übermorgen restlos verglüht sein. Mein Kopf brauchte dazu maximal noch fünf Sekunden.
2
Nach dem Wochenende war Kroll nicht wiederzuerkennen. Etwas war in ihn gefahren, er war ein Anderer geworden. Die rechte Hand des Chefs, wie er sich gern nannte, war lädiert, griff ins Leere, lahmte. Kroll, das Vorbild, der Hundertzehnprozentige, erschien zu spät zur Arbeit, viel zu spät. Die anderen Gärtner meinten, Krolls Alte sei abgehauen, deshalb der Schlendrian. Kroll hatte oft damit angegeben, sich nicht mal ein Ei kochen zu können. Weiberkram. Vielleicht, mutmaßten die Kollegen, konnte er sich auch den Wecker nicht stellen, weil seine durchgebrannte Frau das immer für ihn getan hatte.
Ich musste die Wartezeit überbrücken, indem ich am Montag den Mercedes des Chefs putzte, am Dienstag den Karmann Ghia der Chefin und am Mittwoch die Ente der Tochter. Ich führte den Hund aus, saugte Staub im Umkleideraum und flickte einen Fahrradreifen. Wenn Kroll dann endlich irgendwann eintraf, machte er ein Gesicht, als sei er jahrelang Kohlenschaufler auf B. Travens Totenschiff gewesen. Müde, apathisch, neben der Spur. Er regte sich nicht mehr auf, wenn ich beim Rasenmähen mal einen Gang zurückschaltete.
Frühstückspause war von neun bis Viertel nach neun.
»Wie spät ist es?«, fragte ich unruhig.
»Scheißegal«, antwortete Kroll und starrte in seinen leeren Kaffeebecher. Es war bestimmt schon halb zehn. Ich riss mich nicht darum, hinter dem Rasenmäher herzulaufen, hatte aber Angst, schon wieder entlassen zu werden. Ich war noch in der Probezeit.
Wir saßen auf einer Bank vor dem Krankenhaus, in dem ich geboren worden war und mit sechs fast gestorben wäre. Gelber Ziegelsteinbau, sieben Stockwerke.
Patienten in Bademänteln spazierten in Begleitung eines rollbaren Infusionsständers durchs Gelände, zogen gierig an einer Zigarette. Krolls Gleichgültigkeit verschwand, wenn eine hübsche Krankenschwester an uns vorbeiging.
Es roch nach frisch gemähtem Gras. Ein Rettungswagen machte Radau. Auf der Bank nebenan fütterte eine alte Frau die Spatzen und redete dabei mit sich selbst. Am Himmel ein Flugzeug, das ein langes Band hinter sich herzog, darauf Buchstaben und Zahlen.
Es war zehn Uhr, wenn nicht später, als der Chef auftauchte, eine Bohnenstange mit ein paar quer über die Glatze gekämmten Haaren. Von weitem rief er Krolls Namen wie ein Hundehalter. Kroll erhob sich schwerfällig, kratzte sich am Hals und ging los, als hätte man ihm Eisenkugeln an die Füße geschmiedet.
»Ich bin die Ruhe selbst!«, schrie ihm der Chef entgegen.
»Und ich erst!«, antwortete Kroll in gleicher Lautstärke.
Am nächsten Tag war er pünktlich wie immer. Während sich alle anderen noch umzogen, Fußballtabellen bequatschten, rauchten oder einfach nur vor sich hin gähnten, hatte Kroll auf dem Firmenhof bereits den Unimog mit Blausteinen und Schotter beladen und einen Kleinbagger auf den Anhänger gelenkt, dabei Nettigkeiten mit dem Chef ausgetauscht. Als wir losfuhren, verkündete Kroll euphorisch, dass nun Schluss sei mit dem verdammten Unkraut, dem vermaledeiten Gras. Dass wir auf einem Anwesen eine große Trockenmauer bauen würden, einen Springbrunnen und ein toskanisches Kräuterbeet. Gartenbau und Landschaftsgestaltung vom Allerfeinsten!
Der Schauspieler Tony Curtis, wusste meine Mutter, eine Jet-Set-Kennerin ersten Ranges, besaß ein Haus mit fünf Badezimmern. Hätte mich nicht gewundert, wenn es in dieser weißen Villa am Stadtwald, vor der Kroll nach zwanzig Minuten Fahrt parkte, sechs gab.
Das Dienstpersonal hatte wohl seinen freien Tag. Die Hausherrin empfing uns persönlich. Anfang vierzig, südländischer Typ, unübersehbarer Busen. Aber keine Stöckelschuhe, sondern Gummistiefel, und statt Samt- und-Seidekleid ein schmutziges T-Shirt, löchrige Jeans. Die Frau schwitzte. Sie hatte bereits Eisenpflöcke gesetzt und eine Schnur gespannt.
»Aushub für das Fundament dreißig Zentimeter tief?«, fragte sie.
»Vierunddreißig Komma siebenzwo«, antwortete Kroll. »Hab ich so gelernt in der Baumschule.«
Er lachte, die Frau lächelte ansatzweise. Ich verkehrte zwar nicht in Sechs-Badezimmer-Kreisen, aber irgendwie kam sie mir bekannt vor. Vögel zwitscherten gutgelaunt, Laubbäume spreizten sich wie Sonnenschirme.
»Sie füllen mit Schotter auf, nehme ich an?«, sagte die Frau und kämmte ihre halblangen Haare mit den Fingern.
»Nein, mit Platin. Im Notfall auch mit Gold. Aber nur im Notfall, Frau Aston.«
Jetzt lachte sie, und Kroll drückte keck sein Hütchen in die Stirn. Er war schon wieder ein Anderer. Wie er Frau Aston gesagt hatte, mit der schmachtenden Reibeisenstimme eines von Sexual-hormonen getriebenen, der Lebenslust verfallenen Chansonniers. Kroll musste im Sperrmüll auch ein kompetentes Handbuch fürs erfolgreiche Flirten gefunden haben.
»Ach, übrigens«, sagte Frau Aston. »Haben Sie zufällig was gegen Brennnesseln dabei? Wir haben hier nämlich so eine Plage.«
»Hab ich«, antwortete Kroll, zog seine Jacke aus und brachte seine Oberarmmuskulatur zur Geltung. »Hab ich.«
Die Frau hob die Augenbrauen, änderte dann aber plötzlich ihre Blickrichtung. »Sonja! Schon wieder verschlafen?«
»Freitags erste Stunde frei. Weißt du doch, Mama!«, rief das Girl vom Monte genervt.
Ich wünschte mir ein UFO, das mich aufsaugte und in eine andere Galaxie brachte. Oder wenigstens eine Pille, die mich unsichtbar machte.
Es war die Polizei, die mir aus der Patsche half. Sie parkte unversehens mitten auf der Baustelle. Zwei Uniformierte stiegen aus, strichen nahezu synchron ihre Uniform glatt, bedeckten ihren Kopf. Ob ich Paul Weber sei?
Ich nickte, und da sagte der Ältere der beiden: »Mitkommen! Zwangsvorführung!«
Vor Schreck kriegte ich kein Wort raus. Die Beamten nahmen mich in fürsorgliche Begleitung.
»Übrigens danke«, rief Sonja mir hinterher. »Ich hab eine Zwei in der Klausur!«
Kroll stellte sich dem Polizeiwagen in den Weg und rief: »He, das muss’n verdammter Irrtum sein!«
Die Polizisten drohten mit Verhaftung wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Da wich Kroll langsam zurück.
Flatternde Angst. Mein schlechtes Gewissen verschwieg mir, weshalb es da war. Die Todesstrafe war 1949 in der Bundesrepublik Deutschland abgeschafft worden. Ganz so schlimm würde es also nicht kommen. Das beruhigte mich nicht. Das Wort Zwangsvorführung