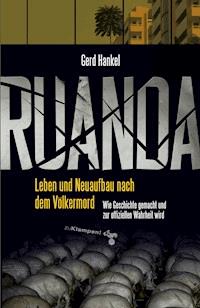Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: zu Klampen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vor 25 Jahren, von April bis Juli 1994, fielen in Ruanda hunderttausende Menschen einem Völkermord zum Opfer, während die Welt zusah. Seither ist das Land, das für viele vormals nur ein Name auf der ostafrikanischen Landkarte gewesen war, zum Inbegriff für einen landesweiten Massenmord geworden. Aber es steht auch für einen staatlichen Wiederaufbau, der Respekt abnötigt. Doch so beeindruckend der Fortschritt auch ist, die Vergangenheit verlangt nach Antworten, die sich nicht in Verweisen auf die wirtschaftliche Entwicklung, die verbesserte medizinische Versorgung oder die erfolgreiche Armutsbekämpfung erschöpfen. Opfer fordern weiterhin die Anerkennung des ihnen zugefügten Unrechts, eine immer noch gespaltene Gesellschaft wartet auf Erklärungen, die Sprachlosigkeit und Ausgrenzung überwinden helfen. Gerd Hankel verfolgt seit vielen Jahren die Entwicklung Ruandas. Er beschreibt, wie das Land wahrgenommen werden will – und wie es ist. Das verkürzte und aktualisierte Lesebuch zu Hankels 2016 erschienener Studie »Ruanda. Leben und Neuaufbau nach dem Völkermord. Wie Geschichte gemacht und zur offiziellen Wahrheit wird«.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerd Hankel
Ruanda 1994 bis heute
Vom Umgang mit einem Völkermord
© 2019 zu Klampen Verlag ∙ Röse 21 ∙ 31832 Springe ∙ zuklampen.de
Umschlaggestaltung: Hildendesign unter Verwendung einer Fotografie
von Gerd Hankel ∙ München ∙ hildendesign.de
Satz: Germano Wallmann ∙ Gronau ∙ geisterwort.de
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019
ISBN 978-3-86674-728-9
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.dnb.de› abrufbar.
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
1.Einleitung
2.Was 1994 geschah
3.Die Vorgeschichte
4.Nach dem Völkermord:Versuche der justiziellen Aufarbeitung
5.Wie Staat und Wirtschaft auf ein neues Fundament gestellt werden sollten
6.Der Kongo als Objekt der Begierde
7.Verlauf und Abschluss der Aufarbeitung von Völkermordverbrechen. Die Geschichte einer verpassten Chance
8.Über den Versuch, eine Deutungsautorität herzustellen
9.Wie viel Unrecht verträgt der Fortschritt?
10.Schlussbemerkungen
Endnoten
Literaturhinweise
Über den Autor
1. Einleitung
Zwischen April und Juli 1994 fielen in Ruanda Hunderttausende Menschen einem Völkermord zum Opfer. Die Täter stammten aus der Bevölkerungsgruppe der Hutu, der mit über 85 Prozent Gesamtanteil mit Abstand größten in Ruanda. Die Opfer waren vor allem Tutsi, eine Bevölkerungsgruppe, der gut zwölf Prozent aller 7,5 Millionen Ruanderinnen und Ruander angehörten. Sie wurden umgebracht, weil sie Tutsi waren. Aber auch sehr viele Hutu fielen dem Morden zum Opfer, denn längst nicht alle Hutu waren mit dem Massenmord einverstanden. In den Augen der Täter störten sie die Durchführung des Mordplans und mussten daher in möglichst großer Zahl beseitigt werden.
Wer heute in die ruandische Hauptstadt Kigali kommt, mag kaum glauben, an einem Ort zu sein, der einmal das bedrückende Zentrum eines entvölkerten, zerstörten Landes war. Hochhäuser, Einkaufszentren, Hotels und, auf dem Weg vom Flughafen in das Stadtzentrum, ein imposantes Kongresszentrum machen aus der Millionenstadt Kigali nunmehr den Mittelpunkt eines Landes, das sich entschlossen der Zukunft zugewandt hat.
Die Vergangenheit ist gleichwohl nicht vergessen, wie sollte sie auch. Zahlreiche Gedenkstätten erinnern an den Völkermord, während der jährlichen Trauerwoche im April steht das öffentliche Leben still, eine ganze Reihe von Organisationen widmet sich dem Thema Versöhnung und nationale Einheit. Bei den Präsidentschaftswahlen 2017 hat der alte und neue Präsident Paul Kagame, der sich als Garant dieser Ziele versteht, fast 99 Prozent der Stimmen erhalten.
Es hat den Anschein, als habe sich Ruanda aus den dunklen Tiefen der Vergangenheit zu einem Leuchtturm politischer Stabilität und wachsender wirtschaftlicher Prosperität entwickelt, als herrsche ein innergesellschaftlicher Frieden. Aus einer Region, aus der es sonst nur Schlechtes zu berichten gibt, sind endlich gute Nachrichten zu vernehmen. Dass der Anschein trügen könnte, kommt einem nicht in den Sinn. Und doch ist es so. Die ruandische Erfolgsgeschichte hat Schattenseiten. Die Schatten sind so groß, dass sie unweigerlich die Frage nach dem Preis, der für den augenscheinlichen Erfolg zu bezahlen ist, aufwerfen. Dürfen Menschen zu bloßen Figuren auf dem Schachbrett eines Regimes gemacht werden, das rücksichtslos die Durchsetzung seiner Zukunftsvision betreibt? Kann das neue Ruanda auf einem Narrativ errichtet werden, das tabubehaftet ist und von der Bevölkerungsmehrheit nicht nur nicht akzeptiert, sondern zum Teil in ohnmächtiger Wut abgelehnt wird? Kurzum, wie viel Unrecht verträgt der Fortschritt?
Die Antworten, die ich auf diese Fragen geben werde, sowie meine Beschreibung und Analyse von Vorgeschichte, Verlauf und Folge des Völkermords gehen zurück auf mein Ruandabuch, das im Herbst 2016 erschienen ist (vgl. die Literaturangaben am Ende dieses Buchs). Die Quellen, aus denen ich zitiere sowie solche, die ich für die Aktualisierung herangezogen habe, sind gesondert aufgeführt. Zum Schutz einzelner Personen wurden deren Namen anonymisiert.
2. Was 1994 geschah
Es muss Mitte der 1980er Jahre gewesen sein, als ich zum ersten Mal mit dem kleinen Land Ruanda, mir bis dahin gänzlich unbekannt, in Kontakt kam. Zu dieser Zeit war ich Lehrer für Französisch und Spanisch in einem Schulzentrum in Nordrhein-Westfalen. Außerdem war ich in einem Programm tätig, das sich »Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte aus der Dritten Welt« nannte und maßgeblich von der Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung (DSE) organisiert und betreut wurde. Meine Aufgabe war es, die Programmteilnehmerinnen und -teilnehmer aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die in der Regel drei Jahre in Deutschland bleiben sollten, während ihrer zehnmonatigen Eingewöhnungsphase in das deutsche Leben und die deutsche Kultur zu betreuen. In der Schule, in der ich unterrichtete, erhielten sie Deutschunterricht, hörten Vorträge zur Landeskunde und nahmen an Exkursionen zu Orten teil, die als Ausweis deutscher – westdeutscher – Spitzenleistungen in Wissenschaft, Industrie und Handel galten. Nach den zehn Monaten gingen die Stipendiaten dann an ihre jeweiligen Weiterbildungsstätten.
Eines Tages – es war, wenn ich mich recht erinnere, im Frühjahr 1986 – erhielt ich einen Anruf von einem Mitarbeiter der DSE. Ich solle sofort zur Schule und den angrenzenden Wohngebäuden fahren (dort waren die Stipendiaten untergebracht) und zwei Kursteilnehmer auffordern, unverzüglich und unter meiner Aufsicht die Koffer zu packen. Ihr Fortbildungsprogramm sei beendet, da beide, wie eine medizinische Untersuchung ergeben habe, ernsthaft erkrankt seien und die wahrscheinlich langwierige Behandlung dieser Krankheit mit dem engen Zeitplan der Fortbildung nicht vereinbar sei. Beide müssten innerhalb von 24 Stunden Deutschland verlassen, Flugtickets lägen am Flughafen bereit.
Ich fuhr zur Schule und begab mich zu den Zimmern der Stipendiaten. Ich kannte beide gut. Sie kamen aus Ruanda, waren Sportlehrer von Beruf und natürlich glücklich über die Perspektive eines längeren Aufenthalts in Deutschland, der auch noch mit ca. 1100 DM im Monat bezahlt wurde – ein Mehrfaches von dem, was ein Durchschnittsruander zu jener Zeit pro Jahr verdiente.
Jetzt mussten sie sich abreisefertig machen, abrupt konfrontiert mit den Entscheidungen einer deutschen Bürokratie, die sie nicht verstanden – und ich auch nicht. Auf ihre drängenden, verzweifelten Fragen, was denn das für eine Krankheit sei, an der sie angeblich litten, ob die Krankheit etwa lebensgefährlich sei und was sie ihren Familien in Ruanda sagen sollten, die so große Hoffnung in sie gesetzt hätten, wusste ich nichts zu antworten, bis auf die Wiederholung meines Auftrags, nun auf Französisch und so oft, bis sie resigniert schwiegen.
Wir fuhren zum Flughafen, die Flugtickets lagen am Schalter bereit, der Abschied vor der Sicherheitsschleuse war kurz, immer noch mögliche Komplikationen wurden, so redete ich mir später ein, durch meine große Beschämung verhindert.
Insgesamt fuhr ich fünf Mal mit Stipendiaten zum Flughafen. Nach dem zweiten oder dritten Mal war mir auch klar, um welche schwere Krankheit es sich handelte, nämlich um Aids, oder genauer, darum, dass die Stipendiaten HIV positiv waren und man in Deutschland nicht wusste, wie man mit diesem Virus umgehen sollte, ja noch nicht einmal verlässlich sagen konnte, wie er übertragen wird (was auf meine Beauftragung ein eigenartiges Licht warf). Ich weiß allerdings, dass bei den letzten zwei Malen ein Amtsarzt eingeschaltet wurde, der den Stipendiaten die Art ihrer Erkrankung eröffnete, ich musste dolmetschen, fahren und, auf dem Weg zum Flughafen und im dortigen Wartebereich, die ärztliche Erklärung wieder und wieder wiederholen. Und ich weiß auch, dass der letzte Stipendiat, dessen Aufenthalt in Deutschland schon nach ein paar Wochen beendet war, wieder ein Ruander war. Auf dem Flughafen bat er mich noch, ihm für seinen Arbeitgeber schriftlich zu bestätigen, dass der Abbruch seines Programms nichts mit überraschend festgestellten beruflichen Defiziten (ich glaube, er war auch Lehrer) oder mangelnder charakterlicher Eignung zu tun hatte. Ich kam seiner Bitte nach, gewiss in weiter Überschreitung meiner Kompetenzen. Als ich dann beim Schreiben der Bescheinigung nicht mehr wusste, ob man das französische »professionnel« (beruflich) mit einem oder zwei »n« schreibt, gab er mir sein Wörterbuch. Ich könne es auch behalten, er brauche es jetzt ja nicht mehr, meinte er noch.
Der Ruander, Elie Kamuhanda war sein Name, hat den Völkermord nicht überlebt. Ich erfuhr später, dass er, ein Tutsi, schon in den ersten Tagen des Völkermords in Kigali umgebracht worden war, einer von vielen Tausend, die allein in der Hauptstadt Opfer des kollektiven Gewaltausbruchs geworden waren, der am Abend des 6. April 1994 begonnen hatte.
Es gibt wohl keine Familie in Ruanda, die nicht vom Völkermord betroffen war. Ermordete, Überlebende, Täter, Flüchtlinge – es ist unmöglich, nicht auf Menschen zu stoßen, zu deren unmittelbarer Umgebung keine Täter oder Opfer gehören. Und unmöglich scheint es auch, sich nicht Fragen zu stellen, Fragen wie: Ist das ein Hutu? Ist das ein Tutsi? Stammt die Narbe am Kopf von einem Machetenhieb? Wo war diese Frau wohl zur Zeit des Völkermords? Mir jedenfalls waren diese Fragen ein ständiger Begleiter, als ich im Frühjahr 2002 das erste Mal nach dem Völkermord in Ruanda war.
Zozo, der Kleine, wie er wegen seiner Körpergröße in der Landessprache genannt wird, und Mann für alles im Hotel Mille Collines in der ruandischen Hauptstadt Kigali, besorgt mir ein Auto mit Fahrer für den zweiten Tag nach meiner Ankunft. Wir fahren nach Ntarama und Nyamata, zwei Gedenkstätten des Völkermords, die von Touristen gewöhnlich aufgesucht würden, wie mir Zozo versicherte. Beide liegen etwa eine Fahrstunde von Kigali entfernt in südlicher Richtung, und beide lassen ein beklemmend-anschauliches Bild entstehen von dem, was sich hinter dem Wort »Völkermord« verbirgt. Übertroffen auf der Skala des Schreckens werden sie nur noch durch das, was ich wenige Tage später in der Gedenkstätte Murambi, knapp hundert Kilometer weiter westlich, sehen und, vielleicht noch schlimmer, riechen sollte.
Etwa 5000 Menschen wurden laut Informationstafel auf dem Gelände der Kirche von Ntarama und in der Kirche selbst getötet, 45.000 sollen es an und in der Kirche von Nyamata gewesen sein. Die vermeintlich sicheren Refugien waren zur tödlichen Falle geworden, dort wie an vielen anderen Orten in Ruanda. In Ntarama sieht das Kircheninnere aus, als habe das Morden erst vor kurzem stattgefunden. Der Boden im Gang und zwischen den Bänken ist bedeckt von einer makabren Mischung aus menschlichen Knochen, Kleidungsresten, Töpfen und Tellern und halbzerrissenen Gebetbüchern oder religiösen Heften. Handtaschen und aufgerissene Koffer, aus denen die Habseligkeiten der in Panik geflüchteten Tutsi quellen, liegen umher. Auch ein populärwissenschaftliches Lexikon gehört offensichtlich zu den Schätzen, die gerettet werden sollten, ebenso wie ein Buch, das just an der Stelle aufgeschlagen ist, wo ein weißes und ein schwarzes Mädchen schwesterliche Eintracht demonstrieren. Jetzt wirkt es nur noch wie ein naiver und völlig deplazierter Appell zur Überwindung rassischer Vorbehalte. Gebeine und Totenschädel, die an den Wänden und in den Ecken aufgehäuft wurden, warten darauf, in Säcke gefüllt und dann, nach einer Zwischenlagerung in einem Nebenraum, in dem bereits etliche Säcke stehen, zur Reinigung gebracht zu werden. Zuständig dafür sind eine Frau und ein Mann, beide, wie sie sagen, Überlebende des Massakers vom 15. April 1994. Schon seit Jahren arbeiten sie auf dem Kirchengelände, am Anfang, um Beweise zu sichern, jetzt, um die Erinnerung wach zu halten. Sie sitzen vor zwei mit einer Lauge gefüllten Eimern, in die sie die Schädel und Knochen eintauchen, um sie danach mit einer Bürste zu bearbeiten. Eintauchen, abschrubben, eintauchen, abschrubben, der Ablauf sitzt, als handelte es sich um Karotten. Die gereinigten Schädel und Knochen werden in einer Art Schuppen aus Holz mit vielen, die Luftzirkulation sichernden Spalten in den Wänden gelagert oder, genauer gesagt, ausgestellt. Auf zwei zirka fünfzehn Meter langen und bis zu zwei Meter breiten Tischen sind zunächst die Totenschädel aneinandergereiht, nebeneinander und hintereinander. Dann folgen die Knochen. Oberschenkelknochen sind es zumeist. Dicht an dicht liegen sie, manchmal auch mehrere übereinander. Ein Kondolenzbuch lädt dazu ein, Wünsche, Gedanken, Hoffnungen zu äußern. Die Betroffenheit der Besucher ist mit den Händen zu greifen. Immer wieder der Appell »never again«. »Manchmal haben wir den Eindruck«, sagt die Frau und der Mann nickt zustimmend, »als kämen die Menschen zu uns aus einer anderen Welt.«
Die Kirche in Nyamata ist um einiges größer als die Kirche von Ntarama. Auf den ersten Blick sieht sie längst nicht so beschädigt aus wie die Kirche von Ntarama, wo Löcher in die Wände geschlagen wurden, damit die Mörder eindringen konnten. Im Innern jedoch sind die Spuren der Mordaktion unübersehbar. Rund um den Altar ist der Betonboden dunkel gefärbt, auch das Altartuch hat eine rostbraune Färbung. Ein wahrer Blutsee muss in der Kirche gestanden haben. Eine Ahnung von dem, was hier geschehen ist, geben auch die vielen kleinen Lichtsäulen in der Kirche. Sie stammen von dem Sonnenlicht, das durch Löcher strahlt, die von Handgranatensplittern ins Wellblechdach geschlagen wurden. Um das Töten zu beschleunigen, hatten die Täter Handgranaten in die Menge geworfen. Ausgeklügeltere Methoden des Tötens zeigen Instrumente, die in einem Nebenraum ausgestellt sind. Angespitzte Stöcke, die in Körperöffnungen gestoßen wurden, zählen da augenscheinlich noch zu den eher herkömmlichen Varianten.
Ansonsten ist bei der Präsentation des Verbrechens der Unterschied zwischen 5000 Toten und 50.000 Toten nicht groß. Schädel und Knochen sind zu Hunderten und Tausenden ausgestellt. Einschnitte in den Knochen, Risse und Löcher in den Schädeldecken geben eine Ahnung davon, wie der dazugehörende Mensch gestorben sein muss. Bekanntere Persönlichkeiten sind vor der Kirche beigesetzt. Dort befindet sich auch das Grab von Tonia Locatelli, einer italienischen Entwicklungshelferin, die im März 1992 bei dem Versuch, ein Massaker an den Tutsi von Nyamata zu verhindern, getötet wurde und heute als das erste weiße Opfer des Völkermords gilt.
Wenige Tage später dann besuche ich Murambi. Nichts weist auf das hin, was hier zu sehen sein wird. Wie die Karikatur eines Hausmeisters bei einer Schulinspektion läuft ein Mann eilfertig von Tür zu Tür eines ehemaligen Schulgebäudes. Er stößt eine Tür auf, verharrt kurz und eilt, ohne das Ankommen des Besuchers abzuwarten, weiter zur nächsten Tür. Wer den ersten Raum mit ohnehin schon dunkler Vorahnung betritt, bleibt abrupt stehen. Nicht menschliche Totenschädel oder Gebeine erwarten ihn, sondern mumifizierte Leichen, die auf Brettergestellen abgelegt wurden. Etwa fünfzig pro Klassenraum. Eng nebeneinander die Erwachsenen, auf gleicher Länge übereinander die Kinder. Kleinkinder oder Babys liegen, so scheint es, bei ihren Müttern oder Vätern, da die Körper in ihrer Lage wie zueinandergehörig wirken. Einige haben noch Reste ihrer Kopfbehaarung, andere zeigen Spuren tödlicher Verletzungen, in der Regel am Kopf, der das bevorzugte Ziel von Hieb- und Schlagwaffen gewesen sein muss. Am 23. April 1994 habe das Morden begonnen, sagt Emmanuel Murangira am Ende des Gangs, als ich zu ihm aufschließe, noch halb betäubt vom Geruch der vielen mumifizierten Leichen. Zur besseren Konservierung wurden sie mit einer kalkartigen Substanz bestreut, was ihnen nicht nur ein gespenstisches Aussehen gibt. Auch die Luft in den stickigen, von außen mit Plastikplanen abgedunkelten Klassenräumen ist ekelerregend schlecht. Es ist beinahe so, als würde sie in jede Pore eindringen und mit jedem Atemzug intensiver und gegenständlicher schmecken. »Ich bin hier für meine Frau und meine fünf Kinder«, fährt Emmanuel Murangira fort. »Nach einem tagelangen Martyrium – die Belagerer hatten die Wasserleitung zur Schule unterbrochen und keine Nahrungsmittel mehr hineingelassen –, wurden sie hier umgebracht. Zusammen mit 50.000 anderen.« Er selbst hat wie durch ein Wunder überlebt. Eine Kugel verletzte ihn an der Stirn. Für die Mörder war er wegen der Wunde, deren Spuren heute noch deutlich zu sehen sind, so sicher tot, dass nicht noch einmal geschossen oder zugeschlagen werden musste. »Vielleicht liegen meine Frau und Kinder auch auf den Gestellen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich aber liegen sie noch in einem der Massengräber da oben«, meint Emmanuel Murangira und zeigt zum Eingang des Schulgeländes. »Ich jedenfalls gehe hier nicht mehr weg. Ich weiß, was hier geschehen ist, und werde darüber reden.« Und wieder erzählt er von den Tausenden Tutsi-Flüchtlingen im Schulkomplex. Davon, dass die Behörden nur vier Polizisten zu deren Schutz abstellen wollten, von ihrer Verzweiflung und von dem Furor, mit dem die Hutu-Mörder von nah und fern sich an das Morden gemacht hätten. Sie seien jetzt (»aber noch längst nicht alle«) in Sichtweite im Gefängnis auf dem gegenüberliegenden Hügel, sie seien es auch gewesen, die die Leichen, die in den Klassenräumen zu sehen seien, hätten exhumieren müssen. »So werden sie immer an ihre Taten erinnert«, schließt Emmanuel Murangira in einem Anflug bitterer Zufriedenheit.
Innocent Gisanura konnte sich, obwohl verletzt, in die nahe gelegene Stadt Kibuye durchschlagen. Er fand Unterschlupf bei einer Frau, die ihm half. »Diese Frau, eine Hutu, hat Medikamente für mich besorgt. Sie hat sogar zwei Interahamwe Geld gegeben, damit sie mich am Leben lassen.« Die Frau habe ihn schließlich zu einem Militärlager der Franzosen gebracht, wo er versorgt worden sei. »Ja, die Franzosen haben mich behandelt, das stimmt. Doch habe ich auch gesehen, wie in diesem Lager, in dem sie mich behandelt haben, Frauen vergewaltigt und getötet wurden. Und die Franzosen haben mitgemacht. Sie haben Überlebende Tutsi vergewaltigt und getötet, das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen.«
Die letzten Sätze sind noch nicht ganz verklungen, als der französische Botschafter, dem das öffentliche Zeugnis Innocent Gisanuras übersetzt worden ist, von seinem Sitz aufspringt und die Tribüne Richtung Ausgang verlässt. Nur wenige Blicke folgen ihm, denn der Vorsitzende der Opfervereinigung Ibuka hat sich erhoben und sich vor das auf der Tribüne befindliche Mikrophon gestellt. Er spricht vom dem Leid der Opfer, der Grausamkeit der Täter und ihrer Nähe zu den Opfern, weder Nachbarschaft noch Zugehörigkeit zur selben Familie hätten die Täter an ihren Taten gehindert. Und er spricht von dem Versagen der Welt, die den Völkermord habe geschehen lassen, ein Versagen, das auch in den Ansprachen der Ehrengäste immer wieder aufgegriffen wird. Am Vormittag waren sie noch in der neuen Genozid-Gedenkstätte Gisozi in Kigali, die in ihrer Anwesenheit feierlich eingeweiht worden war. Filme über die Lebensverhältnisse unter dem alten Regime, Fotos fanatisierter Täter und ihrer zerschlagenen oder zerhackten Opfer und die Ausstellung diverser Gegenstände, die als Mord- oder Marterinstrumente nutzbar sind, hatten in ihnen eine Vorstellung davon wecken sollen, was sich in dem Land, dessen Gast sie heute sind, 1994 ereignet hatte. Jetzt stehen sie nacheinander vor den Überlebenden und Zeitzeugen und hatten, da sie Englisch sprachen, erkennbar Mühe, sich verständlich zu machen. Erst als der Letzte in der Reihe der Gäste, der belgische Premierminister Guy Verhofstadt, sich im Namen seines Landes auf Kinyarwanda dafür entschuldigt, dass Belgien seine Blauhelm-Soldaten zu früh abgezogen und das Land seinem Schicksal überlassen hat, tritt auf den Rängen wieder Ruhe ein. Dass Verhofstadt als Vertreter der ehemaligen Kolonialmacht so deutlich von einer moralischen Schuld spricht und dafür die Sprache der davon Betroffenen wählt, wird anerkennend zur Kenntnis genommen.
Am späten Nachmittag werde ich Zeuge einer anderen Form der Erinnerung, bescheidener und in kleinerem Rahmen. Die belgische und die ruandische Regierung haben auf das Gelände des ehemaligen Camp Kigali geladen, des früheren Armeehauptquartiers, wo am 7. April 1994 zehn belgische Blauhelm-Soldaten von einer aufgehetzten ruandischen Soldateska getötet worden waren. Vertreter der ruandischen Regierung, an der Spitze Premierminister Bernard Makuza, sind anwesend, desgleichen der belgische Premierminister mit einigen Mitgliedern seines Kabinetts sowie Familienangehörige der getöteten Soldaten, die sich neben ein kleines Stelenfeld gestellt haben (eine Stele für jeden Soldaten) und ergriffen der Verlesung der zehn Namen folgen. Ob es an der, verglichen mit dem Stadion, relativen Enge der Örtlichkeit liegt, an der mit Trauermusik untermalten Zeremonie oder an der vorstellbaren Zahl der Opfer (wie soll man auch 10.000 oder 100.000 Namen Ermordeter vorlesen können, ohne dass sie eben das bleiben: Namen) und ihrem grausamen Schicksal (geschlagen, gefoltert und irgendwie zu Tode gebracht), unter den nichtruandischen Anwesenden macht sich, so hat es den Anschein, eine Stimmung breit, die eine Ahnung davon aufkommen lässt, welches Grauen Ruanda 1994 heimgesucht hat. Es ist eine ausgezeichnete Idee, denkt man, dass auch an dieser Stelle, nämlich in den Nebengebäuden, in denen die belgischen Soldaten festgehalten wurden, eine Gedenkstätte eingerichtet worden ist, die Massengewalt und ihre Hinnahme durch eine teilnahmslose Welt zum Thema hat.
Die Gleichgültigkeit der Welt begegnet mir noch einmal am Abend in einer als »Totenwache« angekündigten Veranstaltung, wiederum im Amahoro-Stadion. Es ist nur spärlich besetzt und das Interesse an dem, was unten auf dem Platz im Innenbereich geboten wird, ist mäßig, zumal dort die meiste Zeit nichts passiert. Dass die Totenwache in erster Linie durch die Präsenz vieler ausgedrückt werden soll, ist wohl nicht bekannt. Man unterhält sich, telefoniert oder läuft herum. Erst als sich, gegen Ende der vierstündigen Wache, Hunderte von Tänzerinnen und Tänzer im Innenraum versammeln, gilt die Aufmerksamkeit wieder dem Geschehen. In verschiedenen Formationen bewegen sich die Tänzerinnen und Tänzer zum Takt von Trommeln, bilden Figuren, tanzen wieder, um zuletzt, über die gesamte Länge des Spielfelds und riesengroß, aus der Bewegung heraus das Wort »Rwanda 10« zu schreiben. Ein Paukenschlag ertönt, sie sinken zu Boden und eine jedes Mal lauter werdende Stimme fragt mehrmals: »Wer kann ein Baby töten?« »Wer kann ein Kind töten?« »Wer kann eine Frau töten?« »Wer kann einen Mann töten?«
Der Tod ist in der Trauerwoche allgegenwärtig in Ruanda. Auf dem einzigen Kanal des ruandischen Fernsehens besteht das gesamte Programm aus Dokumentationen, Diskussionen und Berichten über den Ablauf des Massenmords, über die Gleichgültigkeit der internationalen Gemeinschaft, die Rolle Frankreichs und das Versagen der Kirchen. Aufnahmen von agitierenden Politikern und machetenschwingenden Milizionären wechseln ab mit solchen, die in schonungsloser Offenheit Selektionen an Straßensperren zeigen und damit en passant die häufig zu hörende Behauptung widerlegen, der Völkermord habe auch deshalb stattfinden können, weil es keine Bilder gegeben habe, die die Weltöffentlichkeit hätten mobilisieren können. Ergänzt wird dieser Blick zurück in die Vergangenheit durch Reportagen über erst kürzlich an verschiedenen Orten des Landes entdeckte Massengräber, über Exhumierungen der Opfer und deren feierliche Beisetzung. Es ist noch nicht vorbei, sagen diese Bilder, es betrifft uns alle, es ist unsere Geschichte.