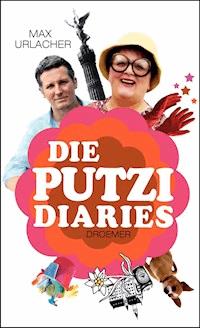Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei beste Freunde, eine Frau – und die Frage, auf was es wirklich ankommt im Leben: "Rückenwind" von Max Urlacher jetzt als eBook bei dotbooks. Gibt es sie wirklich, diese Momente, die ein Leben komplett verändern? Anton, der Träumer, ist noch ein Kind, als er zum ersten Mal Tobias begegnet und sofort weiß: Der wird mein Freund, mein allerbester Freund! Die beiden wachsen gemeinsam auf, fühlen sich unverwundbar, lachen, streiten und sind sicher, dass nichts und niemand sie jemals auseinanderbringen kann. Anton durchlebt den Wahnsinn, den man Schauspielschule nennt, und verliebt sich Hals über Kopf in die schöne Samar, während Tobias als Profisportler Karriere machen will. Aber es gibt sie wirklich, diese Momente, die ein Leben komplett verändern – und nicht immer so, wie man es sich wünscht … Ein Roman über das Erwachsenwerden, über Wünsche und Träume – und über die große Liebe, die so viele unterschiedliche Seiten haben kann: "Ein zauberhaftes Romandebüt über lebenslange Freundschaft." Maxi "Ein leises, warmherziges Buch. Jeder, der empfänglicher ist als eine Resopalplatte, wird diese Lektüre mögen." Rheinische Post online Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Rückenwind" von Max Urlacher. Wer liest, hat mehr vom Leben! dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Gibt es sie wirklich, diese Momente, die ein Leben komplett verändern? Anton, der Träumer, ist noch ein Kind, als er zum ersten Mal Tobias begegnet und sofort weiß: Der wird mein Freund, mein allerbester Freund! Die beiden wachsen gemeinsam auf, fühlen sich unverwundbar, lachen, streiten und sind sicher, dass nichts und niemand sie jemals auseinanderbringen kann. Anton durchlebt den Wahnsinn, den man Schauspielschule nennt, und verliebt sich Hals über Kopf in die schöne Samar, während Tobias als Profisportler Karriere machen will. Aber es gibt sie wirklich, diese Momente, die ein Leben komplett verändern – und nicht immer so, wie man es sich wünscht …
Ein Roman über das Erwachsenwerden, über Wünsche und Träume – und über die große Liebe, die so viele unterschiedliche Seiten haben kann: »Ein zauberhaftes Romandebüt über lebenslange Freundschaft.« Maxi
»Ein leises, warmherziges Buch. Jeder, der empfänglicher ist als eine Resopalplatte, wird diese Lektüre mögen.« Rheinische Post online
Über den Autor:
Max Urlacher, Jahrgang 1971, hat Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München und Wirtschaftsphilosophie in London studiert. Er gastierte unter anderem an den Schauspielhäusern in Zürich, Bochum und München und ist immer wieder in deutschen und internationalen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Neben seinen Romanen schreibt Max Urlacher Drehbücher und ist preisgekrönter Hörspielautor.
***
eBook-Neuausgabe Juli 2018
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Mitarbeit: Angela Lucke
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/Absent, boumward, pimchuwee und arroes
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96148-234-4
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Rückenwind an: [email protected]
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Max Urlacher
Rückenwind
Eine Liebesgeschichte
dotbooks.
Manchmal muss man auch die Häppchen essen, wo die Wurst nach oben gerollt und der Käse schwitzig ist.
Emilie
Wenige nur gibt es, die uns allein durch ihre Erscheinung verzaubern, die uns ganz und gar in ihren Bann ziehen. Wenn wir ihnen begegnen, trifft es uns ganz unvermittelt, ein Schlag, heftig, in die Magengrube, so mitten rein; der Puls überschlägt sich, das Herz setzt aus, die Ohren rauschen, eine taube Stille wie zwischen Blitz und Donner, man fühlt sich mickrig und erhaben zugleich. Dann geht ein Ruck durch den Körper, und du spürst, du weißt, das ist es.
Finale
Traurig, dass bestimmte Dinge nicht ungeschehen zu machen sind«, sagte sie, als Zidane nach seinem Kopfstoß gegen Materazzi mit der roten Karte des Feldes verwiesen wurde, und beobachtete gebannt, wie der Kapitän der Equipe Tricolore in die Kabine verschwand – vorbei am Weltmeisterpokal, den er keines Blickes würdigte. Anton dagegen hatte nur Augen für sie. Er beugte sich vor und traute sich, wie früher über die Senke an ihrem Schlüsselbein zu streichen. Sie ließ es zu und küsste ihn auf das Muttermal unterhalb seines Adamsapfels. Das Liebevolle daran ließ ihn zusammenzucken. Sein Herz trommelte.
Wie oft hatte er hier, im Berliner Olympiastadion, Block D, Haupttribüne, Unterring, die Spiele seines besten Freundes verfolgt. Eher uninteressiert, reine Freundespflicht. Am meisten hatte sich Anton stets auf die obligatorische Bockwurst und das Bier danach gefreut.
Aber heute, am 9. Juli 2006, umwehte etwas Magisches das Stadionrund. Ein Atem, der ihn und die knapp 70 000 Zuschauer anflog, aus gespannter Vorfreude, einem Gefühl der Einmaligkeit und dem Wissen, dass danach alles vorbei sein würde. Und als nach dem Elfmeterschießen sprühende Funken des Feuerwerkes vor ihnen herabregneten, Gianna Nannini »Notti Magiche« besang, Franzosen weinten und Italiener tanzten, sahen Anton und sie sich plötzlich von der Großbildleinwand eingefangen, erstaunt sich selbst betrachtend.
Eine Idee, wie es hätte sein können.
Teil I
Doppeldeckerengel
Das Gebüsch, hinter dem Anton sich versteckte, war dicht, schien ihm undurchdringlich. So konnte er ungestört beobachten, wie Tobias mit den größeren Kindern Himmel und Hölle spielte. Anton hatte gehört, wie seine Eltern von Tobias‘ »Schicksal« sprachen. Tobias‘ Mutter war kurz nach seiner Geburt gestorben. Eine tote Mutter. Das fand Anton toll. Wie Pippi Langstrumpf. Außerdem war Tobias Einzelkind, so wie er, hatte keinen Hund, noch nicht mal einen Hamster, so wie er. In jedem anderen Haus ihrer Spandauer Nachbarschaft zwischen Zitadelle und Eiswerder wohnten Geschwister, gleich nebenan sogar Zwillinge. Mark und Matthias. Die waren echt doof. Entweder hüllten sie Anton in ein weißes Bettlaken und zwangen ihn, mit ihnen obendrauf durch den Garten zu galoppieren, oder sie stülpten ihm beim Indianerspielen die Unterröcke ihrer Mutter über, damit er als Squaw um Gnade flehte. Anton wollte nie Indianer sein und schon gar nicht Squaw.
Es war 1978, ein glühend heißer Sommer lag über der Stadt, und auf dem Kopfsteinpflaster wuschen die Nachbarn ihre Audi 80s, Opel Mantas und Ford Capris. Mit Eimern zogen sie zur gusseisernen Pumpe an der Straßenecke, die aus einem dunkelgrünen Drachenmaul das Wasser spie. Dann shampoonierten sie mit dicken Schwämmen die Kühlerhauben, polierten die Felgen, saugten den Innenraum, fuhren liebevoll über den Lack, begutachteten die technischen Daten, verglichen Hubraum, Motorleistung und Tachostand der eigenen mit denen der anderen Modelle.
Ein typischer Sonntag in Westberlin, als Anton beschloss, Tobias für sich zu gewinnen.
Er überlegte, wie er vorgehen müsste. Aber halt. Erst einmal musste er überlegen, wo er diese Überlegung überhaupt anstellen wollte. Hier, hinter der Hecke? Unter seinem Bett? In der Küche? Die Idee mit der Küche gefiel ihm. Sein Großvater würde ihm eine Schokolade machen. »Ein Trostpflastergetränk, das beste, hilft beim Denken und Vergessen – ganz wie man möchte!« Sanft würde er den Kakao in die Milch rühren und wahlweise etwas Karamell- oder Kirschsirup hinzugießen. »Das Geheimnis ist, die Milch zu streicheln, wie eine Dame, sonst schäumt sie über!« Aber dann würde ihn sein Großvater fragen: »Warum spielst du nicht draußen mit den anderen Kindern?« Und Anton wollte nicht schon wieder erklären müssen, dass die Nachbarskinder gemein zu ihm waren. Sein Großvater würde das nicht verstehen. Das wusste Anton. So wie er wusste, dass Tobias anders war als die anderen. Mit ihm dürfte er Cowboy sein und würde nie an einen Baum gebunden. Mit Tobias an seiner Seite müsste er nicht fürchten, den Schimmel zu machen. Das wusste er einfach. Das war ein ganz und gar sicheres Gefühl. Und auf sein Gefühl konnte er sich verlassen. Immer.
»Gefühle sind wie Träume«, sagte seine Großmutter zwar, »irgendwann wacht man auf und ist heilfroh.« Aber für Anton waren seine Träume echt. Wäre ja total blöd, wenn es all die wunderbaren Geschichten und Märchen nicht irgendwo tatsächlich gäbe oder zumindest irgendwann einmal geben würde, die Abenteuerorte und verwunschenen Länder, das wuselige Wikingerdorf Flake zum Beispiel, die bunte Sparkasseninsel Knax, die unheimlichen Wälder, in denen er mit den wilden Kerlen mächtig Krach machen und im Kreis seiner um ihn versammelten Schlümpfe Kämpfe gegen Gargamel bestehen wollte. Waren die Erwachsenen auch anderer Meinung, er war sich seiner gewiss, so gewiss wie der Tatsache, dass man einen Haufen Kirschkerne schlucken konnte und aus dem Bauch heraus würde trotzdem kein Kirschbaum wachsen, mochten die Großen erzählen, was sie wollten. Er hatte es probiert, und es hatte nicht funktioniert.
Wie dumm. Jetzt hatte er sich mit seinen Überlegungen selbst abgelenkt. Bei Himmel und Hölle war Tobias gerade an der Reihe gewesen, und Anton hatte es überhaupt nicht mitgekriegt. Mist. Dieses Mal sogar mit verbundenen Augen. Offenbar fehlerfrei. Die anderen Kinder klatschten und halfen Tobias, das Tuch von den Augen zu nehmen. Und da, plötzlich, als ob dieser gespürt hätte, dass er beobachtet wurde, hob er seinen Kopf, und ihre Blicke trafen sich. Antons erster Impuls war, hinter der Hecke abzutauchen, sich zu verstecken. Stattdessen winkte er sogar und erschrak prompt über sich selbst. Er hatte die Folgen seiner Handlung nicht bedacht. Dass eine Aktion eine andere nach sich zog. Und tatsächlich. Tobias winkte zurück. Antons Herz tat einen Sprung. Aber nun war es wieder an ihm zu handeln. Das überforderte ihn. Er rannte ins Haus. In die Küche. Sein Großvater war nicht da. An den Herd durfte er nicht. Er blickte sich hilfesuchend um. Die Rettung: Nutellaschrippen!
Er stürmte auf die Straße. Anton hatte nicht gewusst, ob er die Brötchenhälften buttern sollte oder nicht. Er bevorzugte sie ohne, sein Großvater mit Butter. Also hatte er sie nur bis zur Mitte bestrichen und obendrauf ganz dick Nutella. Schwierig war das gewesen, denn die Butter und das Nutella waren ganz hart. Außerdem hatte er vergessen, beides wieder in den Kühlschrank zu stellen. Auch die Küchentür hatte er offen gelassen, fiel ihm gerade ein. Egal. Weiter. In jeder Hand hielt er eine Brötchenhälfte und näherte sich damit der Gruppe, steuerte geradewegs auf Tobias zu, vermied es, irgendjemanden sonst anzuschauen.
»Was will denn der Arsch!«, rief einer der Nachbarszwillinge. Anton tat so, als hörte er nicht. Die Kinder beobachteten, wie sich Anton direkt vor Tobias stellte und ihm die Nutellahälften hinhielt. Wortlos griff sich Tobias eine. Hier endete Antons Plan. Was nun? Wohin mit dem zweiten Brötchen? Wohin mit sich? Nichts wie weg! Anton drehte sich um und lief zurück. Hätte er stehenbleiben sollen? Noch ein Weilchen warten? Nein. Doof. Oder? Und plötzlich spürte er ihn neben sich. Ein Ruck ging durch Antons Körper, als ob Leute in seinem Bauch tanzten, ihn großtanzten, ihn mit jedem Schritt, den Tobias neben ihm ging, größer und größer tanzten.
Sie aßen die Nutellaschrippen inmitten der hochgewachsenen Rhododendronbüsche hinterm Haus. Antons Versteck. Noch nie hatte Anton jemanden dorthin mitgenommen, noch nicht einmal seinen Großvater. Sie waren allein. Tobias trug das blaue Krümelmonster auf seinem T-Shirt. Eigentlich gruselte sich Anton vor dem Krümelmonster, wenn es so grob aus dem Fernseher spuckte, aber bei Tobias sah es ganz zahm aus. Alles an Tobias nahm er mit unverhülltem Staunen in sich auf. Seine großen Augen, grüngesprenkelt wie Antons Lieblingsmurmeln. Seine lässige Gegenwart, so stattlich wie ein echter. Ritter oder ein Pirat oder Ritter und Pirat zusammen. Nach dem letzten Bissen leckte sich Tobias die Nutellareste aus den Mundwinkeln, dann wischte er sich mit dem Handrücken die Spucke ab und rubbelte die Hand nicht etwa an, sondern in seiner Hosentasche trocken. Anton war beeindruckt – wie ein feiner Herr! – und machte es ihm nach. Jetzt war es an ihm zu imponieren. »Ich hab ein Monchichi.«
Keine Reaktion.
»Ich kann Kaugummiblasen machen, richtig dicke!«
Auch das beeindruckte Tobias nicht.
»Ich kann ohne Stützräder!«
Tobias zuckte die Schultern, schaute nach oben, sog die Luft tief durch die Nase ein. »Ich rieche Regen!«
Und tatsächlich begannen in diesem Augenblick, dicke Tropfen auf das Blätterdach zu klopfen. Anton war wie gelähmt von Tobias‘ übersinnlichen Fähigkeiten.
»Komm, lass uns Regendavonlaufen spielen«, schlug Tobias vor. »Unterstellen unter was, das am Boden befestigt ist wie Haus, Baum, Brücke, Bushaltestelle, ist verboten, gildet nicht!« Damit krabbelte er aus der grünen Höhle und Anton hinter ihm her. »Renn! Wer als Erster dem Regen entkommt, hat gewonnen!« Rennen war bei Anton schon damals sinnlos. Tobias war sowieso schneller. Also blieb Anton stehen und hoffte einfach ganz doll, dass ihn der Regen übersehen oder sich etwas zwischen ihn und den Regen schieben würde, ein Flugzeug vielleicht, ein Zeppelin, ein Ufo oder wenigstens ein großer Vogel. Anton hatte damals noch nicht kapiert, dass der Regen direkt aus den Wolken kommt. Er dachte vielmehr, der Regenmann sitze ähnlich wie Frau Holle auf einer Wolke und strullere über den Rand, wie das Männeken Piss im Stadtpark. Also schrie er: »Da lang, da ist eine Wolke, da können wir uns unterstellen.«
Tobias drehte sich um. Er verstand nicht. Was redete der da? War der bescheuert? Machte der sich lustig über ihn? Tobias war nahe dran, Anton eine Kopfnuss zu geben. »Unter der Wolke wirst du doch am nassesten!«
»Nein, da sind wir sicher vor dem Regenmann!«
Als Tobias Antons Irrglauben erkannte, hörte er gar nicht mehr auf zu lachen, und Anton fing an zu heulen, weil er offensichtlich etwas Dummes gesagt hatte und nicht einmal wusste, was.
Tobias machte einen Vorschlag zur Güte. Das war schon damals seine Spezialität. Er blieb neben Anton stehen und erklärte: »Es gibt freundliche Wolken, und es gibt Regenwolken. Und die kann nur die Sonne besiegen.« Und wie aufs Stichwort brachen erste Strahlen durch die graue Wolke über ihnen. Galilei und Kopernikus hätten nicht stolzer sein können ob ihrer Entdeckungen als Anton über dieses neugewonnene Wissen.
Der Regen hatte aufgehört. Nur sein Dunst lag noch in der Luft. Der Rasen dampfte. Ihre Turnschuhe waren aufgeweicht, die T-Shirts klebten nass an ihren Rücken, aber sie fröstelten nicht, so aufgekratzt, wie sie waren. Und plötzlich begann Anton zu tanzen und zu singen:
»Ätschi Ätschi ÄtschiWir haben den Regenmann verjagtBätschi Bätschi BätschiVerjagt Verjagt VerjagtHa Ha HaWir sind die RegenritterHo Ho HoWir haben keine AngstPiff Paff PuffWir sind die WolkenmonsterGri Gra GrauWeg Weg WegHulli Bulli Wulli.«
Dabei schmiss er die Arme in die Luft, drehte sich um sich selbst und hüpfte wild umher. Tobias war irritiert und belustigt zugleich. So schräg und seltsam, wie Anton klang, konnte er die Melodie und den Text nur selbst erfunden haben. Komischer Heini. Total verrückt. Anton hibbelte um ihn herum und stupste ihn auffordernd in die Seite: »Piff Paff Puff.« Tobias lachte, zuerst verhalten, dann immer ausgelassener, bis es in seiner Brust wummerte. Tränen traten ihm in die Augen. Und plötzlich, ganz abrupt, hörte Anton auf zu tanzen. Ernst und feierlich trat er nahe an Tobias heran und flüsterte: »Ich zeig dir eine Heimlichkeit!«
Anton rannte um das Haus Richtung Garage, das nasse Gras glitschte unter seinen Schuhen. »Komm mit!« Jedes Geheimnis, jede Kostbarkeit wollte er von nun an mit Tobias teilen. Er zeigte auf das Garagentor. »Guck mal!« Tobias kniff die Augen zusammen. »Na da!« Anton trat an das Tor heran und zeichnete mit dem Zeigefinger Spuren von Kreide nach. Jetzt erkannte auch Tobias den weißen Schatten auf dem grünen Tor. Die Umrisse eines Körpers samt zweier überdimensionaler Flügel. »Ein Engel. Hat sich verflogen und ist gegen das Tor geknallt. Der Arme. Richtig dick muss der gewesen sein. Mein Großvater sagt, der hat bestimmt zu viel Schokolade genascht!« Am Fuß des Tores war ein hölzernes Trittbrett befestigt. Darauf stellte sich Anton jetzt und schmiegte sich rücklings in die Silhouette. Er breitete seine Arme aus und bat Tobias, sich mit dem Rücken gegen seinen Bauch zu lehnen. Dann schrie er zum Haus hinüber: »Großpapa, wir wollen fliegen!«
»Jaja, ich komm ja schon!« Aus der Haustür trat Opa Fitz, riesig von Statur und fett wie Antje das Walross, eine Zigarre in der einen, ein Whiskeyglas in der anderen Hand. Die Eiswürfel knackten im Glas. »Oh, wir haben Besuch!« Opa Fitz gab Tobias die Hand. Sie war nass und angenehm kühl – vom Whiskeyglas – und so mächtig, dass Tobias‘ Finger vollständig darin verschwanden. Opa Fitz trug Gummistiefel, eine weite von Trägern gehaltene Hose, ein braunes Cordjackett mit Lederflicken an den Ellbogen und einen Strohhut mit Krempe. »Sie erlauben, dass ich mich vorstelle?« Eine tiefe raue Stimme. »Ich bin der Großvater von Anton, und wer sind Sie?«
»Mein bester Freund«, antwortete Anton für ihn.
»Echt?« Tobias war überrascht.
»Ich schwöre!« Anton legte sich Zeige- und Mittelfinger an die Lippen, dann ans Herz und fragte: »Bin ich auch dein bester Freund?«
Tobias nickte.
»Schwörst du?«
Tobias machte das Schwurzeichen.
»Na wunderbar, dann ist ja jetzt klar, wer Sie sind«, sagte Opa Fitz. »Sehr erfreut!« Er lächelte leicht amüsiert: »Eine gute Freundschaft ist eine Leidenschaft fürs Leben« und zog an seiner Zigarre, »ich hatte auch mal einen besten Freund. Gerd. Kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke.« Der Rauch der Zigarre umwaberte die Jungen.
»Mein Opa ist schon mit Haien getaucht und hat Ameisen gegessen!«, trötete Anton.
»Aber das ist lange her«, fiel ihm sein Großvater ins Wort. »Und glauben Sie mir, beides ist nicht zu empfehlen!« Damit ging er in die Garage. »Festhalten!«, rief er von innen und drückte gegen das Tor, das sich wie ein Maul öffnete. Opa Fitz ließ es hinauf-, hinab- und wieder hinaufsteigen. »Siehst du, wir fliegen!«, quietschte Anton vor Vergnügen.
Tobias drehte sich nicht um. Er vermied es, Anton anzusehen. Besser nichts Unpassendes sagen, wie vorhin, als er gelacht und Anton zum Weinen gebracht hatte. Und dabei wollte er ihn wissen lassen, wie wohl er sich gerade fühlte. Wie nach zwei Stück Baiser, nur besser, oder wie an seinem Geburtstag, wenn er die Kerzen ausblasen und im Schlafanzug frühstücken durfte. Klar, er wusste wohl, dass sie nicht flogen, wogegen Anton, der ihn von hinten mit seinen Armen umschlossen hielt, davon mehr als überzeugt zu sein schien, so begeistert jubelte er in die einsetzende Dämmerung hinein: »Wir fliegen! Wir fliegen!« Es störte Tobias nicht. Mochte Anton in gewissen Dingen anders, ja geradezu seltsam sein. Er wollte dieses Gefühl nicht verlieren, auf einer Schräge zu liegen und festgehalten zu werden, auf einem Garagentor abzuheben und davonzufliegen.
Eine untrennbare Geschichte
Anton und Tobias wurden unzertrennlich, halfen sich über die ersten Härten des Lebens hinweg: Winnetous Tod, den Abstieg ihrer Fußballmannschaft, Antons Mandeln und Tobias‘ Blinddarm. Sie teilten ihre Baukästen von Fischer-Technik und die Begeisterung fürs Ost-Sandmännchen, das sie jeden Abend kurz vor sieben in ihr Wohnzimmer ließen. Während der Wicht mit Dreispitzbart am Ende der täglichen fünf Minuten seinen Zaubersack öffnete, um den Kindern eine Handvoll Schlafsand entgegenzustreuen, versteckte sich Anton hinterm Sofa, um auch bloß nichts abzukriegen. Nicht so Tobias, der dem Sandmann tapfer ins Auge blickte. »So was Blödes, dann wirst du doch müde«, meinte Anton, und darauf Tobias: »Aber dann ist schnell Morgen, und ich bin wieder da!«
Tobias‘ Vater arbeitete als Ingenieur bei Siemens und redete pro Tag, wenn's hochkam, zwei Sätze mit seinem Sohn: »Wahrscheinlich schläfst du schon, wenn ich nach Hause komme.« Und, egal welche Witterung herrschte: »Zieh dich warm an.« Er hatte eine Zugehfrau eingestellt, die tagsüber auf Tobias aufpassen sollte, Tante Siegrid, eine knöchrige Alte mit Lederweste. Sie roch nach Küche, nach gehackten Zwiebeln und abgestandenem Fett. Tobias verstand nicht, warum er diese Person »Tante« nennen sollte – »Das ist sie doch gar nicht!« –, und beschloss, ihren Namen zu ignorieren, beschloss wenig später, gar nicht mehr mit ihr zu reden. Als Tante Siegrid auf dem Weg zum Pilzesuchen im Tegeler Forst vom Moped fiel und sich das Schlüsselbein brach, befürchtete Tobias, er könnte schuld daran sein, denn er hatte nachts vorm Schlafen immer wieder zum lieben Gott gebetet, er möge doch die falsche Tante zu sich holen und dafür seine Mutter wieder nach unten entlassen. Während Tante Siegrid im Krankenhaus lag, war Tobias nach dem Kindergarten bei den Nachbarn reihum zum Essen eingeladen. Bei Antons Familie schmeckte es ihm am besten, und so verbrachte er die Mahlzeiten und bald auch die Abende, Wochenenden und Ferien bei ihnen, und da Opa Fitz den Vater von Tobias überzeugen konnte, sein Sohn sei eine Bereicherung und keine Bürde für die Familie, wurde Tante Siegrid, kaum war sie aus dem Krankenhaus entlassen, gekündigt.
Tobias liebte das efeuumrankte Haus der Familie Fitz. Es war mit Abstand das größte in ihrer von Linden gesäumten Straße, in der sich sonst nur moderne Bungalows an Doppelhäuser mit Flachdach reihten. Diese ähnelten einander, innen wie außen. Aber das Haus der Familie Fitz war eine eigene Welt. Allein schon der Garten war ganz anders als alle anderen drum rum. In ihm sah man Opa Fitz unentwegt graben und düngen, stutzen und umsetzen, aussäen und veredeln. Er puzzelte zu jeder Jahreszeit, im Sommer mit Panamahut und offenem Hemd, dessen Enden er über seinem gewaltigen Bauch verknotete, sobald es kälter wurde, im dicken Norwegerpulli und Helmut-Schmidt-Mütze. Und unaufhörlich pfiff er dabei vor sich hin, Melodien, die Tobias nicht kannte. Seine Fröhlichkeit war ansteckend. Er lud sie zu Waldmeister-Tritop, ganz vornehm mit einer Scheibe Zitrone, und Hähnchenschenkel für gleich in die Hand in den Pavillon vor dem großen Rhododendron ein und schaute sich stolz um. Doch trotz all der Mühe, die sich Opa Fitz gab, wirkte der Garten wild und chaotisch. Richtig verwunschen, fand Tobias, wie auch das Haus, mit seinen schweren Vorhängen, den Kronleuchtern, den ächzenden und knarzenden Dielen. Es gab Mansarden und eine breite Treppe, auf deren Stufen allerhand Krimskrams gestapelt lag: Antons Spielzeug, Taschen, Schuhe und Getränkekisten. Das Treppengeländer, das Anton mit einer Reihe quietschbunter Pril-Blumen verziert hatte, endete in einem Sockel mit nacktem Statuettenpaar. »Herbert und Winnifred«, stellte Anton sie vor und begrüßte die beiden jedes Mal beim Vorbeigehen mit Namen: »Hallo, Herbert, hallo, Winnifred!«
Das Wohnzimmer hatte hohe Decken, wie in einer Kirche, buntverglaste Flügeltüren und einen langen Couchtisch, der immer mit Katalogen und Zeitschriften bedeckt war. An den dunkelrot tapezierten Wänden hingen alte Bilder von Hirschen und Gebirgen. In der Ecke stand eine imposante Bar aus dunklem Holz mit allerlei Flaschen, gezackt, rund, spitz, oval, groß, klein, durchsichtig, matt, mit prächtigen Etiketten aus fremden Ländern und Flüssigkeiten in verschiedensten Farben, Bernstein, warmes Orange, tiefes Rot und ätzendes Grün. Auf jedem der drei Stockwerke gab es ein Badezimmer. Anton und seine Eltern wohnten in der ersten Etage. Ihre Badewanne stand mitten im Raum. Antons Großmutter hatte ihre Räume ganz oben, ihr Mann die seinen im Erdgeschoss.
»Unsere von Unordnung beherrschte Bürgerlichkeit«, nannte Opa Fitz ihr Haus. Das verstand Tobias nicht. »Na ja«, versuchte Opa Fitz zu erklären, »unsere grüne Hütte gleicht einer in einen Frosch verzauberten Prinzessin in Trauerstellung.«
»Wieso denn eine Prinzessin und kein Prinz?«
Das sei ihm sympathischer, erklärte Opa Fitz.
»Und wieso in Trauerstellung?«
»Na, die schaut so vergrämt und windschief drein, die glaubt nicht mehr an den erlösenden Kuss.«
Und tatsächlich, von außen betrachtet, konnte man in den beiden Türmchen oben links und rechts die Augen eines Frosches erkennen, den Mund in der breiten Fensterfront des ersten Stocks, deren Licht im Dunkeln gedämpft durch die schweren Vorhänge schimmerte, und die Vorderbeine in den vorgelagerten Erkern, die sich vom Erdgeschoss bis in den zweiten Stock erstreckten. Eines Tages versuchte Anton,. an dem Efeu hochzuklettern und den vermeintlichen Froschmund zu küssen. Tobias fand, das sei ein doofes Spiel. »Das ist doch dusselig«, sagte er. »Was willst du denn mit einer Prinzessin, wenn du dann kein Haus mehr hast?« Er wusste, dass dieses Argument Anton überzeugen müsste, und nachdem dieser kurz darüber nachgedacht hatte, Prinzessin oder Haus, kletterte Anton, ohne seine Lippen gegen die Fensterscheiben gepresst zu haben, wieder hinunter, und sie spielten Verstecken.
Aber nicht nur das Haus, auch seine Bewohner faszinierten Tobias. Sie hatten Ähnlichkeit mit dem Personal seiner Lieblingsserie Arabella, die Märchenbraut, in der Figuren aus der Märchen in die wirkliche Welt eindrangen und umgekehrt. Demnach waren die Eltern von Anton das ruhmsüchtige, Intrigen schmiedende Prinzenpaar. Und in der Tat, Antons Vater hatte verkniffene Züge und ein fieses Schnauzbärtchen. Man sah ihn nur selten. Ständig war er unterwegs.
»Bestimmt fliegt mein Papa grad über irgend 'nen andern Kontinent«, erzählte Anton, wenn Tobias fragte. »Er baut nämlich Schlösser und so.« Antons Mutter sah mit ihren geflochtenen, langen roten Haaren tatsächlich aus wie eine Prinzessin, eine traurige Prinzessin, denn wenn sie lachte, lachte nur ihr Mund. Ihr müder Blick war nie frei von Argwohn. Alles schien sie anzustrengen: Termine, das Wetter, die Nachbarn, ihre Verdauung, die Politik in Deutschland, in Afrika, in Asien. Wenn sie redete, dann sehr laut, und ihre Hände zerhackten dabei die Luft.
Antons Großeltern waren das Königspaar, sehr würdevoll. Sie, ein schmales Persönchen, mit gütigem Blick, der sich ab dem Nachmittag zu verschleiern begann, denn pünktlich, um 17.00 Uhr, begann sie, ihren geliebten Grauburgunder aus dem Kaiserstuhl zu trinken. Nie etwas anderes. Bis dahin habe man ihren »mürrischen Charme« zu ertragen, monierte Opa Fitz. Aber Tobias konnte keinen Unterschied in ihrem Benehmen zwischen Vor- und Nachmittag entdecken. Für ihn war sie immer eine noble Dame. So ganz anders, als er sich eine Oma vorstellte, nie tüdelig, nie zum Schwatzen und Küssen und In-die-Wangen-Kneifen aufgelegt. Sie hatte den Blick einer Königin, die alles gesehen und vieles begriffen hat. Mit einer buddhahaften Ruhe. Sie war immer da und nie richtig anwesend. Wenn er mit Anton an ihr vorbei durchs Haus tobte, hob sie nicht einmal den Kopf. Wenn einer von ihnen aufschrie, weil er sich verletzt hatte, Knie oder Ellbogen bluteten, lächelte sie nur, wie immer ganz vornehm, mit der Hand vor dem Mund, und bat die Jungen, mit dem Problem zu ihrem Mann zu gehen. Der wisse Rat. Dann vertiefte sie sich wieder in ihre Lektüre, keine bunten Magazine, wie sie die Damen beim Friseur oder in der Konditorei lasen, sondern schwere Zeitschriften, voll mit Tabellen und Zahlen.
Für jeden Tag der Woche hatte Antons Großmutter eine andere Perücke, »ihre Kronen«, wie Anton meinte. Hinzu kamen drei für feierliche Anlässe, Besuch oder fürs Ausgehen, zwei für Beerdigungen und eine für Weihnachten. Manchmal zogen Anton und Tobias die Perücken heimlich aus den mit Stoff bezogenen Schachteln in ihrem Schlafzimmer und setzten sie sich gegenseitig auf. Dann spielten sie König und Königin. Die Perücken waren unterschiedlich in Länge und Farbe, changierend zwischen Haselnuss und Platin. Nur in einem waren sie sich ähnlich, darin, dass sich die künstliche Haarpracht gelegentlich auf wunderliche Weise statisch auflud und wie elektrisiert wirrwild zu allen Seiten abstand. »Meine unwirsche Zauberfee«, nannte Opa Fitz seine Frau dann und strich ihr liebevoll das Haar glatt.
»Großmama kann nämlich hexen«, erklärte Anton.
»O ja«, pflichtete ihm Opa Fitz bei, »das kann sie. Sie kann aus wenig viel Geld zaubern. Ich dagegen kann es nur verschwinden lassen.«
»Lass dir nichts erzählen. Ich habe keinerlei Zauberkräfte. Leider«, flüsterte Großmama Tobias zu, »aber verrate das niemanden, sollen sie es doch denken, nicht? Was Menschen in dich hineinprojizieren, was sie von dir glauben, damit können sie, und häufig auch du selbst, besser umgehen als mit dem, wie du wirklich bist.« Dann lächelte sie ihr Königinnenlächeln, unendlich weise, in sich hinein und hielt dabei die Hand vor den Mund. Tobias wusste zwar nicht, was hineinprojizdingsbums zu bedeuten hatte, aber er lächelte ebenfalls, als hätte er verstanden.
Opa Fitz war der mächtige König. Kein strenger Despot wie der Herrscher in Drei Nüsse für Aschenbrödel, nein, viel sanfter und fröhlicher. Wie Samson aus der Sesamstraße, nur schlauer und stets im Jackett, wie ein König eben. Immer mit einem Augenzwinkern und einem Lächeln auf den Lippen. Und ähnlich wie Samson, der sich, wenn er mit Tiffy oder Herrn von Bödefeld redete, zur Kamera drehte, hin zu den Kindern vorm Fernseher, wie ein König zu seinem Volk sprach, so öffnete auch Opa Fitz seinen Gesprächsradius hin zu einem größeren Publikum, auch wenn gar keines vorhanden war.
Und Anton? So eine Figur wie ihn kannte Tobias aus keinem seiner Kinderbücher- oder filme. Ein Prinz war er nicht. Dafür war er zu sonderbar. An einem Tag beschloss er, heute bin ich ein Bagger, und brummte vor sich hin, am nächsten Tag war er ein Düsenjet und kreischte durchs Haus. Manchmal war Anton eher wie eine Prinzessin, ähnlich etepetete und in ständiger Angst, vor den Schäferhunden von Lothar Tusselmann zwei Häuser weiter rechts, vor den Bösewichten von Aktenzeichen XY, vor der gesamten Sowjetarmee, die er täglich vor seiner Wohnungstür erwartete, und vor Mark und Matthias, den Nachbarszwillingen. Die drohten ihm, nachts über den Zaun zu steigen, ihm Zahnpasta in die Augen zu schmieren und ihn so zum Erblinden zu bringen, wenn er ihnen seine Murmeln nicht überließe.
Über Antons Bett war ein Sternenhimmel angeklebt, der wundersam nachleuchtete, wenn man ihn vorm Schlafengehen mit der Nachttischlampe anstrahlte. »Wir liegen in den Sternen«, flüsterte Anton, wenn Tobias bei ihm übernachten durfte. Tobias‘ Frotteepyjama roch so beruhigend anders. Anton wollte auch so riechen, aber seine Mutter weigerte sich, fremdes Waschpulver zu kaufen, also tauschten sie ihre Oberteile. »Du bist viel zu klein dafür. Du ertrinkst ja darin!«, meinte Opa Fitz, der kam, um sie zuzudecken. Dann erzählte er ihnen, wie er als Marinetaucher mit seinem besten Freund Gerd in Griechenland nach Bomben getaucht, wie er in Afrika mit Löwen gekämpft und in China Schlangenblutsuppe gelöffelt hatte, dass es die besten Zigarren auf Kuba und die schönsten Frauen in Argentinien gebe. Er erzählte, wie er sich nach dem Krieg mit dem Schmuggeln von Zigaretten das Kapital für seine erste Drogerie in Schmargendorf verdient und bald darauf Filialen in ganz Berlin eröffnet hatte. »Eine entsetzlich dröge Arbeit, den ganzen Tag hinter der Theke stehen und Frau Meyer oder Herrn Paschulke Seife und Parfums aufschwatzen – furchtbar!« Manchmal war es ihm zu unbequem auf dem Stuhl neben ihrem Bett, dann sagte er: »Macht Platz für den Alten« und lümmelte sich zwischen sie. »Na los, kommt an meinen Wanst!«, rief er, um mit ihnen »rumzuschlumpfeln«, wie er das wilde Herumtoben nannte.
Zum Leidwesen von Antons Großmutter liebte er Rumgeschlumpfel aber auch und vor allem mit dem weiblichen Geschlecht – und das weibliche Geschlecht mit ihm. Einen »Liebeeinsammler« nannte Antons Großmutter ihren Mann. Wenn Anton und Tobias mit ihm unterwegs waren, passierte es oft, dass er die beiden einer Unbekannten als seine Neffen vorstellte. »Dass ihr meine Enkel seid, würde die Damen nur unnötig irritieren.« Und um seiner Ausstrahlungskraft Nachdruck zu verleihen, griff er sich dabei ins dichte weiße Haar. Wenn Opa Fitz während ihrer Streifzüge zufällig oder verabredet, so genau konnten Anton und Tobias das nicht sagen, einer Dame begegnete, einer französischen Touristin, einer ehemaligen Mitarbeiterin aus einer seiner Drogerien, seiner Steuerberaterin, einer Kellnerin vom Café Kranzler, dann kaufte er den Jungen ein Ticket für eine Doppelvorstellung im Marmorhaus am Ku'damm und tauchte erst wieder auf, wenn der Film zu Ende war. Dann lud er sie zu Burger King ein, was ihre Eltern nie erlaubt hätten. »Viel zu ungesund! Amerikanischer Plastikfraß!«
Zwischen Opa Fitz und den Jungen bestand eine stillschweigende Vereinbarung: Er verwahrte für sie ihre Burger-King-Kronen, die sie aufsetzen durften, wenn sie mit ihm durch Berlin zogen, im Gegenzug antworteten Anton und Tobias, wenn sie gefragt wurden, ob sich der Opa denn nicht langweilen würde im Kino, mit einem knappen »Nö!«.
An einem kalten Winterabend, nach Kino und Burger King, an dem sich Anton und Tobias trotz der Kälte weigerten, ihre Kronen gegen Wollmützen einzutauschen, eilten sie an der Gedächtniskirche vorbei über den Breitscheidplatz, Richtung Bahnhof Zoo. Dort, in der Seitenhalle bei der Gepäckabgabe kurz vor der Rolltreppe, die sie zum Bahngleis und zur S-Bahn nach Spandau bringen sollte, hielt Opa Fitz an einer gammeligen Fotokabine. »Wie wär's?« Er schob den Vorhang zur Seite. »Das einzige Bild, das ich von meinem besten Freund Gerd besitze, trage ich hier.« Er tippte auf sein Herz. »Eine gemeinsame Erinnerung?«
Anton und Tobias drängten sich auf den Drehstuhl, schraubten sich hinauf und hinab, bis sie ihre Gesichter samt der Kronen in der Markierung des Spiegels wiederfanden, blickten geradeaus, sich gegenseitig in die Augen. Sie legten ihre Arme auf die Schulter des anderen. Der dampfende Atem erfüllte die Kabine. Sie waren satt und zufrieden und fühlten sich geborgen. Antons Großvater warf von draußen Münzen in den Schlitz. »Ihre Majestäten, ein Foto für die Ewigkeit!« Viermal warteten sie auf den Blitz. Anton erschrak und schloss die Augen. Tobias hielt sie geöffnet. Als die Fotos in den Schacht fielen und in der warmen Luft des Gebläses trockneten, entwickelte sich vor ihren Augen »eine untrennbare Geschichte von Freundschaft und Liebe«, wie Opa Fitz meinte.
»Liebe?« Die Jungen kicherten. »Igitt!«
»Ja, Liebe. Was ist Freundschaft anderes als Liebe?« Opa Fitz teilte die Fotos auf. »Zwei für jeden von euch, verliert euch nicht, behaltet euch!«
Opa Fitz brachte ihnen bei, wie man eine Fliege bindet, wie man ein Feuer entfacht, zeigte ihnen, wie man sich als Mann rasiert – dabei waren sie nicht älter als sechs –, wie man Fingernägel pflegt, wie man beim Armdrücken gewinnt und auf dem Rücken schwimmt.
»An welchen meiner Lieblingsorte reise ich heute mit euch?«, fragte er, und dann ging es los in seinem weißen Mercedes Cabriolet mit braunen Ledersesseln zum Strandbad Wannsee, ins stickige Völkerkundemuseum in Dahlem, zur seltsam schönen Nofretete, in den weiten Park des Schlosses Charlottenburg oder in die Sternwarte am Insulaner. Er beobachtete Anton und Tobias beim Betrachten der Exponate und freute sich über ihr unverhülltes Staunen. »Heute zeige ich euch einen ganz besonderen Ort. Neben unserer grünen Hütte der mir wichtigste in ganz Berlin.« Er führte sie auf die Aussichtsplattform am Brandenburger Tor, wo er nach drüben zeigte. »Nicht weit von hier bin ich aufgewachsen. Da hinten, ein paar Straßen weiter am Gendarmenmarkt. Mein bester Freund Gerd wohnte gleich übern Flur. Es gab nichts, worüber wir nicht miteinander sprachen, wir waren füreinander der Mensch, dem man vertraut.«
»Und wo ist der jetzt?«, fragte Anton.
»Er verschwand – für immer.«
»Warum?«
»Ja ... warum?« Opa Fitz machte eine Pause. »Im Krieg waren wir als Marinetaucher auf Kephalonia stationiert. Das ist in Griechenland. Während eines Routinetauchgangs ist er verlorengegangen. Ich hab ihn nie wiedergesehen. Kurze Zeit darauf traf ich eine Unbekannte, deine Großmutter, sie saß neben mir in der S-Bahn, ich dachte, die hätte Gerd gefallen, und fragte nach ihrer Adresse. Als wir uns trafen, erzählte ich ihr von ihm. So lernten wir uns kennen, über ihn gewissermaßen, und dadurch, dass ich von ihm erzählte. Für Gerd gibt es kein Grabmal. Es gab eine Tafel, die hab ich an unserem Geburtshaus für ihn angebracht, aber man hat sie wieder abgenommen. Also komm ich stattdessen hierher. Mir gefällt die Idee, dass meinen Erinnerungen ein Platz gehört. Dieser hier ist für Gerd. Er liebte Aussichten, war eigentlich nicht der Mensch fürs Meer. Er ist zur Marine, weil ich zur Marine bin. Er liebte die Berge. Über den Wolken, den Sternen nah, wenn der Sauerstoff knapp wird, ganz oben auf einem Gipfel, man schließt die Augen, und der Moment, der einen ausfüllt, währt ewig. Davon sprach er. Ich glaube, dort in der Höhe fühlte er sich am wohlsten. Er wollte sie mir zeigen, die Berge, nach dem Krieg.« Opa Fitz räusperte sich. »Das Leben kann jederzeit ins Nichts abrutschen.« Anton und Tobias verstanden nicht, worüber Opa Fitz redete, aber sie merkten, dass er anders als sonst seine Sätze zögernd und schleppend aussprach und seine Augen nass waren. »Pipi im Auge«, nannte das Opa Fitz, wenn Anton mal wieder das Heulen kriegte. Wie die traurige Schnecke aus dem Kinderbuch sah er jetzt aus, die er ihnen manchmal zur Belustigung vorspielte, dachte Tobias. Dazu kniff Opa Fitz kurzsichtig die Augen zusammen, zog den Kopf zwischen die Schultern, als würde er einschrumpeln, und lispelte: »Iss bin die Sssnecke Ottokar und fressse nur Sssalat« oder: »Iss bin die Sssnecke Ottokar und sssuche mein Häussschen, hat irgendwer mein Häussschen gesssehen?« Anton und Tobias waren seltsam berührt. Sie schauten über die trostlose Leere des Potsdamer Platzes nach drüben. »Ach, dieses furchtbare Erwachsenengerede, nicht?«, rief Opa Fitz und fuhr sich mit den Handballen übers Gesicht, eine entschlossene Bewegung, von innen nach außen, mehr Geste als ein tatsächliches Trockenwischen, ein Zeichen, weg mit dem Kummer, weg! »Will jemand 'ne Currywurst?« Er gab den Kindern einen Zehn-Mark-Schein. »Für mich auch eine, extrascharf bitte!« Als die beiden die Holztreppe hinunterkletterten, lehnte sich Opa Fitz über die Brüstung und sprach in den Wind: »Ich hab das, was du hättest haben wollen. Die Frau, die du hättest lieben wollen, die Reisen, die du hättest machen wollen, das Leben, das du hättest führen wollen. Ich fühle mich, als hätte ich's dir weggenommen!«
Am selben Nachmittag starben Nscho-tschi und Intschu-tschuna – unter der flimmernden Sonne der Prärie. Opa Fitz saß neben Anton und Tobias vorm Fernseher. Das flackernde Licht spiegelte sich in ihren Augen, die sie vor Schreck und Entsetzen weit aufrissen. Angespannt verfolgten sie, wie die Lokomotive durch den Saloon dampfte und ihn komplett zerstörte, wie Old Shatterhand Winnetou vom Marterpfahl der Kiowas befreite, wie sie Blutsbrüder wurden und ihnen der fiese Santer auflauerte. Anton verstand nicht, warum Nscho-tschi, nachdem sie seinen Helden Old Shatterhand so aufopferungsvoll gepflegt hatte, sterben musste. »Warum?«, fragte er seinen Großvater, als er die Jungen zum Schlafengehen zudeckte. »Weil der Tod ungerecht ist, weil er immer Verlassenwerden und Zurückbleiben bedeutet«, sagte sein Großvater. »Einer bleibt immer zurück.«
An diesem Tag erzählte er ihnen keine weiteren Geschichten. Bevor er ging, öffnete er wie jeden Abend das indische Holzkistchen, das er von einer seiner Reisen aus Fernost mitgebracht hatte und das nun auf Antons Nachttisch stand. Außen war die Schachtel mit Messing verkleidet. Auf den Seitenflächen lauerten zwei zähnefletschende Tiger, vorne und hinten meditierte je ein Buddha im Lotussitz, und auf dem Deckel war eine heilige Zeremonie eingraviert, in Silber, mit Mönchen und Elefanten, vor exotischen Pagoden und Palmen. In der Mitte der Prozession, auf dicken Kissen gebettet, eine zierliche Prinzessin, festlich geschmückt und »wunderschön«, wie Anton fand, »die sieht fast so aus wie Nscho-tschi.« Daneben ihr Lakai.
»Wer ist das?«, wollte Anton wissen.
»Ihr Ziegenhirte.«
»Ich will auch Ziegenhirte sein!«
»Aber die Prinzessin hat's doch viel gemütlicher«, meinte Tobias.
»Was auch immer ihr wünscht! Haltet eure Münder beim Schlafen geschlossen, sonst entweicht euch ein Traum, und der gehört dann mir!« Damit tippte Opa Fitz auf die Box – ein eingespieltes Ritual. »Gute Nacht, meine Berliner Bären«, sagte er und löschte das Licht.
Träume
Antons Großmutter war fürs Essen und das ganze Drumherum zuständig. Dabei war Kochen eigentlich nicht ihre Passion. Aber das war Anton und Tobias egal, denn sie bereitete ihnen regelmäßig ihre Leibgerichte. Spaghetti mit Ketchup, Fischstäbchen mit Ketchup, Bratwurst mit Ketchup und zum Nachtisch grüne Götterspeise mit Vanillesauce von Reichelt. Antons Eltern fehlten bei fast allen Mahlzeiten. Antons Vater war ständig auf Dienstreise, seine Mutter beim Tennis, Reiten oder mit Freundinnen in der Stadt. Als Anton und Tobias sieben wurden, gab es ein Mittagessen, zu dem die ganze Familie zusammenkam. Offenbar hatte Antons Mutter dieses Gipfeltreffen sorgfältig geplant. Das gute Geschirr, frische Blumen, Sekt im Kühler. Sie nahm ihrem Mann das Jackett ab und lockerte den Knoten seiner Krawatte. »Ich muss gleich wieder los«, murrte er. Antons Großmutter verfolgte die Szene mit verkniffener Miene. Heute hatte ausnahmsweise ihre Tochter gekocht. »Das soll ein ganz besonderes Essen werden«, hatte sie gemeint.
»Aha«, Antons Großmutter tauchte hinter einem ihrer Wirtschaftsmagazine ab, »sind meine Mahlzeiten nicht besonders genug?«
»So, jetzt nehmt aber alle bittschön endlich Platz!«, drängelte Antons Mutter. Tobias glaubte einen Anflug von Gereiztheit in ihrer Stimme zu hören. Das allein wäre nichts Beunruhigendes gewesen, denn Antons Mutter klang schnell überspannt. Aber während des Essens wurde kein Wort gewechselt. Das Schweigen verhieß nichts Gutes, befand Tobias.
Zum Nachtisch eröffnete Antons Mutter ihrer Familie: »Mama geht jetzt wieder arbeiten! Beim Roten Kreuz. Eine Managementtätigkeit.«
»Eine was?«, fragte Anton.
»Etwas in der Organisation. Der Nachteil: Drei Tage die Woche werde ich in Genf sein müssen.«
Antons Vater gab seiner Frau einen Kuss auf die Stirn, sagte, wie stolz er auf sie sei, und entschuldigte sich, er habe noch einen wichtigen Termin, den Bau einer Brücke, die, wenn sie nicht professionell errichtet würde, Fußgänger und Autos unter sich begraben würde, sie verstünden sicherlich die Dringlichkeit. Und weg war er.
»Hast du mich nicht mehr lieb?«, fragte Anton seine Mutter.
»Aber natürlich, mein Schatz, wie kommst du denn darauf? Aber mich selbst, verstehst du, mich selbst mag ich nicht mehr so. Du kennst dieses gleichförmige Gefühl noch nicht, Aufstehen, Einatmen, Ausatmen, mit Glück nach dem ersten Kaffee aufs Klo und dann durch den Tag. Verstehst du?«
Anton schüttelte den Kopf.
»Dafür bist du noch zu klein. Nach einer Weile läuft dein Leben einfach so ab, und plötzlich stellst du fest, das Leben ist voller Selbstvorwürfe, voll von Selbstmitleid, Selbstzweifel, Selbstaufgabe, Selbstverrat, Selbstverleugnung; alles mit ›Selbst‹ vorneweg ist wie in deine Seele gebrannt. So auch bei mir.«
Tobias beschlich ein Unbehagen. Anders als sonst fühlte er sich heute wie ein Eindringling und wagte nicht, irgendjemanden der Familie Fitz anzuschauen, dabei verstand er genau, was hier vorging: Antons Mutter war dabei, endgültig unsichtbar zu werden.
Opa Fitz beschrieb mit seinem Glas Kreise auf der Tischplatte. Anton blickte zu seiner Großmutter. Die Haare ihrer Perücke begannen, nach allen Seiten zu wandern.
»Vor lauter Selbst Selbst Selbst hat mein Ich die Orientierung verloren.« Mit jedem »Selbst« wurde die Stimme von Antons Mutter schriller und die Haare seiner Großmutter wirrer und wilder. »Dein Vater, ja, der ist den ganzen Tag in seinem Architekturbüro, entwirft anderer Leute Träume und ...«, sie schaute auf die Tür, durch die ihr Mann gerade verschwunden war. »Aber jetzt bin ich mal dran! Orientierungslosigkeit ist eine große Chance, der erste Schritt zur Selbstfindung ...«
»Aber Mama«, unterbrach Anton, »dein Selbst-Dings fängt doch auch mit ›Selbst‹ an.« Und Antons Großmutter fügte hinzu: »Wenn du meinst, so deine Erfüllung zu finden ...«
»Großmama wird mittags für euch kochen«, beendete Antons Mutter die Familiensitzung, und Antons Großmutter räumte den Tisch ab: »Also, alles wie gehabt!«
Opa Fitz begleitete die Jungen mittwochs und freitags zum Fußballtraining, jeden Samstag zu den Turnieren. Schon damals verbrachte Anton die meiste Zeit auf der Ersatzbank, während Tobias seinem Traum nachjagte, Profi zu werden, übers Feld wirbelte, geduldig und zäh seine Gegner bedrängte, täuschte und um sie herumdribbelte. Anton gruselte sich vor seinem Freund, wenn er, in die gegnerische Mannschaft eingeteilt, Tobias auf sich zubolzen sah, sein Gesicht war dann wie eine Maske, wächsern und nicht zu lesen. Tobias stürmte vorwärts ohne Rücksicht auf Verluste, das Ziel immer vorm Auge. Opa Fitz jubelte von der Seitenlinie: »T-o-b-i-a-s vor, noch ein T-o-o-o-r!«, und Anton wünschte, lieber wieder auf der Bank zu sitzen. Fußball lag ihm nicht. Er hasste die Schnitte der Halme, das Hin-und-her-Gerenne, war zu langsam, um den Ball mit dem Fuß zu erwischen, zu klein, um ihn zu köpfen, außerdem tat das höllisch weh, jedes Mal wurde ihm dabei ganz schwarz vor Augen.
Sonst stand Tobias immer neben Anton. Hier nicht, nein, er bedrängte, attackierte ihn sogar, erbarmungslos, stieß ihn weg und umarmte, wenn er mal wieder ein Tor erzielte, nicht ihn, sondern die Jungs, die ihm die Vorlage gegeben hatten. Jaja, du blöder Angeber, dachte sich Anton, der in diesen Momenten einen tiefen Zorn verspürte.
Nach dem Training, auf dem Weg nach Hause, durfte Tobias vorne neben Opa Fitz sitzen. Anton las dann auf der Rückbank sein freitags neu erschienenes Mickymaus-Heft, zumindest tat er so. Tobias redete derweil wie ein Wasserfall – sonst brachte er kaum die Zähne auseinander –, feixte mit Opa Fitz, machte den Trainer nach, sehr schlecht, wie Anton fand, denn, wer von ihnen beiden konnte mit gespenstischer Genauigkeit Stimmen nachahmen? Na wohl kaum Tobias. Genau, das war ja wohl er, Anton. Ha! Und der Trainer war für ihn ein Leichtes, so durch die Nase sprechend und total krächzend. »Eine Kunst sondergleichen!«, nannte Opa Fitz Antons Begabung, aber offensichtlich nicht so bedeutend, wie ein bescheuertes Tor zu schießen. »Könnt ihr vielleicht ein bisschen leiser reden, ich kann mich nicht konzentrieren!«, brach es wütend aus Anton raus.
»Oh, Entschuldigung, der feine Herr ist am Studieren!«, meinte Opa Fitz lachend. Und Anton konnte durch den Rückspiegel genau erkennen, dass Tobias sich zwar nicht erdreistete, laut mitzuprusten – das wäre ja wohl noch schöner! –, er ein Schmunzeln aber nicht unterdrücken konnte. Tobias fand Antons mädchenhaftes Rumgestänkere anstrengend. Begriff er denn gar nicht, wie total peinlich er sich aufführte? Jeder in der Mannschaft hielt ihn für eine Lusche, die zu heulen anfing, sobald seine Schuhe dreckig wurden. Begriff er denn nicht, wie sehr Fußball seins war? Er, Tobias, machte doch schließlich auch bei Antons Verrücktheiten mit, meistens zumindest. »Ich finde«, sagte Tobias, »Fußball, das ist ein bisschen wie Fliegen.« Anton verdrehte die Augen.
Tobias liebte die Grasflecken an seiner Kleidung, die blutigen Knie, den Schorf danach, den er so gerne abpopelte, das Armehochreißen und In-die-Luft-Springen, das Jägerschnitzel mit Pommes im Clubhaus, die bunten Wimpel und die goldenen Pokale über der Theke, das Flutlicht im Herbst, das Geräusch des Leders, wenn es den Pfosten streifte und seinen Weg ins Netz fand, das Siegen. Beim Fußball fühlte er sich gemeinschaftlich verbunden und trotzdem gut mit sich.
Und so stürmte und kämpfte und konditionierte sich Tobias immer weiter, immer weiter nach vorne, vom Lehmplatz der C- über den Ascheplatz der B- bis aufs gepflegte Grün der A-Jugend, um nach dem Abitur ganze vier Spielzeiten lang rechts außen bei Hertha unter Vertrag zu stehen. Sein Traum. Dann grätschte ihm ein Schalke-Spieler mitten rein in die Knie, und die Karriere war vorbei. Er war gerade dreiundzwanzig.
Als die Drähte entfernt waren, verbrannten Tobias und Anton sein Trikot mit der Nummer 7, verteilten die schwelenden Reste über den Rasen, stampften die Asche ins Spielfeld und schauten zu, wie die Sprinkleranlage sie benässte und verschwinden ließ. »Vorbei«, sagte er mit demselben Gesichtsausdruck, mit dem er dem Ball hinterhergejagt war. Und dann bedankte er sich bei Anton, dass er der Zeremonie beigewohnt hatte. »Ich weiß, das hier ist nicht dein Ding. Aber alleine trauern ist Scheiße. Keine Beerdigungen mehr, versprochen? Am liebsten bliebe ich eines Tages meiner eigenen fern!«
Anton begegnete seinem Traum im Berliner Schillertheater. Seine Großeltern hatten ein Premierenabo. Minna von Barnhelm stand auf dem Programm, aber seine Großmutter meinte: »Herzchen, ich bin mir selbst Minna genug, tust du mir einen Gefallen und gehst an meiner statt?«
Anton war erst acht und hatte keine Ahnung, um was es in dem Stück ging, er war aber hin und weg. Er wusste nicht, worüber sich die Frau da vorne aufregte, wusste nicht, was das Gelaber und das seltsame Rumgemache auf der Bühne sollten, war ihm auch egal. Doch niemals in seinem Leben würde er vergessen, wie die Darstellerin der Minna diesem Soldaten, ziemlich blasser Typ, einen Ring entgegenhielt, den einen Fuß leicht ausgestellt vor den anderen, die Arme gestreckt, den einen nach oben rechts, den anderen nach unten links, als wollte sie den Raum ihrer Begegnung begrenzen, so offen, so verletzlich und dabei so voller Stärke und Stolz, dass er wünschte: Bitte, lieber Gott, lass mich auch einmal so werden. So tatsächlich, so wirklich, so wunderschön! In der Pause versuchte ihn sein Großvater zum Gehen zu überreden. »Burger King? Alles ist besser als das hier!«, aber Anton wollte nicht. Er konnte nicht erwarten, wieder Platz zu nehmen. Sein Großvater blieb im Foyer zurück, vertieft in ein Gespräch mit der Buffetdame. »Ihre Canapés sind exquisit und so liebevoll zubereitet mit der kleinen Kirsche obendrauf! Sie müssen ein ganz besonderes Händchen haben. Darf ich mal sehen?« Die Buffetdame giggelte, schenkte ihm einen verschämten Lady-Di-Augenaufschlag und reichte ihm ihre Hand. Opa Fitz beugte sich über diese und gab ihr einen Handkuss. »Darf ich Sie zu einem Glas Moët einladen?«
Anton war auch vom zweiten Teil wie hypnotisiert, und die Stunden vergingen wie im Flug. Es wurde dunkel. Der Schlussvorhang fiel, langsam, würdevoll, samtig rot und mächtig. Staub wirbelte auf. Ein Licht, das unter dem Vorhang hervorflimmerte, ein Luftzug, der ihm entgegenwehte wie ein Atem, dann sprang die Saalbeleuchtung an. Die Akteure traten vor den Vorhang. In einer Reihe standen sie nebeneinander. Sturzbäche von Schweiß liefen ihnen über ihre Gesichter und rissen das Make-up mit sich. Und sie strahlten. Die Zuschauer um Anton herum bewegten starr wie Puppen motorisch die Hände ineinander, weil man das eben so macht. Das ist doch kein Leben, dachte Anton. Hier unten sind alle gleich, so langweilig wie eine Armee Duracell-Hasen, aber da oben, da ist es brizzelig, flirrend und größer als groß.
Der Staub kitzelte in seiner Nase ... Er sog ihn in sich ein, diesen Geruch der trockenen Weite der Bühne, der ihm unter dem Vorhang entgegenkroch und so unendlich erschien, und ihm war klar, dass dieser Moment sein künftiges Leben bestimmen sollte. Das wusste er einfach. Ein ganz und gar sicheres Gefühl. Und auf sein Gefühl konnte er sich verlassen.
Zu Hause spielte er Tobias seine Lieblingsszenen vor, immer im Ausfallschritt der Minna von Barnhelm, den einen Fuß leicht ausgestellt vor den anderen, die Arme gestreckt, den einen nach oben rechts, den anderen nach unten links. »Ich bin die Minna«, sagte er und hielt Tobias einen Ring aus dem Kaugummiautomaten entgegen. »Hier, nehmen Sie, mein Herr!« Tobias bedankte sich höflich und meinte: »Aber Anton, du spielst ja eine Frau.« Anton hatte sich so sehr auf den Ausfallschritt konzentriert, dass ihm dieser wichtige Aspekt gar nicht von Bedeutung war.
»Das ist am Theater egal«, behauptete er einfach.
»Wirklich?«, fragte Tobias und wollte die Szene gleich noch einmal sehen.