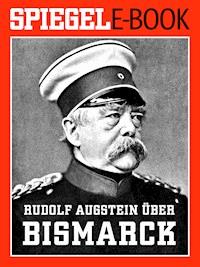Inhaltsverzeichnis
Rudolf Augstein über Bismarck
Vorwort
Auch ein verlorener Sohn
Doppelrezension der Bismarck-Biografien von Erich Eyck und Arnold Oskar Meyer (SPIEGEL 15/1950)
„Der gar nicht so rote Preuße“
Die neue Bismarck-Biografie von Lothar Gall „Der weiße Revolutionär“ – Teil 1 (SPIEGEL 37/1980)
„Der gar nicht so rote Preuße“
Die neue Bismarck-Biografie von Lothar Gall – Teil 2 (SPIEGEL 38/1980)
„Auf die schiefe Ebene zur Republik“
Warum Bismarcks Deutsches Reich auf Dauer nicht überleben konnte (SPIEGEL 2/1985)
„Nicht umsonst regiert man die Welt“
Das Bismarck-Bild des DDR-Historikers Ernst Engelberg (SPIEGEL 36/1985)
Von Friedrich zu Hitler?
Zum 200. Todestag Friedrich des Großen (SPIEGEL 32/1986)
„Ja, wenn Hitler nicht Hitler gewesen wäre“
Sebastian Haffners Buch „Von Bismarck zu Hitler“ (SPIEGEL 14/1988)
Das Reich in der Mitte Europas
Zum zweiten Band von Ernst Engelberts Bismarck-Biografie (SPIEGEL 36/1990)
„Von hint' derstessen“
Bismarck und sein bayerischer Gegenspieler König Ludwig II. (SPIEGEL 34/1995)
„Heros und Heulhuber“
Zum 100. Todestag der Preußen Bismarck und Fontane (SPIEGEL 28/1998)
Wo liegt Bismarck nun wirklich?
Kommentar zu Bismarcks historischer Größe (SPIEGEL 4/2001)
Rudolf Augstein am 8.7.1998
Rede zum 100. Todestag Bismarcks im Hamburger Rathaus
Rudolf Augstein über Bismarck • Vorwort
Einführung
„Der Reichsgründer Otto Fürst von Bismarck war ein kleinlicher, oft mieser Despot. Darüber muss man nicht diskutieren. Und dennoch ein großer Mann? Ja.“ Denn als „groß“ müssten diejenigen Menschen betrachtet werden, „ohne die eine ganze Epoche gar nicht vorstellbar, gar nicht denkbar ist“. Dieses Urteil Augsteins aus dem Jahre 2001 steht am Ende einer über 50-jährigen Auseinandersetzung des SPIEGEL-Herausgebers mit Bismarck.
Dabei galt es lange als ausgemacht, dass Augstein zu den Bismarck-Verehrern gehörte und in der Redaktion kursierte, wie Peter Merseburger erzählt, lange das Spottgerücht, er wallfahre an nationalen Feiertagen zum Grab seines Helden vor den Toren Hamburgs im Sachsenwald.
Wer sich der Mühe – oder dem Lese-Abenteuer – unterzieht und nachprüft, was Augstein zwischen 1950 und 2001 tatsächlich zu Bismarck geschrieben hat, kann diesem Urteil nur mit erheblichen Einschränkungen zustimmen. Das hat schon Merseburger festgestellt.
Richtig ist: Als Augstein sich im April 1950 in einer Titelgeschichte erstmals intensiv mit Bismarck auseinandersetzt, überwiegen Respekt und Anerkennung, vor allem für den Reichseiniger und Außenpolitiker. Darin, so Augstein, seien sich die Gelehrten einig: Es sei Kabinettspolitik alten Stils, „aber zu bewundern“.
Doch deckt Augstein bereits damals die Defizite einer autoritären, ja reaktionären Politik auf und erkennt in Bismarck einen „Repräsentanten einer nationalistisch überhitzten Flegelzeit der Deutschen“ und vor allem einen „eingeschworenen Verächter der Freiheit“.
Augsteins Kritik gilt dem Kulturkampf gegen die Katholiken, den Sozialistengesetzen, aber auch einer Sozialpolitik, die nicht daran dachte, die „Arbeitsverhältnisse selbst zu verbessern“.
Die Zerstörung der Nationalliberalen Partei kommentiert Augstein – von Ralf Dahrendorf der „letzte Nationalliberale“ genannt – relativ nüchtern: Diese sei nach Zustimmung zu den Sozialistengesetzen etc. ebenso „an ihrer eigenen Inkonsequenz kaputtgegangen wie am Fürsten Bismarck“.
Später schärft sich der kritische Blick auch in Bezug auf die Außenpolitik. Alle wesentlichen Fehler des wilhelminischen Kaiserreichs seien schon bei ihm angelegt, so der Tenor nun. Verwerflich auch die Mittel, mit denen Bismarck die Reichsgründung betrieben habe. Augstein (2001): „In meinen Augen war diese Politik konsequent und durchdacht. Waren die Mittel schurkisch? Ohne Zweifel ja.“
Dennoch behandelte Augstein den „Schwefelgelben“, wie er Bismarck mit den Worten Theodor Fontanes zum hundertsten Todestag tituliert hatte, stets mit einer gewissen Sympathie - und sei es für den Publizisten Bismarck. Augstein (2001): „Um wie viel wären wir ärmer, wenn wir die Briefe und Denkwürdigkeiten dieses großen Stilisten vermissen müssten“.
Wäre die Einigung der Deutschen (unter preußischer Vorherrschaft), wäre Bismarcks historische Größe, ohne skrupellose Macht- und Gewaltpolitik überhaupt möglich gewesen? Augstein bezweifelt dies: „Welcher großer Mann, wäre ohne Schurkereien ausgekommen?“ Ob solche Mittel angesichts ihrer Erfolge am Ende gar zu rechtfertigen seien, dazu spricht Augstein sich 1950 nicht eindeutig aus.
Erfolge? Seit 1950 hat Augstein Bismarck wiederholt in Schutz genommen, wenn jener als Wegbereiter für Hitler „herabgewürdigt“ wurde, wie es in jenen Jahren seitens der „alliierten Umerzieher“ häufig der Fall war. Augstein fordert, Bismarck müsse „nicht aus der Gegenwart, sondern aus seiner Zeit heraus“ begriffen werden.
Allerdings zeichnet Augstein in seiner zweiten Phase der Auseinandersetzung mit Bismarck, den 1980er Jahren, selber den Weg deutlich nach, der von Friedrich über Bismarck in die Katastrophe der Weltkriege führte. „Der Untergang“, so Augstein 1985, „begann nicht 1939, als der Diktator in seinen Krieg raste; er begann nicht 1933, als er die Macht an sich riß“. Er begann vielmehr, als es hieß: „Periculum in mora“ und „Bismarck muss her“. „Gefahr im Verzug“, denn es ging in Berlin um die preußische Heeresvorlage, um Königs- oder Parlamentsherrschaft.
Darf der Etat für die preußische Armee von der Finanzkontrolle durch das Parlament ausgenommen werden? König Wilhelm I. verlangt dies, das Parlament verweigert sich. Der König denkt an Rücktritt. In diesem Moment - im September 1982 - holt er Bismarck, den sein Vorgänger Friedrich Wilhelm IV. noch mit den Worten abgelehnt hatte: „nur zu gebrauchen, wenn das Bajonett schrankenlos waltet“.
Der neue Ministerpräsident macht seinem Ruf Ehre und verabschiedet den Etat ohne Zustimmung der Abgeordneten. Das ist gesetzwidrig, aber er kommt damit durch. Bismarck damals: „Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht“; „nicht durch Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut“.
1866 lässt er sich vom Parlament Absolution erteilen – die berühmte Indemnitätsvorlage. Augstein erklärte den Vorgang in einer launigen Rede wie folgt: „Ich, Bismarck, ich habe vier Jahre gegen die Verfassung regiert und alle, die das kritisiert haben, werden straffrei gestellt.“
„Von Friedrich zu Hitler“, mit der Zwischenstation „Bismarck“? „Es hat nicht so kommen müssen“, schreibt Augstein anlässlich des 200. Todestages des Alten Fritz, „aber dass es so kommen konnte“, das ergeben Augsteins Betrachtungen, hatte eben eine Geschichte, die über Bismarck führte.
Wohin also mit Bismarck, wo ruht er am besten? Kaiser Wilhelm II. wollte ihn mit Pomp im Berliner Dom bestatten lassen. Der 26-jährige Augstein hält es mit dem romantisch angefassten Fontane: ein Grab in freier Natur, tief im Sachsenwald: „Lärmt nicht so, hier unten liegt Bismarck, irgendwo“.
Rudolf Augstein über Bismarck • Auch ein verlorener Sohn
Auch ein verlorener Sohn
Warum ist trotz aller Bemühungen um Bismarck von 1898 bis 1948 keine einzige, wirklich befriedigende, wirklich moderne wissenschaftliche Bismarckbiographie zustande gekommen? Läßt sich das noch mit 'deutscher Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit' rechtfertigen?" Der Freiburger Geschichtsprofessor Gerhard Ritter sparte nicht mit Vorwürfen an die eigene Adresse und die seiner Zunftgenossen auf dem Münchener Historikertag im September 1949.
Ritter, Luther- und Stein-Biograph, griff nicht ohne Grund Bismarck heraus. „An dieser mächtigen Gestalt scheiden sich die Geister, und an ihrer Beurteilung hängt zuletzt alles, was die Historie an politischer Belehrung für unsere Zeit zu bieten hat“, schrieb er gleich nach dem Ende dieses Krieges.
Dabei ist es ihm klar, wie sehr gerade der Reichsgründer tatsächlich der Repräsentant einer nationalistisch überhitzten Flegelzeit der Deutschen war, mit Niederwald-Denkmal und Cherusker-Kult, mit Pickelhaube und den Keimen des irrealen Anspruchs, das Salz der Erde sein.
Aber er weiß auch, daß es vornehmlich die von ihrer Zeit angesteckten Historiker, etwa Sybel und Treitschke, waren, die das Bild des „Eisernen Kanzlers“ als eines fleischgewordenen Macchiavell, als eines eingeschworenen Verächters der Freiheit verherrlichten und verzerrten. Dieses Bild jedoch ist, so beansprucht Ritter, „eine reine Phantasiegestalt, der keine Wirklichkeit mehr entspricht“.
Ritter will es richtiggestellt wissen. Nicht allein um der historischen Wahrheit willen. Vielmehr: „Das nationale Selbstbewußtsein der Deutschen ist heute tief erschüttert – man wird es nicht zur Selbstverzweiflung treiben dürfen.“ Bismarck, der recht verstandene Bismarck, ist ihm der Mann, an dem sich das durch die nationale Katastrophe zerstörte deutsche Nationalgefühl wieder aufrichten kann.
Dabei ist es offensichtlich, daß Bismarck von den Deutschen der Hitler-Katastrophe keineswegs „recht verstanden“ wird, sondern daß er im Bewußtsein des Volkes als mythischer „Getreuer Eckehart“ fortdauert, unter dem „all das nicht hätte passieren können“, wenn seine Politik nämlich so unzerstörbar gewesen wäre wie die Legende um ihn.
Ebenso falsch beurteilten ihn die Umerzieher, als sie es unternahmen, noch den toten Bismarck gleichsam vor eine Spruchkammer zu ziehen, um ihn hier für den 1. und 2. Weltkrieg und für alles sonstige Unglück Europas verantwortlich zu machen.
Noch nicht zu haben. Zur Zeit der Münchener Historiker-Tagung lagen zwei vollständige deutsche Biographien des Reichsgründers bereits fertig vor. Aber das wichtigere, modernere der beiden Werke ist in deutschen Buchhandlungen jetzt noch nicht zu haben.
Es erschien während des Krieges, wenn auch nicht in Deutschland, so doch in der Schweiz, in deutscher Sprache und von einem deutschen Verfasser. Allerdings gehört ihr Autor, Erich Eyck, im engeren Sinn nicht der Zunft der Fachgelehrten an. Der einstige Rechtsanwalt am Berliner Kammergericht verließ 1937 aus rassischen Gründen Deutschland und lebt seither im Londoner Exil. Aber Monographien über „Die Monarchie Wilhelms II.“, über Gladstone, über „Die Pitts und die Fox“ erwiesen seine historische Begabung. Sein sehr umfangreiches Bismarckwerk – drei Bände mit insgesamt 1996 Seiten – macht ihn vollends zunftgerecht.
Die zweite neue Biographie wurde ebenfalls während des Krieges geschrieben. Im September 1943 konnte Arnold Oskar Meyer, zuletzt Ordinarius für mittlere und neuere Geschichte an der Berliner Universität, sie vollenden. Sie ist erst jetzt erschienen.
Beide Verfasser kommen noch aus der Bismarckzeit. A. O. Meyer, geboren 1877, rühmt sich sogar einer persönlichen Begegnung mit dem Altreichskanzler. Im Sommer 1897 bei einer Ausfahrt des Alten aus dem Sachsenwalde „begegnete sein Blick dem meinen“.
Solch leibhaftiges Zusammentreffen mit seinem Helden kann Erich Eyck, geboren 1878, nicht melden. Ob er es gesucht hätte, darf zweifelhaft erscheinen.
Beide Autoren sind Nachfahren des liberalen deutschen Bürgertums des 19. Jahrhunderts. Meyer, Sohn eines Breslauer Physikprofessors, exerziert in sich noch einmal die Wandlung nach, die die deutschen Liberalen zwischen 1850 und 1890 durchgemacht haben. Aus erbitterten Gegnern des „reaktionären Junkers“ Bismarck wurden sie mit und nach 1866 zu den eigentlichen Trägern seiner Reichspolitik.
Folgerichtig geistert noch durch Meyers Buch der „eiserne Kanzler“, die „hünenhafte Reckengestalt“, der „rechte Held aus der Schlacht“. Er sieht in den Augen des Kanzlers die „urgermanische Kampfesfreude“ blitzen. Er vergleicht ihn dem „Riesen aus nordischer Urzeit“, der „in heldischem Wagemut alles an alles setzt“. Meyers Bismarck ist entschieden zu eisern.
Eyck, Sproß einer Kaufmannsfamilie, bleibt Liberaler, gerade auch als Bismarckbiograph. Der radikale Demokrat, der einst in Berlin die juristische Beilage der Vossischen Zeitung redigierte, macht sich, hundert Jahre später, zum Fürsprech seiner liberalen Gesinnungsgenossen aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Er will ihre Vorbehalte, ihren Widerstand rechtfertigen, ihr Scheitern erklären. Der Jurist sieht in Bismarck den Mann, der den Grundsatz des Rechts im Staats- und Volksleben unterhöhlt hat. Er will beweisen, daß die nationale Einigung Deutschlands auch ohne Gewaltpolitik möglich gewesen wäre.
Zurück in den Bücherschrank. Beide Autoren haben in Hans Rothfels den gleichen sachkundigen Kritiker gefunden. Der jüdische Gelehrte hat das Buch von Meyer – der Verfasser starb im Juni 1944 an den Folgen eines Unfalls – eingeleitet und herausgegeben. Schon vorher veröffentlichte er die erste umfassende Besprechung von Eycks Werk.
Zum Münchener Historikertag war Rothfels aus Chikago herübergekommen. Dort lehrt er, seit er 1934 von seinem Königsberger Lehrstuhl auf eine Weise davongejagt war, die ihn nur ehren konnte.
Rothfels nun kam aus Amerika. Als er sein Referat „Bismarck und das neunzehnte Jahrhundert“ beendet hatte, folgerten die Zuhörer übereinstimmend, jetzt könnte jeder Deutsche sein Bismarckbild wieder beruhigt an die Wand hängen und die „Gedanken und Erinnerungen“ in den Bücherschrank zurückstellen.
Dabei hatte der Zwangs-Amerikaner Rothfels nichts anderes getan, als die Kritik an Bismarck auf das rechte Maß zurückzuschrauben. Er forderte, den Reichsgründer nicht aus der Gegenwart, sondern aus seiner Zeit herauszubegreifen. Für ihn ist Bismarck der Mann, der Fehler und Vorzüge der klassischen Diplomatie in ihren Extremen vereinigt, der Repräsentant der alten aristokratischen Oberschicht Europas, die sich nur im 19. Jahrhundert noch einmal voll ausleben konnte.
Solche Schau bewahrt nach Rothfels den Altreichskanzler davor, zum „Wegbereiter des Dritten Reiches“ herabgewürdigt zu werden, was nicht nur Mr. Teitelbaum, der Chef der hessischen Entnazifizierung, unternommen hat. Rothfels: „Hitler hat in fast jeder Beziehung das ausgeführt, was zu tun der Gründer des Reiches sich weigerte.“
Während seines Deutschland-Besuches übernahm es Rothfels, Meyers nachgelassenes Werk herauszugeben. Er tat es nicht nur aus Gründen der Pietät, sondern um des „Prinzips freier und vielfältiger Diskussion“, also mit Vorbehalten.
Er hat seine Bedenken offen ausgesprochen: „Diese Bismarck-Biographie hätte sehr wohl vor 1933 geschrieben werden können ... Das Buch ist völlig frei von Verbeugungen gegenüber dem Hitler-Regime, es ist männlich-kompromißlos ... Aber es ist auch unberührt von den Erschütterungen und vertieften Fragestellungen einer deutschen und einer europäischen Krise ersten Ranges.“
Warum ist es dann überhaupt erst noch erschienen? haben andere Kritiker gefragt. Weil es selbst bereits „Quelle“ im geschichtswissenschaftlichen Sinne ist, weil es das Bismarck-Bild einer vergangenen Zeit widerspiegelt, ist Rothfels' Antwort.
Eycks Werk hingegen nennt Rothfels „in vielen Beziehungen ein zeitgemäßes Buch, besser gesagt, eines, das längst überfällig war.“ Dafür aber distanziert er sich um so deutlicher von Eycks bewußter Einseitigkeit. Für Rothfels ist es nur eine „Hypothese“, daß Deutschland durch weniger gewaltsame Mittel als die von Bismarck angewandten hätte geeinigt werden können. Und er hält es gar für einen „endgültigen Rückschritt“, wenn Eyck Bismarcks Freiheit von ideologischer Voreingenommenheit und seine Selbstbeschränkung nach dem Sieg weitgehend übersieht.
So bleibt Bismarck umstritten, wie alle Täter der modernen abendländischen Geschichte. Dabei hat seine „überragende, rätselhafte Figur zweifellos an Aktualität gewonnen“. Denn er ist „verantwortlich für die entscheidenden Wandlungen, denen Europa ... im 19. Jahrhundert unterworfen war“ (Rothfels).
Aber ob er nur das bewirkte, was seine Zeit forderte, oder ob er dem Verhängnis des 20. Jahrhunderts darüber hinaus den Weg bereitete, für diese Frage gibt es keine verbindliche Antwort. Sie wird weiter nach Geschmack und Ressentiment entschieden werden, und man kann nur versuchen, aus dem Leben dieses nach Eyck „interessantesten Menschen seiner Zeit“ das Abbild einer geschichtlichen Persönlichkeit zu entwerfen.
Achilles, der Unverwundbare. Da ist zunächst der übermütige Korpsstudent, der mit einer mächtigen Dogge den alten Wachtturm auf dem Göttinger Wall bezieht. Der in 28 Mensuren als „Achilles, der Unverwundbare“ nur ein einziges Mal auf der linken Oberlippe eine leichte Schramme davongekriegt und so viele Schulden macht, daß der Vater, der Rittergutsbesitzer Ferdinand von Bismarck, auf dem sächsischen Schönhausen und den pommerschen Gütern Kniephof, Külz und Jarchelin, noch Jahre daran zu knabbern hat.
Der Hörsaal sieht ihn nicht oft. Aus dem Referendarexamen geht er nach drei weiteren Berliner Semestern trotzdem mit der Zensur „Sehr gut befähigt“ hervor.
Da ist der Regierungsreferendar, der „nie Vorgesetzte vertragen“ kann. Den, wie er voraussagt, „der längste Titel und der breiteste Orden ... schwerlich entschädigen wird für die körperlich und geistig eingeschrumpfte Brust, welche das Resultat dieses Lebens sein wird“. Der drei Monate ohne Urlaub und ohne Nachricht dem Amt fernbleibt und einer „jungen Brittin von blondem Haar und seltener Schönheit“ bis in die Schweiz nachreist.
Nach drei vergeblichen Beamtenversuchen in Aachen und in Potsdam, geht der gescheiterte preußische Regierungsreferendar zurück auf seine ostelbischen Güter, um nach Junkerart Landwirt zu werden. „Ich will Musik machen, wie ich sie für gut erkenne, oder gar keine.“
Der gelangweilte Großagrarier wird der „tolle Bismarck“. Noch Jahrzehnte später geht in Hinterpommern, wo er jetzt auf Kniephof sitzt, die Sage um von seinen Ritten bei Tag und bei Nacht und von seinen Gelagen, bei denen er seine „Gäste mit freundlicher Kaltblütigkeit unter den Tisch trinkt“. Schwere Stürze von Roß und Mann sind bezeugt, und auch die Pistole spielt nicht nur bei Ehrenhändeln ihre Rolle.
Den Müttern auf den umliegenden Gutshöfen gruselt es, wenn sie von dem unheimlichen Standesgenossen heimlich wispern, und für die Töchter gilt es geradezu kompromittierend, Herrn von Bismarck zum Tischherrn zu haben.
Dabei ist der Kavalier im blauen oder schwarzen Leibrock oder im grünen Frack der meistgesuchte Gesellschafter, er weiß hinreißend zu erzählen. Mit beißendem Spott zieht er über die „Krautjunker“ her, und auf die Frage nach seinem Befinden antwortet er ernsthaft, indem er sein Leben mit seinem Viehbestand gleichsetzt: „Danke gut, nur habe ich leider im Winter stark die Räude gehabt“.
Da ist schon der Skeptizismus. In ganz persönlichen Briefen gesteht er, wie leer er innerlich ist. Er kann nichts mehr glauben, seit seinem 17. Lebensjahr hat er das Beten verlernt.
Da ist es ein junges Mädchen, Marie von Thadden, die Tochter Adolf von Thaddens auf Trieglaff, des Oberhauptes der pommerschen Pietisten, die ihm den Rückweg zum Glauben ebnet. Als sie, die inzwischen die Frau von Bismarcks Schulfreund Moritz von Blanckenburg geworden ist, tödlich erkrankt und bald stirbt, ringt sich zum ersten Male wieder von Bismarcks Seele ein Gebet los. „Gott hat mein damaliges Gebet nicht erhört“, hat er im Dezember 1846 in seinem großartigen Braut-Werbebrief gestanden, „aber er hat es auch nicht verworfen, denn ich habe die Fähigkeit, ihn zu bitten, nicht wieder verloren“.
Was Marie von Thadden in Bismarcks Herzen geweckt, hat ihre Freundin Johanna von Puttkamer vollends entfaltet.
Als der „tolle Junker“ das 23jährige pommersche Edelfräulein am 28. Juli 1847 vor dem Altar der Dorfkirche von Alt-Kolziglow heiratet, hat er mit der Lebensgefährtin auch „den Glauben an einen persönlichen Gott, an ein Jenseits und an die christliche Heilslehre wieder gewonnen“.
Er hat diesen Glauben nicht wieder verloren, er ist eine tragende Kraft auch seines politischen Lebens geblieben, und sei es in seiner Einbildung. Als „Gottes Soldat“ folgt er 1862 dem Ruf seines Königs. Nach dem Sieg über die Dänen wußte er nur von dem, „was Gottes Beistand Preußen wohlgethan hat“. Nach Königgrätz überraschte ihn ein Besucher, wie er in den „Losungen“ der Brüdergemeinde las. Nach Sedan sagte er im Tischgespräch zu seinen Mitarbeitern: „Wenn ich die wundervolle Basis der Religion nicht hätte, so würden Sie einen solchen Bundeskanzler gar nicht erlebt haben.“
Zu äußeren Ehren. Der Weg zu öffentlicher Wirksamkeit ist Bismarck nicht leicht geworden. Er wäre gern Landrat geworden. Sein älterer Bruder Bernhard wird es. Otto muß sich mit dem Deichhauptmann begnügen.
Den Aufstieg über die „Ochsentour“ hatte sich der verunglückte Referendar selbst verscherzt. Es blieb nur der parlamentarische Weg. Bismarck hat ihn bewußt ergriffen: „Konstitution unvermeidlich, auf diesem Weg zu äußeren Ehren“. „Konstitution“ – das ist die Umwandlung des königlichen „Gottesgnadentums“ in eine eingeschränkte Verantwortlichkeit der Krone vom Volkswillen.
Als er dann aber 1847 auf der Abgeordnetenbank des von Friedrich Wilhelm IV. notgedrungen einberufenen Landtags sitzt, übertrifft ihn keiner an schneidender Mißachtung des Parlaments. Er verneint den moralischen und rechtlichen Anspruch der Preußen auf Verfassung und Volksvertretung. Wenn dann der empörte Sturm gegen ihn lostobt, dreht er der Versammlung den Rücken, zieht eine Zeitung aus der Tasche, bleibt aber auf der Tribüne und liest, bis der Sturm sich gelegt hat.
Hier ist er ganz Junker. Sein Platz ist auf der äußersten Rechten. Gegen alle Einwände verficht er das Recht des Königs. Nicht minder die Vorrechte seiner Adelskaste. Schon der Gedanke, den grundbesitzenden Adel zur Grundsteuer heranzuziehen, erscheint ihm wie ein Sakrileg. Daß die Bauern, ohne zu murren, den Wildschaden zu tragen haben, den die Sauen aus den Adels-Forsten in ihren Feldern anrichten, erscheint ihm selbstverständlich. Genau so selbstverständlich steht dem Junker auch die Gerichtshoheit über seine bäuerlichen Hintersassen, die Patrimonialgerichtsbarkeit, zu.
Über diese „vorsintflutlichen“ Anschauungen geht erst einmal die Revolution hinweg. In diesem Jahr 1848 ist Bismarck dauernd zwischen Berlin und Schönhausen unterwegs. Im März will er – reichlich naiv – seine Schönhauser Bauern bewaffnen und den König aus den Händen der Revolutionäre heraushauen.
Wenig später denkt er augenscheinlich daran, die Prinzessin Augusta, die Frau des Prinzen Wilhelm (des späteren Königs), und deren unmündigen Sohn Friedrich Wilhelm (den späteren Kaiser Friedrich) für eine Gegenrevolution zu benutzen. Augusta, die Weimarer Prinzessin, an deren Wiege noch Goethe stand, lehnt ab. Für sie war Bismarck seither der „Todfeind“.
Im preußischen Revolutionsparlament war kein Platz für Bismarck. Er kam erst wieder, als Friedrich Wilhelm seinem Lande seine Verfassung aufoktroyiert hatte. Da stand er in vorderster Linie und verteidigte des Königs Entschluß, die ihm von der Frankfurter Nationalversammlung angebotene Kaiserkrone abzulehnen.
Ein Jahr später steht er auf der Erfurter Parlamentsbühne. Friedrich Wilhelms kleindeutscher Unionsplan ist gescheitert, am Einspruch Österreichs. In Olmütz muß Preußen zu Kreuze kriechen. Das liberale Deutschland, das Einheit und Freiheit verlangt, schäumt. Bismarck verteidigt das schwarz-weiße Banner, den Hohenfriedberger Marsch. „Aber ich habe noch keinen preußischen Soldaten singen hören: 'Was ist des Deutschen Vaterland'.“
Es ist zum Verzweifeln mit diesem Erz-Junker unter allen Junkern. „Das große deutsche Vaterland muß auch einen verlorenen Sohn haben“, versucht der fortschrittliche Abgeordnete von Beckerath Bismarcks ständige Herausforderung abzutun.
Bis in die Vendée. In diesen turbulenten Parlamentsjahren hat Bismarck noch ein politisches Glaubensbekenntnis. Es ist das der Gerlach und Kleist-Retzow, der Alvensleben und Senfft-Pilsach, des „Vereins zur Wahrung der Interessen des Grundbesitzes“ und der „Kreuzzeitung“. In den Spalten des neuen Organs der Konservativen gefällt sich Bismarck bald in wüsten Ausfällen gegen alles, was nach Demokratie und Liberalismus riecht.
„Ich sehe die preußische Ehre darin, daß die Preußen vor allem sich von jeder schmachvollen Verbindung mit der Demokratie entfernt halten“, bekennt er in Erfurt. Nicht die deutsche Freiheit, sondern die Erhaltung Preußens steht im Zentrum seines politischen Denkens. Ja, er sinnt schon auf Eroberung. Das Hauptziel der Gewaltigen dieser Erde sei, ihr Herrschaftsgebiet zu erweitern, verblüfft er seine pommerschen Freunde 1842. Auch für Preußen werde die Stunde der Vergrößerung kommen.
Bald will der preußische Opportunist in der auswärtigen Politik – und um die geht es sein Leben lang – kein Recht anerkennen, sondern nur die Zweckmäßigkeit. Sein Vorbild ist der König Friedrich im Jahre des schlesischen Eroberungskrieges 1740. („Ich will meinen Namen mit goldenen Lettern in das Buch der Geschichte eintragen“, sagte der junge Fritz damals.)
Ludwig von Gerlach, Magdeburger Appellationsgerichtspräsident und Haupt der Kreuzzeitungspartei, ist entsetzt, als ihm der Schönhauser solche Gedanken enthüllt. Dem Legitimisten ist jede vertraglich gesetzte Grenze und jede Krone auf einem gefürsteten Haupte unverletzlich.
Über solche Bedenken ist Bismarck jetzt schon hinaus. „Ich bin meinem Fürsten treu bis in die Vendée*, aber gegen alle andern fühle ich in keinem Blutstropfen eine Spur von Verbindlichkeit, den Finger für sie aufzuheben“, wird er später schreiben.
(*Die Vendée war der Hochsitz der Royalisten im Kampf gegen die französische Revolution.)
Damit beginnt sich Bismarck schon von den Ultras unter den Konservativen abzusetzen. Später werden sie seine erbitterten Gegner werden.
Seit dem Vereinigten Landtag ist Bismarck in der preußischen Politik nicht mehr zu übersehen. In den Jahren der Revolution und Gegenrevolution verwandelt er sich zum Berufspolitiker. Er ist mehr in Berlin als in Schönhausen. Schließlich verpachtet er sein Stammgut. Er steht für den Auftrag seines Königs bereit.
Dieser Landwehrleutnant? Da kommt Leopold von Gerlach, dem Bruder Ludwigs und Generaladjutanten Friedrich Wilhelms IV., der Gedanke, Bismarck zum preußischen Bundestagsgesandten vorzuschlagen. Den Bundestag in Frankfurt, der im Märzsturm 1848 aufgeflogen war, wieder zu beschicken, hatte die preußische Regierung in Olmütz den Österreichern zugestanden.
„Dieser Landwehrleutnant soll Bundestagsgesandter werden?“ raunzt Prinz Wilhelm, des Königs Bruder und Nachfolger, „Dieser verdorbene Regierungsreferendar“ mokiert sich der bürokratische Karrieremann Ludwig von Gerlach.
Den unberechenbaren König aber kann Bismarck schneidig gewinnen: „Wenn Eure Majestät den Mut haben, zu befehlen, habe ich den Mut, zu gehorchen.“ Er wird ernannt. Er ist und bleibt der erste und einzige zunftfremde Parlamentarier, den Preußen als Gesandten ausschickte.
Acht Jahre bleibt Bismarck in Frankfurt. Im Alter hält er sie für die glücklichsten seines Lebens. Der 36jährige ist von fast unanständiger Gesundheit. In den Salons drängen sich die schönen Frauen um den glänzenden Kavalier, den hinreißenden Plauderer, den guten Tänzer.
Es sind die Jahre des Familienidylls. Zu der Tochter Marie stoßen die Söhne Herbert und Wilhelm (Taufpate: Prinz Wilhelm von Preußen). Frau Johanna, der erst vor der diplomatischen Welt graute und deren hinterpommersche, etwas verkniffene Züchtigkeit sich nie an das Dekolleté der schönen Frankfurterinnen gewöhnen konnte, gewinnt Freundinnen und Bewunderer. In diesen Jahren braucht sie noch nicht zu hassen, wie sie in späteren Zeiten alle Leute haßte, die ihrem guten Ottochen Böses zufügten. (Nach dem Waffenstillstand mit dem auf Drängen Bismarcks bombardierten Paris: „Viele tausend Brandbomben, Granaten, Mörser hätte ich gern noch hineingeschmissen, bis das verruchte Sodom ganz auf ewig ruiniert gewesen.“)
Du Hund. Bismarck ist als Verächter des Bundes nach Frankfurt gegangen. Am Ende der Frankfurter Tage ist er es mehr denn je. Er will Heinrich Heines Spottvers zum Nationallied der Deutschen machen:
O Bund,
Du Hund,
Du bist nicht gesund!
Aber die acht glücklichen Jahre in Frankfurt sind die Jahre der Entfaltung eines politischen Genies. Der neuernannte Gesandte hatte nie Diplomatie gelernt. Aus diesem Mangel macht er sorglich eine Tugend. Er ist offenherzig, wenn es ihm paßt, er ist rücksichtslos, wenn es ihm angezeigt erscheint, beides gegen die geheiligten Regeln der Diplomatie.
Kaum hat er seinen Gegenspieler dadurch verwirrt und beeindruckt, so verwandelt er seinen durchaus zweitrangigen Gesandtenposten in eine Schlüsselstellung seiner Politik. Immer wird er die Hebel da ansetzen, wo sie sich ihm bieten.
Am Bundestag, dem ständigen Gesandtenkongreß der souveränen deutschen Einzelstaaten des deutschen Bundes, spielt Preußen die zweite Geige. Der mittelalterlich verträumte König ist damit zufrieden. „Ich bin nicht der Erste in Deutschland, ich bin nicht der Dritte, ich bin der Zweite. Österreich steht obenan, und dann komme ich.“
Preußen war aber für den Junker und Gesandten Bismarck das gottgegebene Machtzentrum, von dem aus er eine Machtneuordnung in Mitteleuropa ins Werk setzen konnte. Dazu war es als erstes nötig, Österreich aus Deutschland herauszudrängen, ihm Schlappen beizubringen, es zu demütigen, den Bund zu komprimittieren, in dem es präsidierte.
Wenn der österreichische Vertreter in Hemdsärmeln dasitzt, zieht auch Bismarck seinen Rock aus. Raucht er, nimmt sich auch Bismarck eine Zigarre, und so fort die ganze Skala der Schikanen herunter, mit denen man die Stellung eines Präsidenten erschüttern kann wie mit ständigen Beschwerden, Protesten, Rückfragen, Vetos und sonstigen Querelen.
Daneben kann er es sich erlauben, Politik auf eigene Faust zu treiben. 1854 sucht er den russischen Gesandten für ein Bündnis zwischen Preußen, Rußland und Frankreich zu gewinnen. Er hat keinen Auftrag dazu, seine Regierung verhandelt gerade über eine Allianz mit dem Wiener Hof.
Ich bin preußisch. Im nächsten Jahr fährt er nach Paris. Die Weltausstellung dient als Vorwand. In Wirklichkeit beginnen seine in den nächsten Jahren immer wiederholten Sondierungen bei Napoleon III. Seinen Parteigenossen zu Hause graut es. Freundschaftliche Gespräche mit dem Usurpator – einem echt preußischen Legitimisten muß es grausen.
Über solche Bedenken kann Bismarck nur lachen. „Ich bin preußisch“, schreibt er dem besorgten Ludwig von Gerlach, der ihn wieder auf die Prinzipienpolitik des Kampfes gegen die Revolution zurückführen will. „Mein Ideal für auswärtige Politiker ist die Vorurteilsfreiheit, die Unabhängigkeit der Entschließungen von den Eindrücken der Abneigung und der Vorliebe für fremde Staaten und Regenten“.
Aber nicht nur Unbekümmertheit läßt ihn nach Paris gehen Schon der Bundestagsgesandte weiß sehr genau, warum er den Bonaparte hofiert Auf der Place de la Concorde im Herzen von Paris spricht er zu Prinz Heinrich VII. Reuß von der Unvermeidlichkeit des Krieges zwischen Preußen und Österreich. Dafür sieht er in die Zukunft, braucht er eines Tages Napoleon.
Noch ist es nicht so weit, daß er selbst Musik machen kann. Aber der Weg zeichnet sich ab, den er gehen wird. „Die deutsche Einheit will ein jeder, den man danach fragt, sobald er nur deutsch spricht.“ Bismarck will sie auch. Aber er will sie über Preußen, über ein stärkeres Preußen. Er sieht die Möglichkeiten, die ihm seiner Natur und seiner Herkunft nach offenstehen, und er nutzt sie. Das ist stets seine Stärke.
Noch in Frankfurt wird er sich klar, daß „Deutschland der beste Bundesgenosse ist, den Preußen finden kann“. Aber gerade darum gibt es für ihn „nichts Deutscheres, als gerade die Entwicklung richtig verstandener preußischer Partikularinteressen“.
Da beginnt die „Neue Aera“, die Wilhelm, seit Oktober 1858 Prinzregent für den geisteskranken Friedrich Wilhelm IV., hoffnungsvoll eröffnet. „In Deutschland muß Preußen moralische Eroberungen machen durch eine weise Gesetzgebung bei sich, durch Hebung aller sittlichen Elemente ... Die Welt muß wissen, daß Preußen überall das Recht zu schützen bereit ist.“ Das ist, im Sinne des Philosophen Hegel, das Programm des Regenten. Bismarcks Programm ist es nicht. Wilhelms, des „Kartätschenprinzen“, in Wahrheit, auch nicht. Aber Bismarck macht sich nichts vor.
Bismarck war dem Regenten und noch mehr seiner Frau Augusta unheimlich, außerdem war er als Anhänger der Bajonett-Politik zu sehr verschrien. Bismarck mußte als Gesandter nach Petersburg, wo er die Mentalität seiner späteren treuesten Bundesgenossen kennenlernen konnte. Auch seine treuesten Feinde von später beehrt er noch als Gesandter in Paris.
Nur die „bitterste Not“ seines Herrschers konnte Bismarck an die Macht bringen. Wilhelm, seit 1861 König, will die Armee reorganisieren. Das Abgeordnetenhaus soll die Mittel bewilligen. Die Kammer kommt dem Verlangen des Herrschers weit entgegen.
Da bricht über die Frage: zwei- oder dreijährige Dienstzeit der Konflikt aus. Dahinter steht das Problem: Soll die Armee, die neun Zehntel des gesamten bewilligungspflichtigen Etats beansprucht, von der Finanz-Kontrolle durch das Parlament ausgenommen werden. Der König verlangt das. Die Abgeordneten können es beim besten Willen nicht zugestehen.
Schon will der König abdanken. Er kann keine Minister finden, die energisch genug wären, gegen den Willen des Parlaments mit ihm zu gehen. Da holt der Kriegsminister Albrecht von Roon seinen Freund, den Gesandten Otto von Bismarck, aus Paris herbei.
Ach, bewahre. Seit 1848 steht Bismarck praktisch auf jeder Ministerliste. In den Revolutionstagen lehnt ihn Friedrich Wilhelm IV. ab: „Nur zu gebrauchen, wenn das Bajonett schrankenlos waltet.“ Zehn Jahre später weist der Prinzregent den Gedanken weit von sich: „Ich habe keine hohe Meinung von Bismarck“. Noch im März 1862 antwortet er dem Prinzen Hohenlohe, damaligem Ministerpräsidenten, als dieser wieder Bismarck vorschlägt: „Sie scherzen wohl? Ach, bewahre, der ist ja viel zu flatterhaft!“ Am 22. September des gleichen Jahres muß er ihn berufen.