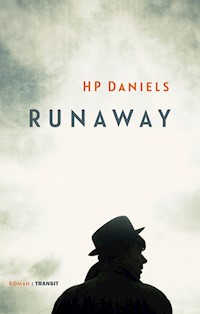
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Transit
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein atmosphärisch dichtes Road Movie über eine Jugend in den sechziger Jahren, über eine stachlige Zeit, die extrem autoritär war, aber auch Fenster aufstieß in ein neues, Freiheit versprechendes Lebensgefühl. Zwei Sechzehnjährige haben die Schnauze voll – von ihren tyrannischen Vätern, von ihrer autoritären, noch mit Nazis gespickten Schule, aber auch davon, dass sie nichts dagegen machen oder machen können. Eines Morgens ist Schluss. Sie packen wie immer ihre Schultaschen, treffen sich am Münchner Hauptbahnhof, kaufen Fahrkarten nach Hamburg und sind weg. Von Freunden haben sie eine Adresse in Hamburg bekommen, wo sie erstmal untertauchen können. Sie leben mal hier, mal da, kriechen bei Leuten unter, hocken mit jungen Rockmusikern und deren coolen Freundinnen zusammen, werden zu wilden Partys in sturmfreie Ham-burger Villen mitgenommen. Doch die Frage, was sie eigentlich anfangen wollen mit ihrer neuen Freiheit, wird immer drängender…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Für Johann
Wohin, ihr? – Nirgend hin. – Von wem davon? – Von allen!Bertolt Brecht, Die Liebenden
HP Daniels
RUNAWAY
© 2019 by : TRANSIT Buchverlag
Postfach 121111 | 10605 Berlin
www.transit-verlag.de
Umschlaggestaltung, unterVerwendung eines Fotos vonplainpicture/Tim Robinson,und Layout: Gudrun FröbaeISBN 978-3-88747-357-0
INHALT
Erster Teil
Zweiter Teil
Dritter Teil
ERSTER TEIL
1
– Jetzt erklär mir mal, was du dir dabei gedacht hast.
Was sollte ich sagen? Ich wusste es nicht. Jetzt nicht. Wusste gar nichts mehr …
– Erklär mir das.
Ich wusste es nicht mehr. Doch, eigentlich wusste ich es. Vielleicht doch.
Nur jetzt nicht in diesem Moment.
Vielleicht wollte ich es nicht erklären. Nicht erklären müssen.
– Was hast du dir dabei gedacht?
Ich schwieg.
– Erklär mir, warum du das gemacht hast.
Mir fiel nichts ein. Was sollte ich sagen? Der Kopf war leer. Das Gehirn, die Gedanken. Nichts mehr da. Kein Mut. Was sollte ich sagen? Wenn doch alles falsch wäre, was ich sagte. Ich konnte es nicht erklären. Ich schwieg.
– Antworte mir, wenn ich mit dir rede!
Der Ton wurde schärfer. Ungeduldiger.
– Warum hast du das gemacht? Erklärung!
Genau deswegen, dachte ich. Aber ich sagte es nicht. Schwieg.
Es war dieselbe Situation wie vorher. Es hatte sich nichts geändert. Es hatte nichts genützt. Ich saß wieder hier. Ich hatte verloren. Dieselbe Situation.
Er saß mir gegenüber. Groß, breit, mächtig, übermächtig. Und laut:
– Jetzt sag schon was!
Er sah mich drohend an. Ich wich seinem Blick aus. Brauchte einen Punkt jetzt. Einen festen Punkt. Aus dem ich Leere ziehen konnte. Leere in die Gedanken bringen. In die Gefühle. In diesen Augenblick. Jetzt nicht denken müssen. Nicht fühlen. Keine Antworten geben müssen. Keine Antworten waren immer noch besser als etwas zu sagen. Wenn ich etwas sagte, war es auf jeden Fall falsch. Und es gab Ärger. Sagte ich nichts, gab es auch Ärger, aber ich hatte wenigstens nichts Falsches gesagt, an dem sich noch mehr hätte entzünden können. So war es immer.
– Was ist jetzt? Ich warte: Was hast du als Erklärung vorzubringen? Ich frage noch einmal: Warum hast du das gemacht?
Er führte das Verhör. Er war Ankläger. Er war Richter. Alles in einem. Es gab keine Rechte. Keine Verteidigung. Keine Zeugen zu meinen Gunsten. Ich nahm mir das Recht zu schweigen.
– Jetzt rede endlich, wenn ich dich was frage!
Ich starrte auf die Blumen, auf dem Wohnzimmertisch zwischen uns. Immer stand hier ein Strauß frischer Blumen auf dem Tisch. Und noch einer im Bücherregal gegenüber. Neben der Encyclopedia Britannica. Diese ganze Bildungsscheiße, wie ich die manchmal hasste. Wenn es nur etwas mehr Leben dafür gegeben hätte. Mehr Wärme. Die klassische Scheißmusik. Die scheiß Klassik. Tonspur zur Bedrückung.
Mutter wollte, dass es schön ist. Stellte immer frische Blumen auf den Tisch. Und ins Regal. Jetzt Rosen: Rote und gelbe. Und deckte am Sonntag und an Geburtstagen den Tisch mit Meißner Porzellan.
– Du weißt gar nicht, was du deiner Mutter damit angetan hast. Meinst du nicht, dass du uns eine Erklärung schuldig bist?
Um meine Mutter tat es mir leid. Ihr wollte ich keinen Ärger machen, keine Sorgen. Eigentlich wollte ich niemandem Ärger machen. Oder Sorgen. Auch ihm nicht. Wollte nur weg. Weg von ihm. Raus hier. Luft zum Atmen. Keine Angst mehr. Wenn er sich morgens an den Frühstückstisch setzte. Mittags die Schritte im Treppenhaus, die mich im Gespräch mit der Mutter verstummen ließen. Dass er nichts davon hörte. Nichts hören sollte. Und ich schnell das Radio ausschaltete. Oder den Plattenspieler. Die Beatles. Die Stones. Die Kinks. Dass er nichts hörte davon. Panikartig. Denn das gab Ärger. Oder ich schnell die Gitarre beiseite legte. Weil es sonst auch wieder Theater gab. Wegen dieses Lärms. Hör auf damit. Mach was Anständiges. Und er anfing, mich Harmonielehre abzufragen. Kleine Terz. Große Terz. Die Töne im E-Dur-Akkord? Wie heißen die? Grundton E, und? Wie geht’s weiter? Und die parallele Moll dazu?
Wenn ich nicht sofort die Antwort wusste, schrie er mich an. Und ich musste ihm vorspielen, was ich für den Gitarrenunterricht geübt hatte. Bei der ersten Schludrigkeit unterbrach er:
– Nochmal von vorne, das war nichts!
Wenn ich dreimal denselben Fehler machte, schrie er mich an:
– Nochmal!
Und ich hatte Angst, dass er mich schlägt. Weil ich nicht richtig geübt hatte. Weil mich der Gitarrenunterricht anödete, und das Zeugs, das ich da spielen musste. Mit Fußbänkchen und steifer Körperhaltung. Volkslieder und klassischer Kram. Das war entsetzlich. Später hatte mir der Gitarrenlehrer ein Angebot gemacht: Ich sollte doch mal Noten mitbringen, von etwas, das ich gerne spielen wollte … Noten …
Irgendwo hatte ich Noten zu Yesterday aufgetrieben. Das machte etwas mehr Spaß, aber dann doch nicht so richtig. Weil es nicht nach Beatles klang. Mit Fußbänkchen und steifer Körperhaltung. Steif klang es. Nicht nach Beatles. So war’s auch mit Naggin’ Woman von den Kinks. Einer einfachen Blues-Nummer, die im Duo mit dem Gitarrenlehrer auch blöd klang. Irgendwann durfte ich den öden Gitarrenunterricht aufgeben. Dann fing ich an zu üben. Und es machte mir Spaß. Beat. Blues. Rock ’n’ Roll. Tonika. Subdominante. Tonika. Dominante. Subdominante. Tonika. Akkordschritte. Schritte des Blues.
Wenn ich Schritte im Treppenhaus hörte, hörte ich auf zu spielen. Sofort. Abrupt. Mitten im Lied. Er sollte es nicht hören. Sollte nicht sagen, ich solle sofort aufhören mit dem Krach. Get Off Of My Cloud. Ich wusste nicht, wie die einzelnen Noten der Akkorde hießen, aber ich konnte sie spielen.
Immer dann schaltete ich die Musik an, im Kopf, drehte voll auf, im Kopf, um alles da draußen zu übertönen. Mit der Musik im Kopf. Wenn der Vater mir gegenüber saß. Beim Mittagessen. Beim Abendessen. Wenn er mich verhörte:
– Was war heute in der Schule?
Wenn er sich aufregte, mich anschrie, dann drehte ich lauter: Die Musik im Kopf. Elektrische Gitarren, Bass, Schlagzeug, Gesang.
Hey, hey, you, you … get off of my cloud …
– Meinst du, du machst es besser dadurch, dass du jetzt hier schweigend rumsitzt und vor dich hinstarrst?
Es war wie vorher. Ich saß wieder hier. Der arme Sünder, der nichts zu sagen wusste. Keine Antworten. Schweigend. Dumm. Und leer. Ich hatte verloren. Ich war zurück. Es hatte sich nichts verändert. Und im Kopf drehte ich lauter: Die Musik. Kräftige Schlagzeugwirbel gegen den Schmerz. Getretene Bassdrum.
– Ich versuche mir doch nur vorzustellen, was in dir vorgegangen ist.
Jetzt also diese Tour. Die sanfte Tour. Eine neue Verhörmethode. Die kumpelhafte. Die verständnisvolle. Angeklagter, wir wollen doch nur Ihr Bestes. Seien Sie doch nicht so stur. Kooperieren Sie doch endlich.
– Ich versuche doch nur, eine Erklärung zu finden, warum du das gemacht hast?
Und er versuchte mir auch gleich eine Erklärung anzubieten, der ich zustimmen könnte, wenn ich doch nur nicht so verbockt wäre.
– War es das Abenteuer, das dich gereizt hat?
Was soll ich dazu sagen? Dazu kann ich nur schweigen. Abenteuer? Dieser Idiot. Ja, es war ein Abenteuer, vielleicht. Aber unfreiwillig. Es hat mich nicht gereizt. Eher aus Verzweiflung. Aus Angst. Aus Furcht. Nur raus. Aus der Enge. Weg. Von dem Gebrülle. Der Situation am Wohnzimmertisch. Dreimal täglich.
– Oder war das eine Schnapsidee vom Riemschneider? Hat der das ausgeheckt? War der das?
Hat der eine Ahnung. Wenn das jemand ausgeheckt hat, war ich das. Vielleicht war ich zu feige, die Sache alleine durchzuziehen. Den Plan auszuführen, der mir schon lange im Kopf rumgegangen war. Ich halt’s nicht mehr aus. Ich hau ab. Vielleicht wäre es leichter mit einem Leidensgenossen, einem Verbündeten.
Riemschneider. Leidensgenosse war Riemschneider ohne Zweifel. Oft genug hatte er mir erzählt, was für ein selbstherrlicher Despot sein Vater war. Wie er die Familie tyrannisierte. Riemschneider sprach davon in den Schulpausen. Und Mittwochabend, im Schwimmverein im Nordbad. Da hatte ich ihn vor Jahren mal gefragt, in der Umkleidekabine, und angesichts der älteren Männer unter den Duschen, die dort ihre, in unseren Augen riesigen Geschlechtsteile einseiften, ob er eigentlich wisse, wie das gehe, mit Männern und Frauen, dem Kinderkriegen und diesem ganzen Kram? Als ich es ihm erklärte, einfach, kurz und bündig, zwei Sätze, mehr nicht, schaute er mich ungläubig an:
– Nein!
– Doch, das haben deine Eltern auch gemacht. Sonst wärst du jetzt nicht hier. So einfach ist das.
Er schüttelte den Kopf. Ungläubig:
– Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass meine Eltern solche Säue sind!
Man konnte es sich wirklich schwer vorstellen: Riemschneiders Eltern, diese unterkühlten, gefühlsarmen, geschlechtslosen Wesen. Keine sympathischen Menschen.
In der riesigen, großbürgerlichen Altbauwohnung der Riemschneiders in der Maximilianstraße hing ein schaler Zigarrengeruch von Strenge und Patriarchat. Die Mutter war eine graue Hausfrau. Wahrscheinlich hatte sie nichts zu sagen. Auch nichts zur Verteidigung oder zum Schutz der Kinder. Dem größeren Bruder war das vermutlich egal. Er war Sänger in einer Beatband: The Hangmen. In seinem Zimmer hingen Fotos: Da war er auf der Bühne zu sehen, und wie ihm Mädchen aus dem Publikum das Hemd vom Leib rissen. Dafür hab ich ihn beneidet. Eine seiner Glanznummern war Do Wah Diddy Diddy von Manfred Mann. Und er war der erste an unserer Schule, der Jeans mit ausgestellten Hosenbeinen trug. Er hatte die äußere Naht seiner Levis-Jeans von unten bis zu den Knien hoch aufgeschnitten und einen riesigen Keil aus Jeansstoff eingenäht. Auch darum beneidete ich ihn. Er gehörte zu den Älteren, die wir bewunderten, zu den Lässigen. Er machte Abitur und zog von zu Hause aus. Noch etwas, worum wir ihn beneiden konnten. Er musste sich nicht mehr mit seinem Vater rumstreiten. Um Dinge, die vielleicht nur lächerlicher Kleinkram waren, uns aber so viel bedeuteten. Um die Musik, die Länge der Haare, die Weite der Jeans-Beine, die Enge der Hosen, die Leistungen in der Schule. Und die Uhrzeiten, wann wir zu Hause zu sein hatten. Es war wie ein Antrag bei einer Behörde, der zu stellen war. Eine Eingabe. Zum abendlichen Ausgang.
– Hilf mir, sagte Riemschneider, dann kann ich vielleicht länger rausschlagen.
Riemschneider klopfte. Wie an einer Amtsstube. Wir sahen uns schweigend an. Stille. Riemschneider klopfte noch einmal, etwas lauter. Wieder Stille. Abwarten.
Eine mürrische Knurrstimme von innen:
– Herein!
Riemschneiders Vater saß hinter einem monströsen Eichenschreibtisch.
Dunkel. Ehrfurchtsgebietend. Furcht einflößend.
– Was willst du?
Unterwürfig trug Riemschneider sein Anliegen vor:
– Wir wollen weggehen heute abend. Darf ich …?
– Um acht bist du wieder zu Hause. Ist das klar?
– Aber um acht geht diese Veranstaltung eigentlich erst los …
– Wie lang darf ER bleiben?
Der Vater sah mich streng an.
– Bis zehn.
Was tatsächlich stimmte. Zehn Uhr? Eigentlich war das auch ein Witz. Oder uns kam es zumindest so vor. Alle anderen durften länger. Nur wir waren immer die Idioten, die nach Hause mussten. Unglaublich peinlich, wenn man plötzlich sagen musste, tut mir leid, ich muss jetzt gehen, muss um zehn zu Hause sein. Sonst gibt’s Ärger mit meinem Alten. Haha, der Kleine muss nach Hause, sonst bekommt er Ärger. Ist das nicht niedlich?
– Wenn ER bis zehn darf, Vater Riemschneider sah mich missbilligend an, dann bist du spätestens um neun zu Hause.
Riemschneider verzog das Gesicht, biss sich auf die Unterlippe. Ich sah, wie ihm Tränen in die Augen stiegen. Aus Enttäuschung. Wut. Verzweiflung. Vater Riemschneider sah das auch, grinste selbstgefällig, und sagte:
– Ist das nicht fein?
Dem hätte ich am liebsten seinen dämlichen Schreibtisch umgeworfen. Für die Demütigung meines Freundes. Ich hab viel umgeworfen damals, in Gedanken, einigen Leuten in die Fresse gehauen. In Wirklichkeit blieb ich immer friedlich, ruhig und besonnen. Freundlich. Traute mich nichts. Hatte keinen Mut. Eher Angst.
– Deiner ist ja fast noch schlimmer als meiner.
Riemschneider war ein echter Leidensgenosse, Verbündeter.
Ich erklärte ihm meinen Plan:
– Ich hau ab. Ich halt das nicht mehr aus. Nicht mehr länger. Kommst du mit?
Riemschneider hatte seine Zweifel. Ich hab ihn bearbeitet. Hab ihn immer wieder gefragt, wie lange er sich das denn noch gefallen lassen wolle?
– Ich will nur wissen, ob dich der Riemschneider angestiftet hat? War das seine Idee?
– Nein, er hat mich nicht angestiftet. War nicht seine Idee.
Ich hatte ihm genau erklärt wie wir’s machen. Die Klamotten in die Schultaschen. Dass alles ganz normal aussieht. Und Geld für die Bahn. 40 Mark. Soviel hatte er. In irgendeiner Sparbüchse. Sie sollten uns nicht gleich an der nächsten Autobahnauffahrt beim Trampen erwischen. Bahn war sicherer.
– Habt ihr zusammen diese Schnapsidee entwickelt für ein kleines, leichtsinniges Abenteuer?
Was erwartet er für eine Antwort? Kleines, leichtsinniges Abenteuer? Was weiß der schon? Der hat doch keinen Schimmer. Was für eine Entscheidung das war. Wie schwer. Wie lange der Plan gereift war. Wie viele Zweifel es gekostet hatte. Wie viel Verzweiflung. Und jetzt saßen wir wieder hier. Ich am großen Esstisch mit den Blumen drauf. Rote und gelbe Rosen jetzt. Und Meißner Porzellan. Und der Riemschneider vielleicht vor dem großen Eichenschreibtisch, hinter dem sein Vater thront, und ihn verhört. Warum er das alles gemacht habe? Und ob ich ihn angestiftet hätte? Und dass jetzt andere Saiten aufgezogen würden …
Alles war umsonst. Schlimmer als vorher. Wir saßen wieder hier. Die armen Sünder. Die nicht einmal erklären konnten, warum sie das alles auf sich genommen hatten.
2
Wir trafen uns vor dem Tchibo an der Leopoldstraße. Die Schule hatte gerade angefangen. Viertel nach acht. Riemschneider hatte schwere Zweifel. Skrupel. Angst. Die musste ich ihm ausreden. Wir liefen über den Nikolaiplatz in den Englischen Garten. Ein kühler Morgen. Wir froren ein bisschen. Keine gute Voraussetzung. Aber warte erstmal, bis die Sonne rauskommt. Die kommt raus. Und dann wird das ein schöner Tag. Riemschneider maulte. Kleinlaut. Ob wir uns das nicht doch lieber noch mal anders überlegen sollten? Er zitterte ein bisschen.
– Auf gar keinen Fall. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Du wirst doch jetzt nicht im letzten Moment kneifen und schlappmachen? Ich spürte sein inneres Hin- und Hergerissensein zwischen seinem Wort, das er mir gegeben hatte: Wir machen das zusammen … und seinen Ängsten, seinem starken Gefühl, dass wir vielleicht doch lieber zur zweiten Stunde wieder in die Schule gehen sollten und den ganzen Plan abblasen.
– Du kannst ja wieder in die Schule gehen und dich da weiter tyrannisieren lassen. Und heute Mittag wieder nach Hause zu deinem Vater, um dich von dem weiter drangsalieren und erniedrigen lassen. Wenn du das willst, dann tu es. Wenn du zu feige bist, dann geh ich eben alleine.
Vielleicht war es gut, dass ich so auf Riemschneider einreden musste, um meinen klaren Standpunkt, meine eigene Entschlossenheit zu stärken. Auch ich hatte enorme Zweifel, ob das nun alles richtig war, starke Skrupel, vor allem wegen meiner Mutter. Und als ich so auf Riemenschneider einredete, in dem Versuch, ihn von unserer Sache zu überzeugen, überzeugte ich damit gleichzeitig auch mich selbst.
– Hey, sagte ich: Reinen Tisch macht mit dem Bedränger! Heer der Sklaven, wache auf! Ein Nichts zu sein tragt es nicht länger! Alles zu werden strömt zu Hauf!
Ich lachte.
– Hahaha, dein blöder Kommunismusscheiß, sagte Riemschneider. Komm mir bloß nicht mit diesem Quatsch.
Aber dann bewegte ihn doch die Treue zu seinem Wort, zu seiner Freundschaft, dem Versprechen, der Gedanke an die Zustände in seinem Elternhaus, alle Bedenken fahren zu lassen. Wir liefen zusammen zum Hauptbahnhof.
Jeder von uns kaufte eine Fahrkarte:
– Einmal nach Hamburg …
– Hin und zurück?
– Nein, einfach.
Niemand stellte weitere Fragen.
Auch im Zug nicht. München-Hamburg.
Wir saßen uns im Abteil gegenüber. Die Schultaschen auf der Gepäckablage über uns. Niemand wunderte sich. Zwei sechzehnjährige Schüler. Im Zug von München nach Hamburg. Mitten in der Woche. Keine Ferien. Keiner fragte. Wir grinsten uns an. Wir waren unterwegs. Weg. Abgehauen. Entfernten uns immer mehr. Kilometer. Fünfzig Kilometer. Hundert Kilometer. Hunderte.
Auch der Schaffner fragte nichts. Wollte nur die Fahrkarten sehen. Hatten wir. Die Fahrkarten waren in Ordnung. Das war die Hauptsache.
– Ich hab’s dir doch gesagt: Zug ist besser. An der Autobahn hätte uns vermutlich jetzt schon die erste Polizeikontrolle am Wickel. Und wir wären nicht mal aus München rausgekommen.
– Jetzt sag doch mal was. Was wolltest du in Hamburg? War es wegen dieses Mädchens? Hast du wegen ihr dieses ganze Theater veranstaltet? Oder wolltet ihr einfach was erleben? Auf der Reeperbahn? Oder doch nur dieses Mädchen? Aber da brauchtest du doch den Riemschneider nicht dabei, oder?
Was soll ich sagen? Was soll ich antworten?
Wenn andere Leute mit uns im Abteil saßen, haben wir nicht viel geredet. Niemand hat etwas gefragt. Wir haben gelesen. Der Schatz der Sierra Madre. B. Traven. Oder wir schrieben etwas in unsere Tagebücher. Das hatten wir uns vorgenommen, von Anfang an: alles aufzuschreiben. Ich hatte mir dafür ein dickes Heft gekauft, mit einem schwarzen Wachstuchumschlag. Ich holte meinen Füller aus der Tasche und schrieb:
Nein, ich wollte nicht weg. Wollte da nicht hin, wollte bleiben. Hier bleiben.
Riemschneider hatte auch ein Heft. In das er aber mehr kritzelte als schrieb. Kleine Skizzen. Bildchen. Autokarosserien.
Die Bewegung des Zuges hatte etwas Beruhigendes. Irgendwie ging es voran. Ganz von selber.
Riemschneider war noch nie aus Bayern rausgekommen. Höchstens mal Österreich, aber das zählte nicht. Die Fahrt war aufregend für ihn. Über die Donau. So weit war er noch nie gekommen. Über den Main. Gegen Riemschneider war ich Kosmopolit.
– Schau, die Elbe!
Riemschneider war fasziniert. Es gefiel ihm. Das Neue. Darüber vergaß er seine Bedenken. Die Gedanken an zu Hause. Ich vergaß sie auch. Über Riemschneiders Staunen.
3
Das also ist Hamburg. Und dass ich Riemschneider das jetzt zeigen konnte. Dass ich mich auskannte. Oder zumindest so tun konnte als ob.
Dammtor-Bahnhof steigen wir aus. Mit den Schultaschen. Wir sind in Hamburg. Bis hierher haben wir es schon mal geschafft. Immerhin. Ich zog den Zettel aus dem Notizbuch.
– Jetzt müssen wir nur noch diese Adresse finden: Von-Melle-Park 6. Wir müssen hier lang, Richtung Uni, dann fragen wir jemand. Komm, Riemschneider!
Wir gingen los, mit den Schultaschen, Richtung Uni. Von-Melle-Park. Da soll der SDS sein. Sozialistischer Deutscher Studentenbund.
Ich hatte die Adresse von einem Treffen bei der Münchener USG, Unabhängige Schülergemeinschaft, wo ich jede Woche hinging, zum Treffen der Unabhängigen Sozialistischen Schüler, in dieser alten Baracke in der Fallmerayerstraße, wo eigentlich die IDK – Internationale der Kriegsdienstverweigerer – ihre Zentrale hatte. Wo wir schwer diskutiert haben. Über alles Mögliche. Vietnamkrieg und so was. Und dass man den Kriegsdienst verweigern muss. Die Bundeswehr. Die Zustände an den Schulen. Die alten Nazi-Lehrer. Überhaupt: die alten Nazis. Richard, Chef der Kriegsdienstgegner, war schon etwas älter als wir. Ein kleiner dicker Bayer, bayerisch gemütlich und freundlich. Er leitete die Diskussionen. Und half uns beim Formulieren von Flugblättern. Die konnten wir auf der Handabzugsmaschine der IDK durchnudeln. Es roch nach Spiritus. Und es gab Bier für wenig Geld. Und Mädchen von den Mädchenschulen waren auch da. Ein bisschen wie im Jugendfreizeitheim. Aber besser. Und ernsthafter. Politischer. Denn das wussten wir: Alles ist politisch. Auch das Private. Alles.
Es waren auch einige Ältere da. Keine Spießer, eher Gammlertypen. Mit langen Haaren und wilden Klamotten. Zottelmäntel aus Afghanistan, die komisch rochen. Die müffelten. Eigentlich stanken sie. Nach Ziegenstall. Aber sie sahen toll aus. Ich hätte auch gerne so einen Afghanen-Zottel gehabt. Manche haben versucht, den Geruch mit einem anderen Geruch zu übertönen. Ich fand, dass der auch muffig roch, stank. Und ich dachte eine Weile, das wäre der Originalgeruch der Afghanenmäntel, aber es war ein Parfum, hatte mir mal ein Mädchen erklärt. Patchouli. Den Geruch bekam man jetzt überall in die Nase. Irgendwas Indisches. Oder sie trugen amerikanische Armee-Parkas mit riesigen Friedensrunen hinten drauf und so was. Einer von denen, die da auch immer rumliefen, war ein kleiner, lustiger Typ mit langen Haaren, der toll zeichnen konnte. Er zeichnete kleine Bildchen und Comics für die Flugblätter der IDK. In ein Fenster von seinem alten VW-Käfer hatte er eine Zeichnung gehängt: Lustige langhaarige Gammlerfiguren, die ein Gewehr zerbrechen.
– Ich will abhauen. Halte es nicht mehr aus. Hatte ich mal gesagt. Zu den älteren Gammlern. Hamburg. Vielleicht Holland. Ob sie was wüssten? Wo ich hin könnte? Wo ich eine Weile bleiben könnte? Sie hatten mir diese Adresse aufgeschrieben: Hamburg, Von-Melle-Park 6.
– Da ist im Keller der SDS. Da sagst du einfach, dass du aus München kommst, und einen schönen Gruß von mir. Da kannst du im Keller schlafen … das geht ganz bestimmt. Machen die. Sind ganz in Ordnung da.
Sie haben mir noch eine Adresse in Amsterdam auf den Zettel geschrieben: Und wen ich von wem grüßen sollte. Die Holländer hießen Zol und Geert und Scheel. Grüße von Christa, Stefan und Rolf.
Aber jetzt waren wir erstmal in Hamburg. Wir fanden die Adresse, so wie die Münchner sie beschrieben hatten: Ein großer Parkplatz vor dem Unigelände. Eine Toreinfahrt. Rechts eine Kellertreppe runter. Muffig. Kühl. Beton.
Ein winziger Raum, zugenebelt mit Zigarettenqualm und abgestandenem Bierdunst. Und jede Menge Leute wieselten herum. Redeten, rauchten, liefen durcheinander. Sortierten riesige Stapel Flugblätter. Andere saßen auf abgeranzten Sperrmüllmöbeln, debattierten energisch, schrieben. Etwas ganz Wichtiges schien gerade im Gange zu sein. Beim Hamburger SDS. Und jetzt kamen wir dazwischen. Zwei kleine Schüler aus München. Ich schämte mich ein bisschen, dass wir noch so jung waren. Und dass Riemschneider obendrein so verdammt brav und bürgerlich aussah.
– Wir sind aus München. Schüler von der USG, Unabhängige Schülergemeinschaft, kennt ihr die? Gehört zum Aktionszentrum Unabhängiger und Sozialistischer Schüler. AUSS. Wir sind abgehauen. Können wir hier pennen?
Ich fragte die Frau mit den wilden, langen schwarzen Haaren an der Flugblattabzugsmaschine. Es roch nach Spiritus und Afghanenmänteln. Nach Patchouli. Und Zigaretten. Roth-Händle.
Das Mädchen mit den langen Haaren trug staubige Bluejeans und ein schlabberiges, olivgrünes US-Armeehemd. Und um den Hals, an einem dünnen Lederband, baumelte ein untertassengroßes Kriegsgegnerzeichen aus Messing. Sah toll aus. Das hätte ich auch gerne gehabt.
– Können wir bei euch pennen?
– Genossen, könnt ihr mal kurz zuhören. Die beiden sind Schüler-Genossen aus München, abgehauen. Können die hier pennen?
Niemand schien etwas dagegen zu haben. Abgehauen. Und Genossen. Das reichte als Legitimation.
– Wenn sie uns bei den Aktionen unterstützen. In den nächsten Tagen, sagte einer … da können wir jeden einzelnen Genossen brauchen!
– Ich suche doch nur nach einer vernünftigen Erklärung für euer Verhalten. Oder wolltet ihr einfach nur rumgammeln? Oder protestieren? Was wolltet ihr? Die meisten von den SDS-Typen waren irgendwann nach Hause gegangen. Ein paar blieben über Nacht, schliefen hier. Saßen noch ein bisschen rum auf den alten Sofas und Sesseln, rauchten, tranken Bier, redeten. In einem kleinen Nebenraum stand ein Kasten Bier.
– Da könnt ihr euch ’ne Flasche rausnehmen, wenn ihr wollt. Spendenbüchse steht daneben!
Ich saß neben Riemschneider auf dem ramponierten Sofa, aus dem an einigen Stellen die Holzwolle quoll. Inkreisch war das Wort meiner Mutter dafür. Aber ich wollte jetzt nicht an meine Mutter denken. Bloß das nicht. Wir rauchten, Schwarzer Krauser, tranken Bier, Astra Urtyp, redeten. Unsere Schultaschen kamen uns albern vor. Wir waren hundemüde.
4
Am Morgen fühlten wir uns dreckig. Und müde. Immer noch. Wir hatten kaum geschlafen. Es war zu unbequem zu zweit auf dem schmalen Sofa. Die anderen Schlafplätze waren belegt. Ein weiteres Sofa, eine alte Matratze.
Und es gab noch den Bunker: Den Schlafplatz der Privilegierten. Derer, die hier schon länger wohnten, die sich vielleicht ein Vorrecht erarbeitet hatten durch Flugblätterverteilen, Parolen malen … oder einfach nur, weil sie von Jan bevorzugt wurden. Jan, der Bunkerchef, der eigentliche Bunkerbewohner, der hier offenbar das Sagen hatte, entschied, welche zwei Leute noch mit zu ihm in den Bunker durften. In ein kleines abgeteiltes Kabuff unter der Treppe, wo drei Matratzen über Eck lagen, wo man besser schlafen konnte, weil es dort wärmer war. Hier hatte Jan auch seine Klamotten. Und einen kleinen Plattenspieler. Ein paar Schallplatten. Jan schien das ganze Jahr im Bunker zu hausen. Permanenter Bewohner. Er hatte sich eingerichtet.
Ich hatte schlecht geschlafen, hatte gefroren in der Nacht. Fühlte mich elend. Aber vor Riemschneider wollte ich mir nichts anmerken lassen. Auch sonst nicht. Ich hatte das Ding ausgeheckt, geplant. Wir machen das jetzt weiter. Mussten weitermachen. Hatten keine Wahl. Es war kühl, die Sonne wärmte noch nicht.
– Gib mir doch mal eine Erklärung, dass ich es vielleicht auch verstehen kann. Wolltet ihr in Hamburg die große Weltrevolution vorantreiben? Gegen eure Eltern? Gegen die Lehrer? Gegen all die, die ich euch in so schrecklicher Knechtschaft halten?
In meinem Kopf summte es:
Reinen Tisch macht mit dem Bedränger, Heer der Sklaven wache auf. Ein Nichts zu sein tragt es nicht länger, alles zu werden strömt zuhauf … Völker hört die Signale!
Am Morgen kamen die SDS-Genossen zurück. Als ob es keine Unterbrechung gegeben hätte, wurde sofort weiter debattiert: Aktionen geplant, Listen aufgestellt, Flugblätter gedruckt. Auch die Frau mit den langen Haaren und dem Atomgegnerzeichen war wieder da.
– Wenn ihr da rüber geht, über den Parkplatz, sagte sie, gleich auf der anderen Straßenseite ist ein kleines Café, so ein Imbiss, da könnt ihr euch aufs Klo schleichen, und euch waschen, wenn ihr wollt.
Im SDS-Keller gab es weder Toilette noch Wasser.
Später sagte sie:
– Kommt mit, wir fahren in die Schulen, Agitation machen, das ist doch was für euch, da könnt ihr uns helfen.
Mit einigen Genossen und mit wehenden Haaren saßen wir auf der offenen Ladefläche eines Lastwagens und fuhren durch Hamburg. Auf dem Weg zu irgendwelchen Gymnasien, die Genossen hatten einen genauen Zeitplan ausgearbeitet: Erste Pause hier, zweite Pause dort. Und welche Schulen wann Schluss hatten, auch davon gab es einen Plan. Wir fuhren auf die Schulhöfe, sprangen von der Ladefläche, verteilten Flugblätter:
Verhindert die Notstandsgesetze!
Und dass das auch die Schüler angehe: Dieser Versuch der Bundesregierung, die Demokratie außer Kraft zu setzen.
– Die Notstandsgesetze sind so etwas ähnliches wie die Ermächtigungsgesetze der Nazis. Sagten sie.
Den meisten Schülern gefiel die Aktion, endlich was los, in der Schule, auf dem Schulhof, in der Pause. Und sie solidarisierten sich mit uns. Ich dachte an die Geschichten, die ich gehört hatte, von langhaarigen Gammlern am Münchner Monopteros im Englischen Garten, die erzählt hatten, dass viele von den Gymnasiastinnen total auf Gammler stünden. Langhaarige Typen. Und dass diese Mädchen ihnen immer die Pausenbrote schenkten. Und dass sie nach der Schule mit ihnen rumknutschten im Englischen Garten.
In Hamburg boten uns keine Mädchen Pausenbrote an. Oder wollten mit uns knutschen. Ich hatte Hunger. Fühlte mich verlassen. Ich dachte an Lina, die ja auch Hamburgerin war, und die mir besser gefallen hatte als die meisten Mädchen in München. Warum hatte ich Lina eigentlich noch nicht angerufen? Warum hatte ich das nicht als erstes getan?
Die SDS-Genossin trötete in ihr Megaphon.
– Wir dürfen den Abbau der demokratischen Grundrechte nicht zulassen!
Schließt euch an! Schließt euch unseren Protesten und Aktionen an!
Wir fuhren von Schule zu Schule. Mit unseren Plakaten, Parolen und Megaphonen. Und unserem glühenden Eifer. Bei Riemschneider war ich mir nicht so sicher. Er glühte weniger.
Manche Schuldirektoren riefen die Polizei. Doch wir waren weg, bevor sie uns schnappen konnten. Das wiederum fand Riemschneider lustig, aufregend, verwegen. Da glühte er dann auch ein bisschen mit.
– Haha, die Bullen …
Da benutzte er den Ausdruck: Die Bullen. Was eigentlich nicht zu ihm passte.
Auch nachts im Keller, wenn die meisten Genossen schon wieder weg waren, und plötzlich einer eine Idee hatte:
– Kommt, wir machen noch eine schnelle Aktion. Auf dem Campus.
Ich hörte das Wort zum ersten Mal: Campus. Was ist das?
– Wir malen was aufs Audimax. Habt ihr Lust?
Audimax, das Wort kannte ich. Aus München. Von der Uni. Das war so was wie die Aula der Studenten. Audimax.
Dann sind wir los, mitten in der Nacht, mit Farbeimern und Pinseln. Kleister und Plakaten. Die ganze Front vom Audimax haben wir voll gepinselt. Oder zugekleistert:
Widerstand gegen die Notstandsgesetze!
Oder Plakate an die Staatsbibliothek geklebt:
Treibt Bonn den Notstand aus!
Und immer, wenn die Polizei kam, waren wir schon weg. Immer waren wir schneller. Die Polizei schien ziemlich dämlich zu sein. Manchmal, wenn die Polizei weg war, sind wir wieder los. Noch ’ne Runde.
– Ist wie bei Mao, sagte einer. Taktik des Guerillakrieges: Ist der Feind stark, ziehen wir uns zurück. Zieht sich der Feind zurück, schlagen wir zu!
Also sind wir noch mal los. Mit Farbeimern, Pinseln, Plakaten. Fühlten uns revolutionär.
Wir hätten sowieso nicht schlafen können, im Keller, weil es so kalt war.
Da tat uns ein bisschen Bewegung ganz gut. Ein bisschen Aufregung. Action.
Trotzdem fühlten wir uns Tag für Tag dreckiger, hungriger, müder, verlorener, und hätten gerne mal wieder eine Badewanne gesehen.
5
Wir verteilten Flugblätter auf der großen Fußgängerbrücke hinterm Dammtorbahnhof. Einige Passanten sahen uns feindselig an: Gammlerpack! Lasst euch mal die Haare schneiden! Hitler hätte mit euch kurzen Prozess gemacht! Da gab es solche Dreckstypen wie euch nicht! Da wärt ihr alle vergast worden! Sollte man heute auch wieder machen mit euch, ins KZ mit euch und vergasen! Was wollt ihr eigentlich? Kommunistenpack!
Waren wir Kommunisten? Riemschneider bestimmt nicht. Der sagte immer, er verstehe sich eher als Künstler. Da sei man Individualist. Und unabhängig von der Politik. Und dass das doch sowieso nicht zusammengehe mit dem Kommunismus. Freiheit ja, aber Kommunismus?
– Na, dees is a Schmarrn!
Wenn Riemschneider in Rage geriet, verstärkte sich sein bairischer Tonfall, der sonst eher dezent war.
– Schau dir das doch an, was die da machen: In Russland und in der DDR, das ist doch Scheiße, oder?
– Ja, schon, weil das da kein richtiger Kommunismus ist, diese bürokratisch spießige Scheiße da, das ist kein Kommunismus. Aber sonst, sonst ist der Kommunismus doch gar nicht schlecht. Wir sind gegen die alten Nazis. Und diese Typen, die uns am liebsten ins KZ schickten oder vergasen würden, die hast du doch genauso dick. Wir sind gegen den Kapitalismus. Gegen Ausbeutung. Gegen Kriege. Für Freiheit. Jeder soll sich entfalten können nach seinen Fähigkeiten. Und seinen Bedürfnissen. Alle sollen die gleichen Chancen haben. Bildung für alle. Freie Schulen, wo die Schüler selber bestimmen, was sie lernen. Und nicht diese autoritären Lehrerarschlöcher, wie wir sie haben. Schau dir die doch an, diese ganzen alten Nazis. Typen, wie den Sittl, unseren Lateinlehrer. Wie der uns immer anschreit, dieses ganze faschistisch autoritäre Gehabe. Und dass uns unsere Väter durchwalken sollten, mit der Hundspeitschn, dreimal täglich … und dass die ganze Klasse ein Spucknapf sei … und dass er uns die Fünfer und Sechser nur so ins Kreuz reinhauen werde, er uns einheizen werde, bis uns das Arschwasser kocht. Und die Hasenbergler aus dem Neubaugebiet, aus der Arbeitersiedlung … dass die Hasenbergler nichts auf dem Gymnasium verloren hätten, dass die sowieso dauernd sitzenblieben … du kennst doch die Sprüche vom Sittl: Aha, wieder ein Hasenbergler, kenn ich schon – zur einen Tür fliegens naus und zur andern kommens wieder nei …
Riemschneider lachte.





























