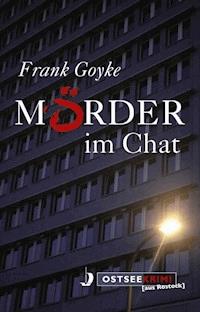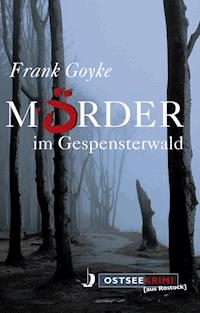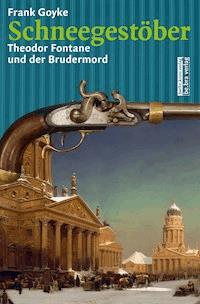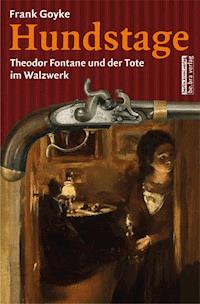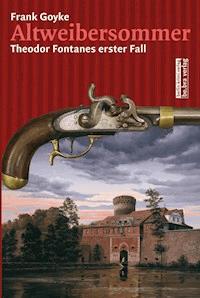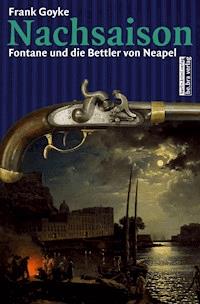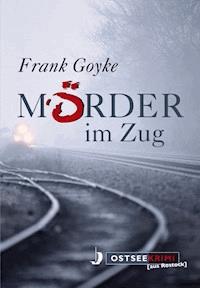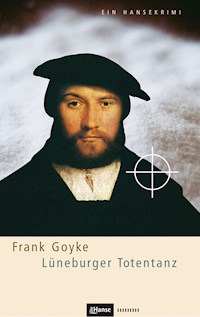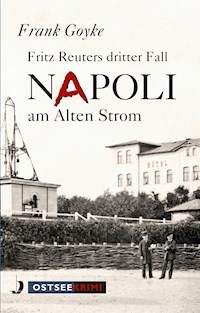Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Am Gedenkstein für Sinti und Roma in Berlin-Marzahn wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, ihr Körper und die Gedenkstätte sind mit roter Farbe beschmiert – und mit Hakenkreuzen. Schnell ist klar, dass es sich bei der Ermordeten um Marija Subotić handelt, eine Roma-Aktivistin und Politikerin der Linkspartei. Das Ermittlungsteam um Jasper Akkermann muss tief in politische und historische Hintergründe eintauchen, die Recherchen führen sie ins rechte Milieu … „Saat der Wut“ ist ein clever konstruierter Krimi, in dem der Erfolgsautor Frank Goyke gesellschaftspolitische Themen spannend verpackt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Frank Goyke
Saat der Wut
Kriminalroman
Jaron Verlag
FRANK GOYKE, geboren 1961 in Rostock, Studium der Theaterwissenschaft, danach im Verlagswesen und als Büroleiter eines Off-Theaters tätig. Seit 1997 freier Autor. Frank Goyke war Mitbegründer der Reihen »Berlin Crime« und »Historische Hansekrimis«. Als leidenschaftlicher Wanderer verfasste er diverse Wanderbücher.
Originalausgabe
1. Auflage 2023
© 2023 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin, unter Verwendung eines Fotos von Michael F.H. Barth (CC BY-SA 4.0)
Satz und Layout: Prill Partners|producing, Barcelona
Lithografie: Bild1Druck GmbH, Berlin
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
ISBN 978-3-95552-068-7
Inhalt
Erstes Kapitel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Zweites Kapitel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Drittes Kapitel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Viertes Kapitel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Fünftes Kapitel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Sechstes Kapitel
Kapitel 1
Kapitel 3
Kapitel 4
Nachbemerkung
Quellenangaben
Erstes Kapitel
1
Schuld war die Hitze.
Schon Mitte Mai hatte es in Berlin begonnen, richtig heiß zu werden. Seit einigen Jahren rechnete man mit einem tropischen Sommer, der immer früher anfing und immer später endete. Bisher hatte man sich nicht verrechnet. Es war der 25. Juli, es war der Welttag der Prävention gegen das Ertrinken, es war 9.43 Uhr. Die Wetteranzeige auf den Smartphones zeigte für Marzahn 28 Grad Celsius.
Die Hitze verursachte vielen Menschen Schwindel, Kopfschmerzen bis zur Migräne, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit und andere Beschwerden. Man wurde träge und gereizt, man schleppte sich durch den Tag und wurde auch des Nachts nicht froh. Die Kleidung klebte auf der Haut, die U-Bahnen verwandelten sich in Saunen, die Fahrgäste blafften einander aus nichtigen Gründen an. Das Statistische Bundesamt registrierte bei alten Menschen Übersterblichkeit. Die Landwirtschaft litt unter Dürren. Die Hitze war wie ein böses Tier. Das Tier aus der Bibel. Die Visionen des Johannes hatten begonnen, Wirklichkeit zu werden.
Kriminalhauptkommissar Jasper Akkermann war mit Kopfschmerzen aufgestanden. Er hatte eine 400er-Ibuprofen genommen, aber Kopfweh hatte er immer noch.
Neben all den anderen Übeln hatte die Hitze auch enorme Auswirkungen auf den Zustand von Leichen, die längere Zeit unentdeckt geblieben waren. Dabei war es nahezu unerheblich, ob sie nun bei 35 Grad im Freien oder bei 25 Grad in einer Wohnung gelegen hatten. Wichtiger war die Liegezeit. Bei der auf dem Parkfriedhof von Marzahn gefundenen Leiche musste, nach dem fernmündlichen Bericht der Ersteinschreiter zu urteilen, eine längere Liegezeit angenommen werden.
Henry Kupfer, Akkermanns Stellvertreter und an diesem Morgen auch sein Chauffeur, fuhr langsam auf einer breiten Allee, die von einem Tor im Süden schnurgerade nach Norden führte. Links und rechts erstreckten sich Grabfelder. Schon von weitem war ein Kastenwagen mit der Aufschrift Gerichtsmedizin zu sehen, der die Allee blockierte. Kupfer fuhr direkt auf den Wagen zu. Ein paar Meter vor ihm brachte er den BMW zum Stehen, beide Kriminalisten stiegen aus. Die Front des Gerichtsmedizin-Transporters wies in einen Nebenweg. Dort waren unübersehbar mehrere Personen in weißen Schutzanzügen damit beschäftigt, nach Spuren zu suchen.
Akkermann ging langsam auf sie zu. Linker Hand bemerkte er ein weißes Schild. Es war an zwei grauen Pfählen befestigt und zweizeilig mit schwarzen Buchstaben beschrieben: Gedenkstein Sinti und Roma. Auch von diesem Stein war in der Erstmeldung die Rede gewesen.
Aus einem Gehölz, das sich hinter mehreren Grabreihen erstreckte, trat eine Frau in einem weißen Einmal-Schutzanzug, mit einer grünen OP-Maske vor dem Mund, mit blauen Einmal-Handschuhen und blau-weißen Einmal-Überschuhen, an dem Erde und ein kleines braunes Blatt klebten. Sie schob die Kapuze in den Nacken und die Maske übers Kinn. Von einem Haarband zusammengehaltene braune Haare kamen zum Vorschein, die Stirn war feucht vom Schweiß. Es war Lena Spillner, die Spurensicherungsfrau der 10. Mordkommission. Als sie ihren Chef entdeckte, machte sie ein paar Schritte auf ihn zu und fragte: »Willst du sie sehen?«
»Was meinst du mit sie? Die Leiche oder eine Frau?«
»Beides. Es handelt sich um eine weibliche Person. Dafür spricht vor allem der Körperbau. Die Kleidung ist, sag ich mal«, ein kurzes Lächeln, »unisex. Schwarze Jeans von G-Star, dunkelblaues Boxy T-Shirt, weiße Converse-Schuhe. Kurzhaarfrisur. Schwarzes Haar. Keine sichtbaren Tattoos. Aber das Gesicht …« Sie schwieg.
Jasper Akkermann wusste, was das Schweigen bedeutete. Er sah die vielen Fliegen, die aus dem Wäldchen kamen, er hörte ihr aufdringliches Gebrumm und hatte nicht die geringste Lust, sich der Toten zu nähern. Das war auch gar nicht nötig, in der Dienststelle würde er Gelegenheit haben, sich die aus allen Blickwinkeln aufgenommenen Fotos anzuschauen. Zwei Kollegen von der Kriminaltechnik, die gekleidet waren wie Lena, machten gerade eine Drohne startklar, mit der sie Aufnahmen von der gesamten Umgebung des Leichenfundortes machen würden, der vielleicht auch ein Tatort war. Die Leiche sei mit Laub und einigen belaubten Ästen bedeckt gewesen, hatte es in der Meldung geheißen – und so etwas konnte eine Tote nicht selbst tun.
»Was sagt der Gerichtsmediziner?«, wollte Akkermann wissen.
»Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein Angriff von vorn mit einem schweren Gegenstand. Aber festlegen will er sich noch nicht. Auch bezüglich der Liegezeit nicht. Wegen der Temperaturen und so weiter und so weiter …«
»Ja, ja, die Hitze!« Akkermann schaute zum Himmel hinauf, der durch die Baumkronen mit den schon jetzt vertrockneten Blättern leuchtete, als hätte ihn Gott mit Photoshop nachbearbeitet. »Was hat es mit der Farbe auf sich?«
»Hast du vielleicht ein Tempo?«, fragte Lena Spillner.
»Ich? Glaube nicht.« Akkermann wandte sich zu Kupfer um, der einen Schritt hinter ihm stand und die Grabsteine um sich her betrachtete. Henry Kupfer war zwei Jahre jünger als er, aber Akkermann fand, dass er viel älter aussah, was zweifellos an der Glatze lag. Nur ein schütterer Haarkranz war ihm geblieben. Die Platte und die feine, mit hauchdünnem Metall umrandete Brille verliehen ihm den Habitus eines Intellektuellen, und das war er auch: Er war ein Bücherwurm, der alles verschlang, was ihm unter die Finger kam. »Hast du …?« Bevor er die Frage beenden konnte, hatte Kupfer schon eine Packung Papiertaschentücher aus seiner Hemdtasche gezogen und reichte sie Lena Spillner. Die nahm eins mit spitzen Fingern heraus und trocknete sich die Stirn. Akkermann glaubte, einen intensiven Schweißgeruch wahrzunehmen, der von ihm selbst herrührte, dabei hatte er sich doch gründlich deodoriert. Aber vielleicht narrte ihn seine Nase. Eine ganz leichte Brise kam auf, nur für einen Moment, und in diesem Augenblick roch es nicht mehr nach Schweiß, sondern nach Verwesung.
»Also die Farbe«, sagte Lena Spillner, »befindet sich an drei voneinander getrennten Orten. Es handelt sich um einen seidenmatten roten Sprühlack, der zur Schändung der Denkmäler verwendet wurde. Auch der Leichnam wurde damit besprüht. Drei Spraydosen liegen etwa fünf Meter in östlicher Richtung von der Toten entfernt.«
»Das ist aber dumm vom Täter«, meinte Kupfer.
»Oder den Tätern«, fügte Lena Spillner hinzu. »Übrigens gibt es auch Spuren auf dem Boden, die aussehen, als wäre die Leiche vom Weg aus ins Unterholz geschleift worden.« Sie deutete zu dem Weg, der von der Hinweistafel am Gedenkstein vorbei nach Osten führte. Die drei Kriminalbeamten standen etwa fünfzehn Meter von dem Granitblock entfernt, aber es war deutlich zu sehen, dass die Gedenkstätte nicht nur aus ihm bestand, sondern darüber hinaus noch aus einer Steintafel und einer Kupferplatte. Jeder dieser Gegenstände war mit einem roten Hakenkreuz besprüht.
»Was ist über die Identität der Geschädigten bekannt?«, wollte Akkermann wissen.
»Nichts«, sagte Lena Spillner. »Sie hatte nichts bei sich, kein Handy oder Smartphone, kein Portmonee, keine Papiere, nur vier Schlüssel an einem Schlüsselring.«
2
Um 11.46 Uhr war die Temperatur auf 30 Grad Celsius gestiegen.
Jasper Akkermann und Henry Kupfer hatten die Arbeit am Leichenfundort den Spezialisten überlassen. Sie hatten die Zeit genutzt, sich ein Bild von der Umgebung zu machen und jenen Platz aufzusuchen, der eindeutig als ein Tatort zu qualifizieren war: den Otto-Rosenberg-Platz. Bereits am Ausgang des Friedhofs waren sie von ihrer Kollegin Ceyda Demirci in Empfang genommen worden, von der Akkermann im Scherz gern sagte, mit ihr erfülle sein Kommissariat zwei Quoten. Sie war seit etwa anderthalb Jahren bei der Mordkommission, und wenn er sie gelegentlich als »meine Quotentürkin« bezeichnete, hielt sie ihm entgegen, dass sie sich genau deshalb doppelt und dreifach habe anstrengen müssen, um Karriere zu machen – bis zur Oberkommissarin hatte sie es gebracht. Akkermann wusste, dass sie recht hatte: Obwohl es immer mehr Frauen bei der Berliner Polizei gab und sogar eine Frau an der Spitze des Präsidiums stand, war die Polizei nach wie vor ein Macholaden. Demirci hatte sich ihre Sporen beim Dezernat LKA 12 und hier wiederum bei den Vermisstensachen verdient, war aber von ihrem Chef gemobbt worden, weil sie ihn wegen seiner sexistischen Sprüche und Anspielungen zur Rede gestellt hatte. Der Chef, Erster Kriminalhauptkommissar Engelmann, war allgemein wegen seines cholerischen Temperaments unbeliebt, er galt als Karrierist, und Kupfer – er war im MK 10 für die Spitznamen zuständig – hatte ihn Drei E getauft; die Buchstaben standen für »Esel, Ekel, Egomane«.
Jasper Akkermann hatte sich gleich in die Nesseln gesetzt. Er hatte nämlich gemeint, Rosenberg, der Namensgeber des Platzes, klinge irgendwie jüdisch. Demirci hatte ihn berichtigt: Otto Rosenberg sei ein Sinto gewesen, der Auschwitz überlebt habe und langjähriger Vorsitzender des Landesverbands Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg gewesen sei, SPDler und Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse.
»Und das dort«, sie zeigte zu einem gepflasterten Platz, auf dem sich mehrere graue Stelen mit Fotos befanden, einige von ihnen auch mit roten Hakenkreuzen geschändet, »das ist der Gedenkort NS-Zwangslager Berlin-Marzahn. Es war ein Zwangslager für Sinti und Roma.«
Noch war die Gedenkstätte mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, obwohl die Spurensicherung augenscheinlich abgezogen war. Rechts befand sich der Eingang zum S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße, der von zwei uniformierten Beamten bewacht wurde, und an dem Kreisverkehr linker Hand, dem eigentlichen Otto-Rosenberg-Platz, standen Streifenwagen und zivile Polizeifahrzeuge. An einem grauen VW-Bus lehnte ein gut genährter Mittfünfziger, der ein Klemmbrett in der linken Hand hielt und den Akkermann vom Sehen kannte, weil sie sich hin und wieder auf den Fluren in der Keithstraße begegnet waren. Den Zuschauern, die sich in großer Zahl vor den Absperrbändern versammelt hatten, nahm seine gut sichtbare Dienstwaffe letzte Zweifel, mit wem man es zu tun hatte: Der Kollege trug nur ein graues T-Shirt, das die Waffe nicht verbergen konnte. Die Frau neben ihm hatte ein senffarbenes Kostüm an, streng tailliert und mit nur einem Knopf geschlossen, und darunter eine weiße Bluse. Ihr langes graues Haar hatte sie im Nacken zu einem Knoten gebunden, eine halbrunde Brille saß ziemlich weit vorn auf ihrem Nasenrücken; alles in allem wirkte sie wie eine katholische Mutter Oberin. Aber da sie sich innerhalb der Absperrung aufhielt, musste auch sie der Polizei angehören.
Akkermann nickte in Richtung der beiden und fragte Demirci: »Du weißt sicher, wer das ist?«
»Er ist beim Staatsschutz«, erklärte sie. »Den Namen weiß ich nicht. Und sie arbeitet bei der Direktion 3. Ich glaube, das ist gar nicht weit von hier. Moment!« Sie, die ein gutes Gedächtnis, ja geradezu ein Elefantengedächtnis hatte, musste nun doch einen Blick in ihr Notizbuch werfen, ein hübsches kleines und teures Ding von Clairefontaine. »Hauptkommissarin Ilonka Weberknecht vom Kommissariat AGIA.«
»Ach, die!« Akkermann legte die Stirn in Falten. Auschwitz, Sinti und Roma, der Staatsschutz und eine Kollegin vom Arbeitsgebiet Interkulturelle Aufgaben, das schmeckte ihm ganz und gar nicht. Vielleicht hatte man es mit einem politischen Mord zu tun, einem Verbrechen also, das Aufmerksamkeit erregen würde, es mindestens in die Abendschau, vielleicht sogar in die Tagesschau, auf jeden Fall aber in etliche Gazetten und in diverse Internetforen schaffen würde. Ein enormer Druck würde entstehen, wie damals beim Anschlag auf dem Breitscheidplatz, wo sich alle möglichen inkompetenten Leute vor den Fernsehkameras spreizten, rasche und umfassende Aufklärung versprachen und in ihren dicken Limousinen davonrauschten – weil sie die Bilder für ihre Popularität brauchten, denn die Opfer bedeuteten ihnen anscheinend nicht viel: Sie konnten ja nicht mehr wählen. Für die Einlösung der vollmundigen Versprechen war die Kriminalpolizei zuständig, auf die man das eigene Versagen notfalls abwälzen konnte. »Dann mache ich mich mal mit den Kollegen bekannt«, sagte er, doch bevor er sich in Bewegung setzen konnte, bekam er einen Anruf. Es war ein sehr kurzes Gespräch, nach dessen Ende er sich zu Kupfer umdrehte: »Die Geschädigte ist soeben abtransportiert worden. Autopsie ab 20 Uhr, Obduzent ist Dr. Red Red Wine. Er möchte dich dabeihaben.«
»Du möchtest es!«, erwiderte Kupfer. Er hatte den Gerichtsmediziner Dr. Scholz nach einem steinalten Hit von UB40 getauft, weil er bei den Autopsien mindestens eine Flasche Rotwein trank. »Der Erste Hauptkommissar Jasper Akkermann wird in die Berliner Polizeigeschichte eingehen – als der einzige Mordermittler, der nie eine Leiche live sah. Typisch Niedersachse: Drückt sich und lässt andere machen!«
»Typisch Schleswig-Holsteiner! Jammert, anstatt seinen Mann zu stehen. Denk an den Brunello di Montalcino! Und nun los, auf in den Kampf!«
3
Bis zum Eintreffen der Tatortreiniger waren sie noch am Otto-Rosenberg-Platz geblieben. Staatsschützer Pauls, so sein Name, hatte die Schutzpolizisten angewiesen, sich davon zu überzeugen, dass wirklich keine Spur der Denkmalschändung mehr zu sehen war, um dann erst die Absperrungen aufzuheben. Akkermann hielt seine Meinung zurück: Das Beseitigen der Spuren, mochte es auch in guter Absicht geschehen, bedeutete zugleich, dass die böse Tat unsichtbar wurde. Es war, als hätte sie gar nicht stattgefunden. Er selbst hatte ja durch das Verbrechen überhaupt erst erfahren, dass an dieser Stelle einmal ein Zwangslager für Sinti und Roma bestanden hatte. An diesem eher unwirtlichen Ort erhielt das Denkmal wenig Aufmerksamkeit. So eigenartig es klingen mochte, die Schändung hätte daran etwas ändern können.
Auf dem Weg zur Polizeidirektion 3 (Ost) in der Poelchaustraße hatte Akkermann deren Webseite aufgerufen, denn er wusste zwar, dass es in Berlin diese Kommissariate AGIA gab, er hatte aber nur eine ungefähre Vorstellung von ihrem Job. Die Webseite gab Auskunft: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AGIA kennen sich mit allen aufenthaltsrechtlichen Bestimmungen aus. Sie halten Kontakt zuausländischen Vereinen, Betrieben mit hohem Ausländeranteil oder auch Wohnheimverwaltungen und Handelszentren, um ein möglichst konfliktfreies Zusammenleben zwischen Deutschen und Ausländern zu ermöglichen. Weitere Schwerpunkte liegen in der Bekämpfung von Straftaten, wie illegale Einreise, illegaler Aufenthalt, illegale Prostitutionsausübung, Pass-/ Urkundenfälschungen, Handel mit unverzollten Zigaretten sowie dem Einschleusen von Ausländern. Für die Ausländerbehörde in Berlin werden Festnahmeersuchen, Hausermittlungen, Passsicherstellungen und Festnahmen zur Direktabschiebung durchgeführt. Das AGIA unterstützt und berät alle Polizeidienststellen bei Einsätzen im Zusammenhang mit ausländischen Bürgern.
Inzwischen saßen sie in einem Besprechungszimmer des Bereichs Kriminalitätsbekämpfung: Jasper Akkermann zwischen Demirci und Kupfer an der Längsseite des langen Tisches, ihnen gegenüber die Schutzpolizisten Regorius und Wilhelm vom Polizeiabschnitt 31, die am Morgen die ersten Polizeibeamten am Otto-Rosenberg-Platz gewesen waren, an der linken Stirnseite Hauptkommissarin Weberknecht, an der rechten Hauptkommissar Pauls. Der Raum war kahl wie alle Räume dieser Art. Vor dem Fenster kümmerte eine Blattpflanze vor sich hin, an einer Wand hing ein Wiener Polizeikalender von 2019, womöglich das Mitbringsel einer Dienstoder Urlaubsreise, eine Vitrine in der Nähe zur Tür enthielt die allbekannte Polizeifolklore in Form von ausländischen Dienstmützen und Sportpokalen.
Während alle ihre Aufzeichnungen ordneten, musste Jasper Akkermann plötzlich an den Konfirmandenunterricht beim Pfarrer Hülsen denken, den er nicht etwa auf Wunsch seiner Eltern besucht hatte, sondern weil seine besten Kumpels daran teilnahmen – und vor allem sie, Angela, seine erste Liebe, sehr groß und sehr platonisch. Natürlich hatte der Pastor auch auf dem Johannesevangelium und dessen ersten Worten herumgekaut: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden … Was für ein übermäßiges Vertrauen in die schöpferische Kraft des Wortes, der Sprache. Inzwischen waren Worte zu einer gefährlichen und bisweilen sogar lebensgefährlichen Sache geworden, war die Sprache wie ein Minenfeld. Dreimal musste man überlegen, ob man eine heikle Sache ansprach. Akkermann dachte gar nicht so sehr an all die demagogischen und populistischen Reden, die sich wieder über das deutsche Volk ergossen, sondern an das N-Wort und das Z-Wort, vor allem aber an den Begriff Ausländer. Wer war das? Menschen, deren Großeltern aus der Türkei, aus Russland, aus dem Libanon oder woher immer stammten, deren Eltern jedoch und die selbst in Deutschland geboren worden waren, zum Beispiel in diesem Marzahn – waren das Ausländer? Ihm waren auf dem Parkfriedhof viele Grabsteine mit deutschen Namen, aber mit slawisch anmutenden Vornamen aufgefallen, und er meinte sich zu erinnern, irgendwo gelesen zu haben, in den östlichen Neubaugebieten lebten viele Russlanddeutsche – waren das noch Ausländer? Fühlten sie sich so? Sie hießen ja sogar Deutsche. War Ceyda Demirci etwa eine Ausländerin? Auf keinen Fall. Ihre Berichte waren in einem besseren Deutsch abgefasst als die seinen und wurden nur von Henry Kupfer getoppt, aber der war ja auch eine Leseratte und hatte unlängst angedeutet, er lese den Zauberberg – Akkermann hatte sich das Buch daraufhin auch gekauft, natürlich nur die Taschenbuchausgabe, war war schon am ersten Absatz gescheitert. Frau Weberknecht befasste sich also mit Ausländern, und das dürfte in diesem Marzahn von Nutzen sein. Denn wie hatte Drei E unlängst bei einer Führungskräftebesprechung gesagt? »Östlich vom S-Bahnring beginnt Asien.«
Jasper Akkermann schob diese müßigen Gedanken zur Seite, schaute noch einmal jeden an, lächelte und begann: »Ich würde mit Ihnen gern die Ereignisse des heutigen Morgens durchgehen, chronologisch und so präzise wie möglich. Kollege Regorius, Kollege Wilhelm, Sie haben zunächst das Wort. Worin bestanden heute Ihre Aufgaben?«
»Das Übliche«, sagte Regorius. »Nach Schichtbeginn gleich auf Streifenfahrt. Also kurz nach sechs. Aber schon um 6.24 Uhr kam der Einsatzbefehl für den Otto-Rosenberg-Platz. Eine Joggerin hatte von ihrem Handy aus die 110 gewählt, weil sie Schmierereien an diesem Zig… an dem Denkmal da entdeckt hat. Wir fuhren sofort hin. Sahen die Bescherung. Verständigten die Zentrale. Die schickte jemand vom KDD.«
»Okay. Der KDD-Bericht liegt schon vor. Zwei Kolleginnen vom Kriminaldauerdienst sind fünf nach halb acht am Tatort eingetroffen. Welche Handlungen führten Sie bis dahin aus?«
Diesmal antwortete Wilhelm: »Wir haben Absperrband gezogen. Zunächst nur um die Gedenkstätte. Später haben wir auch den Zugang zum Bahnhof gesperrt und diesen Platz einbezogen. Auf Weisung …« Er deutete zum Staatsschützer Pauls.
Akkermann nahm den Fingerzeig auf: »Was wissen wir über die Joggerin?«
Pauls benutzte kein Notizbuch, sondern die entsprechende Funktion seines Smartphones, die er zunächst aufrief. Akkermann spürte plötzlich einen ungeheuren Durst. In dem Zimmer war es ziemlich stickig, aber man konnte das Fenster nicht öffnen, da es dadurch nur noch heißer wurde. Rasch konsultierte er sein Smartphone: 13.57 Uhr. 32° C. Sonnig.
»Die Frau heißt Alina Kruse«, sagte Pauls. »Sie ist 35 Jahre alt, arbeitet als Lehrerin an der Peter-Pan-Grundschule und wohnt Paul-Dessau-Straße 5. Im Moment sind ja Ferien, aber sie joggt mindestens drei Mal in der Woche vor Unterrichtsbeginn und behält diese Gewohnheit auch an freien Tagen bei. Ihr könnt mal Google Maps aufrufen, dann kann ich ihre Route besser erläutern.«
Alle folgten seiner Aufforderung, auch die Schutzpolizisten. »Seht ihr den Bürgerpark Marzahn? Im südwestlichen Teil verläuft die Paul Dessau. Der Weg der Zeugin führt durch die Raoul Wallenberg zum gleichnamigen S-Bahnhof, dort durch die Unterführung und weiter an der Gedenkstätte vorbei durch die Otto-Rosenberg-Straße in Richtung Unkenpfuhle.«
»Moment, bitte!« Akkermann hob den rechten Zeigefinger. »Was sind das für Gebäude links und rechts vom Otto-Rosenberg-Platz und der Otto-Rosenberg-Straße?«
»Tja«, sagte Frau Weberknecht, »dort hält sich eine teilweise sehr problematische Klientel auf. Sie sehen direkt an den Platz anliegend das Katholische Jugendsozialwerk, kurz KJSW, das sich um schwierige Jugendliche kümmert und ihnen neben Freizeitangeboten auch schulische Hilfen und eine Berufsausbildung bietet. Eine gute Sache natürlich, aber da verkehren durchaus auch Rabauken. Zwei der Neubaublöcke gehören zu der gemeinnützigen GmbH Zurück ins Leben, es handelt sich um Unterkünfte für Obdachlose, die dort auch sozialarbeiterisch betreut werden. Dahinter stehen Asylbewerberheime, und nördlich vom Platz hat ein Kinder- und Jugendzirkus sein Domizil.«
»Gab es Vorfälle in Bezug auf die Gedenkstätte?«, fragte Henry Kupfer in den Raum hinein, also quasi an alle gerichtet, die davon wissen könnten.
»Ordnungswidrigkeiten.« Regorius blickte auf das Blatt Papier, das vor ihm lag. »Wir haben uns mal die Daten des letzten Jahres geben lassen. Von unserem Abschnitt sind fünf Vorfälle aufgenommen worden. Einmal wurden zwei Stelen zerkratzt, aber es stellte sich schnell heraus, dass Kinder es aus Langeweile getan haben, es gab keinen politischen Hintergrund. Ansonsten wurde vier Mal an die Stelen uriniert. Drei Mal von ein und derselben Person. Mitarbeiter des KJSW haben uns verständigt. Einmal wurde eine Ermahnung ausgesprochen, beim zweiten Mal ebenso. Bei dritten Mal wurde eine Strafanzeige angedroht.«
»Und diese Personen haben auch einen Namen?«
»Der Einmal-Pinkler heißt Ulrich Herbert … Herbert ist tatsächlich der Nachname … Er war zum Tatzeitpunkt betrunken. Moment! Ich sehe gerade … Er hieß Ulrich Herbert. Ist am 2. Mai in der Einrichtung gestorben. Todesursache: unklar.«
Jasper Akkermann machte sich eine Notiz, Demirci links neben ihm schrieb auch etwas auf. Kupfer fragte weiter: »Und die zweite Person?«
»Patrick Melzer. Polizeibekannter Schläger. Säuft sich am Imbiss beim S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße die Hacken zu und wird dann oft aggressiv. Wurde schon mehrmals aus der Einrichtung gewiesen, dann aber doch wieder aufgenommen.«
Hauptkommissar Pauls mischte sich ein: »Da wäre es vielleicht gut gewesen, wegen des Urinierens schon früher eine Strafanzeige zu erstatten.«
»Ich glaube nicht, dass es einen politischen Hintergrund hatte«, erwiderte Regorius. »Der Typ war besoffen, und die Stelen bieten sich ja förmlich an.«
»Sie urinieren dort doch auch nicht!«, sagte KHK Weberknecht in einem scharfen Mutter-Oberin-Ton.
Wilhelm konterte sofort: »Pardon, aber wir sind im Dienst auch nicht betrunken!«
»Wir gucken uns das Früchtchen mal an«, entschied Akkermann. »Jetzt erst einmal weiter im Text. Die Joggerin Alina Kruse hat die Schmierereien entdeckt und die 110 angerufen. Über ihre Jogging-Route sprechen wir später noch. Die Kollegen Regorius und Wilhelm waren als Ersteinschreiter vor Ort, haben den KDD angerufen, der traf 7.35 Uhr am Ereignisort ein. Zwei Kolleginnen nahmen den Ort in Augenschein und entschieden, dass es sich um eine Staatsschutzsache handelt. Herr Pauls?«
»Richtig. Ich bin gerade in der Dienststelle eingetroffen, da kam schon die Meldung. Und erste Fotos. Ich bin ja beim Dezernat 53, also für politisch motivierte rechte Taten zuständig, und was denkt man bei einem Hakenkreuz? Ist doch klar. Also sind wir gleich mit der Spurensicherung rausgefahren. Und mit Hundeführer. Wir haben gerade mit der Tatortaufnahme begonnen, da kam diese alte Dame vom Friedhof gelaufen, so schnell sie konnte …« Nun musste auch er in seine Notizen blicken. »Valerija Hirsekorn, 86 Jahre alt. Noch gut zu Fuß, aber nicht sehr schnell. Sie geht jeden Morgen gleich nach Öffnung des Friedhofs zu den Gräbern ihrer Lieben. Mann und Sohn.«
»Der Sohn ist vor der Mutter gestorben?«, vergewisserte sich Demirci.
Pauls nickte. »Vor beiden Eltern sogar.«
»Schrecklich! Das Schlimmste, das Eltern passieren kann.« »Sicher. Aber die Dame macht einen sehr taffen Eindruck. Sie hatte die Schmierereien an den Gedenksteinen auf dem Friedhof entdeckt. Und sie wusste, dass am Otto-Rosenberg-Platz Polizei zugange war, weil sie eigentlich immer von der Raoul-Wallenberg-Straße zum Friedhof kommt, der Zugang aber gesperrt war. Wir haben uns dann auch gleich um den zweiten Tatort gekümmert und dort den Hund eingesetzt. Der machte sofort einen Riesenlärm … Er hat die Leiche gewittert und uns zu ihr geführt. Zwei Minuten nach neun haben wir sie gefunden und das Lagezentrum informiert – und die wiederum Ihre Truppe.«
»Okay«, sagte Akkermann, »die Gedenkstätten waren mit Hakenkreuzen beschmiert. Auf dem Otto-Rosenberg-Platz war aber zusätzlich eine Inschrift angebracht, nicht wahr?«
Pauls nickte. »Auf den Boden gesprüht. Der Zusammenhang der Buchstaben wurde quasi erst auf den zweiten Blick deutlich, nicht beim flüchtigen Vorbeigehen. Ich schicke euch das Foto.«
Schon Sekunden später hatte es Akkermann auf seinem Display. Es musste aus einer gewissen Höhe aufgenommen worden sein, also war auch hier schon eine Drohne zum Einsatz gekommen. Der Schriftzug lautete: Hau weg den Ziehgeunerdreck!
»Da steht aber jemand mit der deutschen Rechtschreibung auf Kriegsfuß«, sagte Demirci.
»Na, wer weiß.« Hauptkommissarin Weberknecht deutete ein Kopfschütteln an. »Ich kenne genug Fälle, wo Leute bewusst die Orthographie verfälschen.«
»Um eine falsche Spur zu legen …«, sagte Kupfer.
»Oder um sich dümmer zu machen, als sie sind!«
4
Valerija Hirsekorn wohnte in einem elfgeschossigen Wohnblock in der Nähe des S-Bahnhofs Raoul-Wallenberg-Straße, allerdings hieß die Straße hier Märkische Allee. Jasper Akkermann brauchte eine Weile, um auf dem riesigen Klingelschild ihren Namen zu finden, und es dauerte auch noch, bis sich jemand mit einer überraschend kräftigen Stimme meldete: »Ja?«
Akkermann zuckte zusammen, denn er hatte eine dünne Greisenstimme erwartet.
»Kriminalpolizei. Frau Hirsekorn, ich muss … ich möchte mit Ihnen sprechen.«
»Achter Stock.« Die Frau betätigte einen Summer, Akkermann drückte die Tür auf. Nie würde er es in einem solchen Hochhaus aushalten, wo die meisten Nachbarn zwangsläufig anonym blieben. Irgendwo hatte er gelesen oder gehört, in der DDR habe das Volk diese Neubauten als Arbeiterschließfächer bezeichnet. Akkermann nannte eine Eigentumswohnung in Charlottenburg sein Eigen, zwei mittelgroße Zimmer in der Leibnizstraße, aber im Herzen war er ein Dorfkind. Seine Wiege hatte in Oberndorf an der Oste gestanden, und es machte ihn rasend, wenn jemand den Namen des Flusses falsch aussprach. Immer wieder musste er korrigieren, wenn Leute das O kurz wie in Osten betonten, obwohl es doch ein langes O war.
Akkermann rief den Fahrstuhl. Wenige Minuten später stand er vor der Wohnung 8.01. Ein geschwungenes Messingschild war in Augenhöhe auf dem Türblatt angebracht, der Namenszug W. Hirsekorn war in das Schild gestanzt und mit schwarzer Farbe hervorgehoben. Bevor Akkermann klingeln konnte, wurde die Tür geöffnet. Offenbar hatte die Wohnungsinhaberin hinter der Tür gewartet und zunächst den Fahrstuhl, dann seine Schritte gehört.
Die Frau, die da vor ihm stand, war tatsächlich eine kleine Dame. Sie reichte ihm bis zur Brust, war schlank und hielt sich auffallend gerade. Ihre Bluse mit den Blumen war vielleicht nicht der letzte Schrei, der graue Rock dagegen zeitlos. Sie trug hautfarbene Strümpfe und goldfarbene Pantoffeln, sie hatte eine Perlenkette angelegt, und ihr graues Haar lag in exakten Locken, wie sie nur ein Hilfsmittel erzeugen konnte.
Valerija Hirsekorn machte eine einladende Geste in den Flur, Akkermann trat ein. Der Raum, in den er geleitet wurde, musste das Wohnzimmer sein. Wann immer die Frau aus Russland nach Deutschland gekommen war, vermutlich war es die erste Einrichtung: Sie bestand aus einer Schrankwand, die aus den Neunzigerjahren stammte, einem orientalisch anmutenden Teppich, einer wuchtigen Couchgarnitur mit Hubtisch, und obwohl das Zimmer nicht besonders groß war, hatte man noch einen Esstisch mit vier Stühlen untergebracht. Das mit Wolkenstores verhängte Fenster war breit, neben ihm gab es eine Tür zum Balkon. Nach der Lage der Wohnung zu urteilen, musste man vom Balkon einen Blick über den Parkfriedhof und weit über Berlin haben – der einzige Vorteil einer Hochhauswohnung in der achten Etage.
Akkermann wurde gebeten, in einem der beigefarbenen Sessel Platz zu nehmen. In der Schrankwand entdeckte er eine dieser Puppen, die man ineinanderstecken konnte, wobei hier die einzelnen Püppchen in geradezu militärischer Ordnung nebeneinander standen, auf dem Esstisch befand sich eine dieser typisch russischen Teemaschinen – Akkermann ärgerte sich, dass ihm weder der Namen der einen noch der anderen einfiel. Dabei gab es in Charlottenburg unweit des Schlosses ein Restaurant mit dem Namen der Teemaschine, an dem er vorbeifuhr, wenn er in seinen Kleingarten radelte. Verdammt, wie hieß es nur? Hatte er schon Alzheimer? In seinem Alter? Auch wenn Russland ihm so fern war wie Asien, diese Bezeichnung kannte man doch! Außerdem hatte er sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine immer wieder mal vorgenommen, sich mit beiden Ländern näher zu befassen. Wie so viele gute Vorsätze war auch dieser unter dem Alltagsstress verschwunden.
Frau Hirsekorn deutete auf eine Gebäckschale auf dem Tisch. »Möchten Sie Tee?«
»Bei dieser Hitze?« Es war stickig in dem Zimmer, so wie es derzeit in allen Räumen stickig war. Akkermann vermisste jedoch den schwer zu beschreibenden Alte-Leute-Geruch. Irgendwie roch es nach Orangen.
»Tee kann man immer trinken.« Valerija Hirsekorn lächelte kurz. »Bei Kälte, bei Hitze, immer.«
»Vielleicht später, Frau Hirsekorn. Sie wissen, warum ich hier bin. Ich möchte Sie bitten, mir so genau wie möglich zu schildern, was Sie heute Morgen erlebt haben. Beginnen Sie am besten in dem Moment, als Sie das Haus verließen.«
Frau Hirsekorn nickte und schloss für einen Moment die Augen. Sie hatte auf der klobigen Couch Platz genommen und wirkte dort beinahe verloren. Über ihrem Kopf hingen drei altertümlich wirkende Ikonen mit frontal abgebildeten Heiligen. Akkermann vermochte die Muttergottes mit dem Kind zu identifizieren, beim Sankt Georg war er unsicher, die dritte Person kannte oder erkannte er nicht.
»Sie müssen wissen«, begann die alte Dame, und zwar nicht mit dem, was Akkermann eigentlich bloß wissen wollte, »wir sind aus Russland. Aus Omsk, das ist Stadt in Sibirien. Millionenstadt. Om fließt in Irtysch. Wir sind richtige Deutsche. Wie man auch sagt: Russlanddeutsche. Manche, die gekommen sind nach Deutschland, haben Stammbaum auf Schwarzmarkt gekauft, sind gar nicht deutsch. Wir ja. Wir sind 1995 nach Deutschland, gleich nach Berlin. Ganz schnell haben wir Wohnung bekommen in Marzahn. Sie wissen, hier gibt es sehr viele Russlanddeutsche, echte und falsche.« Sie stieß einen Seufzer aus, der eher demonstrativ wirkte als bedauernd. »Ich war Krankenschwester, wurde aber nicht anerkannt. Mein Mann Waldemar war Bauingenieur, wurde auch nicht anerkannt. Unser Sohn Alexei war noch Student, als wir kamen. Hat studiert am Fremdsprachenkolleg in Omsk. Aber hier? In Deutschland? Immer nur Geld im Kopf. Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte. Hat sogar GmbH gegründet, mit Freunden in Omsk. Import, Export, Großhandel. Mit Sachen, die man in Russland schlecht bekommt. Ich habe hier Schein gemacht, als Krankenschwester, habe gearbeitet in Unfallkrankenhaus. Mein Mann konnte keine Arbeit finden. Und Alexei wurde plötzlich sehr krank. Andere, böse, sehr böse Männer wollten in sein Geschäft. Russen! Mafia! Haben in Omsk Ladung gestohlen und auf Freund geschossen. In den Bauch. Er musste ganz oft operiert werden. Alexei wurde krank davon. Hatte so viel Angst! Dann hat er neuen Freund gefunden.« Auf ihr Gesicht legte sich jetzt ein bitterer Zug. »Name war Diazepam.«
»Kein guter Freund«, bemerkte Akkermann und schaute an Frau Hirsekorn vorbei auf Sankt Georg. Samowar, fiel ihm plötzlich ein, Samowar nannte man die Teemaschine, und so hieß auch das Restaurant. Die alte Dame war offenkundig froh, einen Teil ihrer Lebensgeschichte erzählen zu können, wenn auch im Telegrammstil – sicher hatte sie niemanden mehr, der sie noch hören wollte. Er würde sich also mit Geduld wappnen müssen.
»Nein, kein guter Freund«, bestätigte sie. »Und er ist Mann, verstehen sie? Mann geht nicht in Krankenhaus, Mann lässt sich nicht helfen. Mann trinkt Wodka und geht zu … zu … zu schlechten Frauen.«
»Woher hatte er das Diazepam?«
»Ich weiß nicht. Schlechte Bekannte? Russen …«
»Vielleicht ein bestechlicher Arzt?«
Frau Hirsekorn hob die Schultern und beide Arme zum Zeichen, dass sie es nicht wisse. Akkermann wusste, dass auch gestohlene Rezepte in Frage kamen. Um den Lebensbericht zu einem Ende zu bringen, ohne die alte Dame zu verletzen, fragte er: »Wie ist er gestorben?«
Die alte Dame schwieg. Wie versteinert saß sie auf der klobigen Couch, ihre Hände hatten sich ineinander verkrampft, die Schultern waren angehoben.
»Frau Hirsekorn?«
»Er hat sich … Er wurde …« Frau Hirsekorn atmete tief durch. Doch die angespannte Haltung verließ sie nicht. »Polizei hat ihn gefunden … mit Spritze …«
»Er hat noch andere Drogen genommen?«
Sie schüttelte vehement den Kopf. »Ich glaube nicht. Das war Mord!«
Nun war es an Akkermann, für einen Moment zu schweigen. Er blickte zu den Puppen in der Schrankwand, betrachtete die Rücken der wenigen Bücher, konnte nur einen Titel erkennen: Nachtbeeren, lautete er. Und auch den Namen der Autorin: Elina Penner. Penner zu heißen, das fand er ziemlich grenzwertig, aber seinen Namen konnte man sich ja nicht aussuchen.
»Ja, das ist jetzt fünfzehn Jahre her«, sagte Frau Hirsekorn, und ihre Stimme war wieder fest. »Mein Mann hat es nicht verkraftet. Sie arbeiten bei der Polizei und haben sicher keine Vorstellung, wie es ist, wenn man keine Arbeit hat. Frau arbeitet, man selber nicht. Sitzt immer zuhause, Sohn ist tot … Man grübelt. Er hatte es schon lange am Herzen, schon in Omsk. Hat dann einfach Tabletten nicht mehr genommen. Ich wusste nicht … Er war russischer Mann. Deutsch, aber im Herzen auch russisch. Wahrer russischer Mann hat keine Depressionen. Das ist nicht männlich. Auch zu viel Alkohol. Und immer nur sitzen und grübeln. Er ging gar nicht mehr aus dem Haus.«
»Aber Sie haben ihm doch sicher nicht den Alkohol …?«
»Nein, um Gottes willen, nein!« Valerija Hirsekorn schüttelte den Kopf. »Das war Nachbar. Auch aus Russland. Auch deutsch. Echter Deutscher! Sie haben sich ein bisschen … wie sagt man das? … angefreundet? Ja, angefreundet. Waldemar musste nur anrufen. Nachbar auch ohne Arbeit. Haben oft zusammen getrunken. Eines Tages ist sein Herz einfach … still gewesen. Äh, gestanden. Es ist einfach stillgestanden.«
»Wann war das?«
»Vor acht Jahre. Jahren. Ich bin allein. Und ich lebe noch.« Ein ganz feines Lächeln zeigte sich auf ihrem Gesicht. »Ich habe so eine Art Freundin auf Friedhof. Kommt auch jeden Tag und sagt immer: ›Valerija, ich glaube, du bist unsterblich.‹«
5
Das Obdachlosenheim war erfüllt von jenem charakteristischen Aroma von Männerunterkünften, das Henry Kupfer von seiner Zeit beim Bund nur zu gut kannte: eine Mischung aus Schweiß und dem Geruch ungewaschener Füße, zu dem hier noch ein leichter Alkoholdunst trat. Seine Begleiterin, KHK Weberknecht, hatte zielstrebig ein Büro angesteuert, in dem der Heimleiter von Zurück ins Leben residierte, ein vierschrötiger Mann, dem man sofort zutraute, mit aggressiven Trinkern fertigzuwerden. Es gab auch ein Besprechungszimmer, das ebenso nüchtern aussah wie das der Polizei. Dort sollten Kupfer und Weberknecht warten, während der Heimleiter nachschauen ging, ob Patrick Melzer noch auf seinem Zimmer war.
Es verstrich eine gute Viertelstunde, während der beide mit ihren Smartphones beschäftigt waren. Was Frau Weberknecht tat, konnte Kupfer nicht wissen, da er ihr nicht über die Schulter schauen konnte – er selbst tauschte WhatsApp-Nachrichten mit seiner Tochter Helene, die eine Klausur in Literatur zurückbekommen und eine Eins geschrieben hatte, eine fette Eins, wie sie schrieb. In Deutsch stand sie in diesem Schuljahr auf 1,0 – also hatte er ihr eine Belohnung fürs kommende Wochenende in Aussicht gestellt. Sie solle sich etwas wünschen; und sie hatte sich etwas gewünscht: Escape Room oder Hochseilgarten.
Der Mann, der im Besprechungsraum erschien, war jung, noch keine 30. Er trug einen beigen Hoodie mit einem Tiger auf der Brust und der Aufschrift I’m the tiger, eine dunkle Jeans mit Rissen, durch die man seine Stachelbeerbeine sah, weiße Socken und Adiletten – deren Rückkehr in die Alltagsmode Kupfer ebenso grässlich fand wie das Tragen von Flip-Flops allüberall, denn für ihn waren beides Badelatschen und keine Straßenschuhe. Seinen Haarschnitt, ein gescheiteltes Haarbüschel