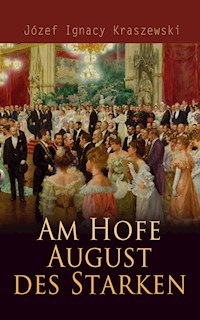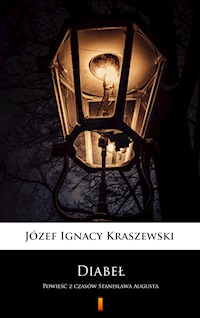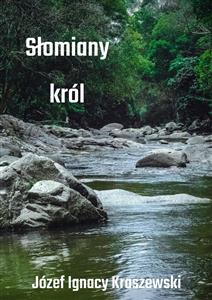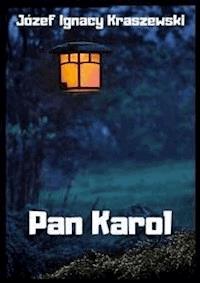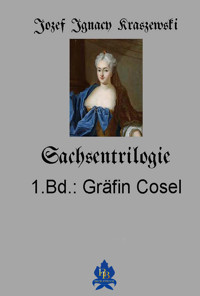
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Anna Constantia Gräfin Cosel, die von 1680 bis 1765 lebte, war die Frau des Generalakzisedirektors Adolph Magnus von Hoym und wurde nach ihrer Scheidung Geliebte des sächsischen Kurfürsten August des Starken. Als Bedingung stellte sie, um sich überhaupt auf den Kurfürsten einzulassen, von diesem ein Eheversprechen zu erhalten, dass August der Starke sie heiratete, falls seine rechtmäßige Ehefrau verstürbe. Sie gebar ihm drei Kinder und war an seiner Seite für neun Jahre die mächtigste Frau Sachsens. Durch Intrigen und ihre Eifersucht wurde der Kurfürst ihrer überdrüssig und ließ sie aus Dresden nach Pillnitz verbannen. Anna von Cosel wollte dieses Schicksal nicht einfach so hinnehmen und mit dem Eheversprechen in der Hand holte sie in Dresden ihre Kinder ab und floh nach Preußen. Der preußische König lieferte sie aber wieder an Sachsen aus. Nach einem Zwischenaufenthalt in Nossen kam sie nach Stolpen. 49 Jahre lang wurde sie dann auf der Festung Stolpen gefangen gehalten, immer noch hoffend, dass sich August der Starke ihr wieder zuwenden würde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jozef Ignacy Kraszewski
Gräfin Cosel
1. Band der Sachsen-Trilogie
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Mühlsdorfer Weg 25
01257 Dresden
Erster Band
ERSTES KAPITEL: In vino veritas
Es war Herbst. Im königlichen Schloss zu Dresden, das schwarz und finster hoch über die dunklen Schatten, die es umgaben, emporragte, herrschte Grabesstille. Der Monat August war kaum zu Ende. Die Zeit der Regen und der eis-kalten Winde war noch nicht gekommen. Noch trugen alle Bäume ihren vollen Blätterschmuck. Wenngleich die Tage in dieser Jahreszeit schön und die Nächte lau und klar zu sein pflegen, stürmte es in jener Nacht, in der unsere Erzählung beginnt, dennoch mit geradezu winterlichem Ungestüm. Ein kalter, von Norden kommender Wind jagte dunkle Wolken über den Himmel, zerriss sie und drängte sie wieder zusammen, sodass der blasse Schimmer der Sterne kaum für Augenblicke sichtbar wurde.
Vor dem Gitter des St.-Georgs-Tores und in den Höfen des Schlosses schritten schweigende Schildwachen langsam auf und nieder. Die Fenster der königlichen Empfangssäle, denen sonst die rauschenden Klänge entzückender Tanzweisen und der Glanz von tausend und aber tausend Kerzen entströmten, starrten heute lichtlos in die Nacht.
Diese Ruhe, diese Totenstille war eine Seltenheit am Hofe Augusts II., den man den Starken nannte und der diesen Beinamen in der Tat verdiente. Besaß er doch die Kraft, nicht nur Hufeisen, sondern auch Herzen zu brechen, ließ er sich doch von keinerlei Missgeschick oder Kummer beeinträchtigen, blieb er doch stets unerschütterlich und unbeugsam. Der Dresdener Hof hatte sich durch seinen Glanz einen europäischen Ruf erworben; die Verschwendung und Pracht, die dort herrschten, suchten ihresgleichen. In diesem Jahr aber hatte August den Starken ein schwerer Schlag getroffen: Die polnische Krone, die er sich mit solchen Unkosten erworben hatte, war ihm durch den Schweden entrissen worden, der ihn noch vollends aus Polen vertrieben hatte. Jetzt stand er wiederum auf sächsischem, ererbtem eigenem Boden und grübelte über die Wechselfälle des Lebens nach; beweinte sowohl den Wankelmut der Polen als auch die Millionen, die ihn die Königskrone jenes Landes gekostet hatte.
Dass die Polen August den Starken, diesen so liebenswürdigen, edlen Monarchen, nicht anbeteten, nicht für ihn in den Tod gehen wollten, war sowohl dem König als auch seinen Untertanen geradezu unbegreiflich. Er zeigte sie, die Polen, des schwärzesten Undanks. Um Augusts Erbitterung nicht zu steigern, vermied es seine Umgebung aufs sorgfältigste, ein Wort über die Polen oder die Schweden in seiner Gegenwart fallen zu lassen oder auf die jüngsten verhängnisvollen Ereignisse anzuspielen, die höchst demütigend gewesen waren und für die König August sich dereinst glänzende Genugtuung zu verschaffen hoffte.
In Dresden lebte man seit der Rückkehr des Königs wieder in Saus und Braus. Man musste sich doch Mühe geben, die um düsterte Stirn des liebenswürdigen Monarchen aufzuheitern! Umso auffälliger war daher die tiefe Stille, die heute im Schloss herrschte. Die Vorübergehenden waren darüber höchlich verwundert. Wusste man doch, dass sich der König in Dresden befand, hieß es doch, dass er den Entschluss gefasst habe, Fest an Fest zu reihen, um Karl XII. von Schweden, seinem Feinde, Ärger zu bereiten und ihm zu beweisen, dass dem starken August das erlittene Missgeschick nicht sehr zu Herzen gegangen war.
Wer aber in jener stürmischen Nacht bis in den zweiten Hofraum des Schlosses gedrungen wäre, hätte sofort erkannt, dass im Innern des Palais noch reges Leben herrschte. Die Fenster der ersten Etage waren trotz des kalten Wetters weit geöffnet, und durch die Lücken der nicht ganz geschlossenen schweren Vorhänge drang ein heller Lichtstrom. Von Zeit zu Zeit ertönte im Innern der königlichen Gemächer lautes Gelächter, auf das bald leises, bald lautes Murmeln mehrerer Stimmen oder auch momentanes Stillschweigen folgte. Oft brach nach einer Rede eine Salve stürmischen Beifalls los, und dabei erklang von neuem jenes schallende Gelächter, ein wildes, ausgelassenes Lachen, welches nur von einem Manne kommen konnte, der sich nicht davor zu fürchten brauchte, dass man ihn so lachen hörte, dass man ihm dies als unschicklich anrechnen werde.
Sooft dieses wilde Gelächter erscholl, blieb die Schildwache unten im Hofe stehen und blickte sekundenlang zu den hell erleuchteten Fenstern hinauf, um danach seufzend ihre monotone Wanderung wiederaufzunehmen.
Der Kontrast zwischen dem anscheinend ausgestorbenen Schloss, der stummen Stadt, den entfesselten Elementen und der königlichen Orgie war geradezu von peinlicher, ja fast unheimlicher Wirkung.
Seitdem jener seltsame Wahnwitzige, der sich Karl XII. nannte, August den Starken besiegt hatte, versammelte dieser seine Freunde immer häufiger zu schwelgerischen Gelagen.
König August schämte sich seiner Niederlage derart, dass er es geflissentlich vermied, öffentlich zu erscheinen. Selbst bei Hofe zeigte er sich nicht. Da der Vergnügungssüchtige aber ohne Zerstreuung nicht existieren konnte, war er auf den Gedanken gekommen, die Zeit im Kreise seiner Vertrauten mit Trinken totzuschlagen.
Da wurde goldener, köstlicher ungarischer Wein aufgetragen, der aus Reben stammte, die alljährlich unter der Aufsicht königlicher Abgesandter gelesen und gekeltert wurden. Der König ließ die Becher ohne Unterbrechung füllen und leeren, bis endlich der Tag graute, die schlaf- und weintrunkenen Gesellen zu Boden sanken und August sich lachend erhob, um, von Hoffmann, seinem Lieblingskammerdiener, unterstützt, das Lager aufzusuchen.
Zu diesen bacchantischen Gelagen wurden nur die Vertrauten des Königs hinzugezogen, weil August, wie man sagte, den Personen, die er nicht liebte, im weinseligen Zustande höchst gefährlich werden konnte. Augusts herkulische Kraft machte seinen Zorn fürchterlich. Außerdem besaß der König unumschränkte Gewalt. In den Morgenstunden, wenn er noch nüchtern war, pflegte er sich zu beherrschen. Zwar wurde sein Gesicht im Zorn feuerrot, aber er blieb immer Herr seiner selbst und wandte nur demjenigen, der seinen Zorn erregte, mit einer schroffen Bewegung den Rücken zu.
Anders am Abend. Wehe dem, der ihn am Abend reizte! Der Unglückliche, der August erzürnte, konnte, ehe er sich versah, zum Fenster hinausfliegen, um sich die Hirnschale auf dem Pflaster des Hofes zu zerschmettern.
Zum Glück stellten sich diese Zornesanfälle selten ein. Im Privatleben und in intimen Kreisen war August ja der liebenswürdigste, nachsichtigste und gütigste Gebieter der Welt; ja man hatte sogar ziemlich oft bemerkt, dass seine Liebens-Würdigkeit und Zuvorkommenheit in dem Maße stiegen, wie seine Antipathie gegen irgendeine Person zunahm. Sein Naturell war eben edel und barmherzig und drängte ihn, diejenigen zu trösten, die er vernichten musste. So geschah es denn, dass diejenigen, die auf seinen Befehl nach dem Königstein abgeführt werden sollten, nach jener Festung, wo die in Ungnade gefallenen Günstlinge Augusts häufig jahrelang schmachteten, am Vorabend ihrer Verhaftung vom König immer herzlichst umarmt wurden, als wären sie seine besten und liebsten Freunde.
Sich zu unterhalten, das war es hauptsächlich, wonach August strebte. Kein Wunder daher, dass er sich zuweilen heißhungrige Bären vorführen ließ und sich an dem Schauspiel ergötzte, sie einander auffressen zu sehen. Auch liebte er es, seine Günstlinge betrunken zu machen und sie alsdann gegeneinander aufzuhetzen. Wenn die weintrunkenen Gesellen handgemein wurden, wie herzlich konnte August da lachen!
Der Anblick war ja so drollig.
Zwietracht in die Geister der Höflinge zu säen, war für den König eine leichte Sache. Kannte er doch nicht nur die Verhältnisse, sondern auch die Geheimnisse jedes einzelnen genau. Was immer bei Hofe geschehen mochte» das erfuhr August durch seine Spione, die sich auch gegenseitige Angebereien zuschulden kommen ließen. Nichts entging ihm, und was er nicht sehen konnte, das erriet er. Niemand wusste, wer den König von allem, was vorging, in Kenntnis setzte. Jedermann beargwöhnte seinen Nächsten; der Bruder fürchtete den Bruder, der Gatte die Gattin, die Eltern ihre Kinder.
August den Starken aber erheiterte die Angst dieser guten Leute; er konnte über ihren panischen Schrecken laut auflachen. Es war für ihn unterhaltsam, von der Höhe seines Thrones aus der Komödie des Lebens zuzusehen, doch verschmähte er es auch nicht, sich zuweilen an derselben zu beteiligen und die Rolle des Herkules oder des Apollo zu spielen. Am Abend aber übernahm er am liebsten die des Bacchus.
Der Saal, in welchem sich der König und dessen Gäste befanden, war glänzend erleuchtet. Glitzerndes, blankes Kristall- und Silbergerät stand auf den eichenen Konsolen, ein silbernes Fass mit goldenem Reif thronte auf dem Büfett, in dessen Nähe, rings um einen länglichen Tisch aus geschnitztem Eichenholz, die Genossen der schwelgerischen Gelage des Königs saßen. Unter ihnen bemerkte man den erst kürzlich aus Rom zurückgekehrten Grafen Taparel Lagnasco, Wackerbarth aus Wien, Watzdorf, den sogenannten „Bauern von Mansfeld“, Fürstenberg, Friesen, Vitzthum, Hoym und den berühmten Friedrich Wilhelm Freiherrn von Kyau, einen der geistreichsten Männer seiner Zeit, der, mit unversiegbarem Witz begabt, trotz seiner ewig ernsthaften Miene die Fähigkeit besaß, die betrübtesten und verdrießlichsten Menschen zum Lachen zu bringen.
Starr vor sich hinsehend, auf dem sonst so heiteren Gesicht einen düsteren, brütenden Ausdruck, saß August am oberen Ende der Tafel, das Haupt auf den auf der Lehne des Sessels ruhenden Arm gestützt. Die leeren Flaschen, die neben seinem Pokal vor ihm auf dem Tische standen, lieferten den Beweis, dass er nicht eben jetzt zu zechen begonnen hatte. Indes hatte der göttliche Nektar heute nicht die gewöhnliche Wirkung gehabt, sein goldener Reflex war noch nicht auf die düsteren Gedanken des Fürsten gefallen, dessen ganzes Wesen Schwermut atmete.
Die Gäste hatten wiederholt den Versuch unternommen, ihren Gebieter zu erheitern. Vergebens! Träumend starrte er ins Leere, er sah sie nicht, er hörte sie nicht. Dieses Benehmen war für einen Fürsten, der stets bemüht war, sich zu zerstreuen und zu unterhalten, und der alles auf die leichte Schulter zu nehmen pflegte, auffallend genug. Kein Wunder daher, dass ihn die Höflinge nicht ohne Bestürzung von der Seite ansahen und bedenklich die Köpfe schüttelten.
„Gott steh uns bei!“ raunte Fürstenberg seinem Nachbar Wackerbarth ins Ohr. „Sieh dir den König an! Was mag ihn plötzlich verstimmt haben? Es ist schon elf Uhr. Um diese Stunde pflegt er sonst über die Maßen fröhlich zu sein. Wir unterhalten ihn nicht...“
„Dafür kann ich nicht, bin ich doch nur ein Fremder hier“, fiel Wackerbarth in leisem Tone ein und kniff seine weinseligen Augen zusammen. „Ihr, die ihr immer um ihn seid, solltet doch wissen, was ihm fehlt.“
Hier wandte sich Graf Lagnasco an die beiden Herren und bemerkte: „Vermutlich langweilt ihn die Lubomirska.“ „Ich glaube eher, dass die Schweden an seiner üblen Laune schuld sind“, sagte der Wiener. „Donnerwetter, so eine Niederlage ist unverdaulich ...“
„Bah!“ unterbrach ihn Fürstenberg. „Er denkt gar nicht mehr an die Schweden. Seid unbesorgt, Wackerbarth, Schweden findet dereinst seinen Meister, und das kommt dann uns zugute. Nein“, fuhr er mit gedämpfter Stimme fort, „nicht Schweden ists, was des Fürsten Herz beschwert, sondern die Lubomirska, deren er überdrüssig ist. Lagnasco hat recht. Es ist unumgänglich notwendig, dass wir für ihn eine neue Mätresse finden.“
„Ist das nicht leicht genug?“ fragte Wackerbarth. „Gewiss“, lachte Lagnasco. „Immerhin hättet Ihr wohl daran getan, uns aus Wien eine neue Esterle mitzubringen.“ Das Gespräch verstummte, denn August war aus seinem' stillen Brüten erwacht und ließ jetzt seinen scharfen Blick über die Gäste schweifen. Seine Augen blieben an dem am unteren Ende der Tafel sitzenden Freiherrn von Kyau haften. Der wunderliche Mann schien sich über seinen Gebieter oder vielmehr über dessen Stimmung lustig zu machen, denn er hatte die Beine von sich gestreckt und brachte aus seiner Brust die tiefsten Seufzer hervor. Das Haupt ruhte melancholisch auf seiner Rechten, während die linke Hand schlaff herabhing. Er sah in dieser Stellung so komisch aus, dass August unwillkürlich lachen musste. Nun brachen selbstverständlich auch sämtliche Höflinge in helles Lachen aus, obwohl nur einige von ihnen wussten, worüber der König zu lachen geruht hatte.
Kyau rührte sich nicht.
„Nun, Kyau, was ist dir?“ rief August in heiterem Tone.
„Hast du kein Geld? Hat dich deine Geliebte betrogen? Wer dich sieht, möchte glauben, ein unsichtbarer Geier zerfleische dein Inneres. Sprich, Prometheus, was fehlt dir?“ „Mich quält kein persönliches Übel, mein Fürst“, seufzte der Baron. „Ich habe weder Hunger noch Durst, mich drückt weder Liebe noch Eifersucht, noch Mangel an Geld. Trotzdem bin ich verzweifelt.“
„Wer aber hat dich in diesen beklagenswerten Zustand versetzt?“ rief August.
„Kein Geringerer als Eure Majestät“, erwiderte in tragischem Ton Kyau. „Was mich so traurig stimmt, ist das Schicksal meines geliebten, unglücklichen Gebieters. Schön wie ein Gott, stark wie ein Herkules, schien er mit seinem edlen Herzen und seiner unvergleichlichen Tapferkeit für das Glück geboren, die Welt sollte zu seinen Füßen liegen — und dennoch besitzt er nichts, nichts!“
„Wahr, wahr!“ murmelte August mit zusammengezogenen Brauen und gesenktem Blick.
„Wir sind hier unserer viele, und keinem von uns gelingt es, unseren königlichen Herrn aufzuheitern“, fuhr Kyau mit komischem Pathos fort. „Seine Mätressen altern und hintergehen ihn, sein Wein versauert, sein Geld wird gestohlen.“
Wenn er aber seine treuen, ihm ergebenen Diener zu fröhlichem Gezecht herbeiruft, so tut er ihnen mit der Miene eines Leichenbitters Bescheid. Das ists, mein Fürst, was mich bekümmert.“
August erfasste lächelnd seinen Pokal und stieß ihn wiederholt gegen den Tisch. Infolgedessen stürzten die beiden Zwerge, welche bislang regungslos neben dem Büfett gestanden hatten, herbei und stellten sich in ehrerbietiger Haltung vor dem König auf, seines Befehles gewärtig.
„Tramm“, sagte August zu einem der beiden Zwerge mit aufgeheiterter Miene, „schaff uns Ambrosia! Wahrlich, der Wein, den wir getrunken, war allzu zahm!“ „Ambrosia“ nannte man jenen berühmten Wein, den Zichy eigens für den König aus nicht gekelterten Trauben hatte bereiten lassen, süß und ölig, dabei aber heimtückisch, dass er einen Riesen umzuwerfen vermochte.
Die beiden Zwerge eilten aus dem Saal. Nach einigen Sekunden erschien ein Neger in orientalischer Tracht, in den Händen ein silbernes Servierbrett, auf dem ein ungeheurer Krug stand. Die Herren erhoben sich von ihren Sitzen und verneigten sich mit komischem Ernst vor dem göttlichen Nektar.
König August aber wandte sich Kyau zu und rief: „Baron, ich ernenne dich zu meinem Mundschenk. Walte deines Amtes!“
Kyau betrachtete die Gläser, welche die Zwerge unterdessen auf den Tisch gestellt hatten. Sie schienen ihm nicht zuzusagen. Nachdem er den Kleinen einige Worte zugeflüstert hatte, brachten sie eine Anzahl Gläser von verschiedener Größe herbei.
Mit der straffen Haltung eines Mannes, der sich seiner Würde wohl bewusst ist, stellte Kyau die Gläser auf. Rings um den königlichen Pokal stellte er einen Kranz kleiner Gläser auf, die von einem Kreise noch kleinerer umgeben wurden. Unter den letzteren fanden sich welche, die nicht größer als ein Fingerhut waren.
Die Gäste beobachteten schweigend das Beginnen des Mundschenk. Kyau nahm den Krug und begann den Wein auszuschenken. Zunächst füllte er die kleinsten Gläser.
Wenngleich jedes einzelne Gläschen nur wenige Tropfen Weines zu fassen vermochte, so war doch die Zahl der Gläschen so groß, dass der Mundschenk zwei Drittel des Kruges leeren musste, um sie zu füllen. Der Rest wurde in die größeren Gläser gegossen; für den König waren nur einige Tropfen geblieben. Kyau tröpfelte die Neige des Kruges in den fürstlichen Pokal und blickte zum König hinüber.
„Ein sauberer Mundschenk, fürwahr!“ rief August. „Du scheinst zu glauben, dass ich zuletzt bedient zu werden verdiene. Was soll das bedeuten?“
Die Herren lachten verlegen. Kyau aber sagte, den leeren Krug auf den Tisch setzend, mit der Ruhe, die ihm eigen war:
„Die Antwort auf diese Frage ist nichts weniger als neu; was Eure Majestät jetzt sah, sehen Sie ja alle Tage. Wie ich mit dem Weine verfuhr, so verfahren die Minister unseres königlichen Herrn mit den Einkünften des Staates. Zunächst füllen die unteren Beamten ihre Säckel, hierauf tun die höheren ein Gleiches, und kommt endlich die Reihe an den König, so ist nichts mehr da...“
„Bravo!“ unterbrach ihn händeklatschend der Fürst. „Dieses Gleichnis wäre eines Äsop würdig gewesen!... Jetzt aber lass schnell auch für mich Wein herbeibringen, auf dass ich mein Glas auf dein Wohl leeren kann.“
Kaum war der Fürst mit seiner Rede zu Ende, als der Neger mit dem ambrosischen Wein erschien. Während Kyau den riesigen Pokal des Fürsten füllte, fiel so mancher böse Blick auf ihn. Wie sehr die Herren auch über den Einfall des Mundschenks gelacht hatten, jeder ärgerte sich im Stillen darüber.
Aber alle traten mit lächelnder Miene vor König August hin, beugten ein Knie und hielten die gefüllten Becher, die sie in den Händen hatten, hoch empor. „Es lebe der sächsische Herkules!“ rief Kyau. Der Toast ging von Mund zu Mund, und August leerte seinen Pokal nach einem gnädigen Kopfnicken gegen den Baron, während die Herren aufsprangen, gleichfalls ihre Gläser leerten und dann wieder am Tisch Platz nahmen.
„Mein Herr und König“, rief Fürstenberg, „lass uns von dem reden, von dem allein in dieser Stunde gesprochen werden sollte, von den Wesen, welche bei Tag und Nacht regieren: von den Frauen!“
„Wohlan, es soll ein jeder uns das Bild der Dame seines Herzens zeichnen“, sprach August. „Fang du an, Fürstenberg!“
Ein boshaftes Lächeln umspielte bei diesen Worten die Lippen des Fürsten. Augusts Liebling aber wurde über und über rot; er warf einen verzweifelten Blick auf seinen hohen Gebieter und bat ihn, er möge ihm die Beschreibung seiner Schönen erlassen.
„Nein! Nein!“ riefen mehrere Stimmen zugleich. „Das Porträt, Fürstenberg, das Porträt!“
Fürstenberg zögerte. Er hatte vollauf Grund hierzu, denn die Dame, in welche er sich in einem kritischen Moment des Lebens verliebt hatte oder vielmehr verliebt zu haben vorgab, diese Dame schminkte sich die Jugendfrische an und zählte mehr als vierzig Jahre. Frau von Friesen war Witwe. Sie besaß viel Geld, während Fürstenberg keines hatte. Er strebte zwar nicht nach der Hand der reichen Witwe, aber er war ihr steter Begleiter. Sowohl bei allen Festen wie auf Reisen sah man ihn immer mit ihr.
Die Gesellschaft bestand darauf, dass Fürstenberg ihr seine Schöne schildere. Alle schrien durcheinander. Endlich wurde der Lärm so groß, dass der König Stillschweigen gebot. „Du sträubst dich vergebens, Fürstenberg“, rief August lachend.
„Mut, mein Junge, und fang an! Male sie uns vor, wie sie sich selbst nicht schöner malen könnte.“ Der junge Mann leerte sein Glas in einem Zuge, wie um sich Mut zu machen, und begann: „Die Dame meines Herzens ist die Blume der Frauen. So mancher unter euch dürfte anderer Meinung sein, dürfte meiner Dame einen Vorwurf daraus machen, dass sie ihre Schönheit künstlichen Mitteln verdankt. Was verschlägts? Ist doch dadurch ihre Schönheit ewig wie die der Unsterblichen, braucht sie doch das, was so viele ängstigt, nicht zu fürchten: den Zahn der Zeit!“ Schallendes Gelächter unterbrach diese Rede.
„Hoym!“ rief jetzt August und heftete seinen Blick auf den Nachbar Fürstenbergs, einen Mann von schönem Körperbau, dessen Gesicht mit den kleinen, listigen, stechenden Augen jedoch nicht besonders anziehend war. „Hoym, jetzt ist die Reihe an dir, zu erzählen. Wir lassen keinerlei Ausflüchte gelten. Du bist, was die Weiber betrifft, ein feiner Kenner, und Glück hast du bei den Frauen wie kein anderer. Auch wissen wir alle, dass dir galante Abenteuer zum Bedürfnis geworden sind. Erzähle uns also eine lustige Geschichte. Beichte, Hoym, beichte! Du weißt ja, dass das, was an diesem Ort zur Sprache kommt, nie ausgeplaudert wird.“
Hoym lachte vergnügt und blinzelte die Gäste der Reihe nach an. Die Bewegungen seines Kopfes, der bald nach dieser, bald nach jener Seite fiel, sein gezwungenes Lächeln, seine glühenden Wangen, kurz, alles an ihm verriet, dass er betrunken war.
Sowohl dem König wie seinen Gefährten war es angenehm, dass sich der Finanzminister Hoym in einem Zustand befand, in dem sich die Zunge nicht durch den Verstand im Zaum halten lässt. Sie hofften, die ergötzlichsten Geschichten aus dem Mund des Betrunkenen zu vernehmen. Hoym stand im Ruf eines Don Juan. Es hieß zwar, dass er seit einigen Jahren einen gesetzteren Lebenswandel führe, weil er sich verheiratet habe, jedoch wusste so mancher, dass er noch immer seinen galanten Abenteuern nachging, dass dies allerdings jetzt im geheimen geschah, während er früher aus seinem Glück bei den Weibern kein Hehl gemacht hatte. Seine Gattin sah man nie.
Es hieß, dass Hoym sie irgendwo auf dem Lande verborgen halte.
Auf ein Zeichen des Königs füllte Kyau den Becher des Finanzministers. Dieser nahm den Pokal und trank den ambrosischen Wein mit jener unbewussten Gier, welche den Betrunkenen, die der Nachdurst verzehrt, eigen ist. Sein Gesicht wurde feuerrot.
„Meine Mätresse soll ich schildern?“ lallte Hoym. „Wie wäre das möglich, da ich gar keine Mätresse besitze. Wozu auch? Ist doch meine Frau schön wie eine Göttin.“ Auf diese Worte folgte allgemeines Gelächter. Nur der König blieb ernst und blickte Hoym unverwandt an.
„Warum lacht ihr?“ fragte Hoym mit schwerer Zunge, „Glaubt ihr, was ich gesagt habe, sei nicht wahr? Oh, wer meine Frau nicht gesehen hat, weiß nicht, wie Venus aussah. Ja, ich bin überzeugt, dass Aphrodite neben ihr für eine Waschfrau gehalten würde. Haha! Wie wäre es möglich, sie zu schildern? Ihre Augen sind von unwiderstehlicher Gewalt, ihre Formen von klassischer Schönheit, ihr Lächeln... ah, dieses einzige Lächeln!...“
Die einen zuckten die Achseln, die anderen lächelten ungläubig. August aber schlug mit der Faust auf den Tisch und rief: „Weiter, weiter! Und seufze nicht so oft; schildere rascher und besser! Wir wollen ein anschauliches Bild von diesem unvergleichlichen Geschöpf haben.“
„Ihr Lächeln ist unbeschreiblich“, fuhr der Finanzminister in fast unverständlichem Lallen fort. „Leider lächelt sie nur selten, denn meine Göttin ist streng, ja furchtbar!“ Er hielt inne.
„Fahre fort!“ herrschte ihn August an. „Beschreibe uns ihre Schönheit.“
„Wer vermöchte die Vollkommenheit zu schildern?“ lallte Hoym und starrte zur Decke des Saales empor.
„Ich fange an zu glauben, dass seine Gattin in der Tat schön ist“, bemerkte Lagnasco.
„Liebt er sie doch seit drei Jahren“, rief ein anderer Edelmann. „So lange ists, dass er auf fremdem Gebiet nicht mehr jagt.“
„Bah, er übertreibt!“ meinte Fürstenberg. „Er ist ja betrunken. Schöner als die Teschen-Lubomirska kann seine Frau nicht sein.“
Hoym warf einen scheuen Seitenblick auf den König. Dieser fragte in ruhigem Ton, ob seine Gattin wirklich schöner sei als Lubomirska, seine, Augusts Geliebte. „Sei aufrichtig“, fügte August hinzu. „Hier braucht man nichts zu berücksichtigen als die Wahrheit.“
„Oh, mein Fürst!“ rief Hoym in heller Verzückung. „Die Prinzessin ist schön, ich weiß es; meine Frau aber ist bei weitem die Schönere von beiden, ja, ich behaupte, dass der Hof, die Stadt, ganz Sachsen, ganz Europa nicht ihresgleichen aufzuweisen hat. Welch ein Weib! Ein einziges Wesen!“
Hoym hielt plötzlich inne. Sein Blick war zufällig auf August gefallen, und der lauernde Ausdruck auf dessen Gesicht hatte ihn erschreckt. Der König schien keines seiner Worte, keine seiner Bewegungen verlieren zu wollen. Der Schreck ließ in Hoym die Besinnung wieder aufdämmern; er wollte seine Worte zurücknehmen, aber es war schon zu spät. Er schwieg, und ohne auf die Zurufe der Gesellschaft zu achten, die ihn bat, mit seiner Rede fortzufahren, ließ er sein Haupt auf die Brust sinken, um den seltsamsten Gedanken nachzuhängen.
August aber winkte dem Freiherrn von Kyau, die Becher zu füllen. Der königliche Mundschenk gehorchte, worauf Fürstenberg einen Toast auf August-Apollo ausbrachte. Die Herren erhoben sich. Einige leerten ihre Gläser mit gebeugtem Knie, andere stehend. Hoym wankte und musste sich auf die Tischplatte stützen, um sich aufrecht zu halten. Die Trunkenheit, welche der Schreck momentan verscheucht hatte, kehrte mit verdoppelter Vehemenz zurück. Ohne zu wissen, was er tat, nahm er sein volles Glas in die zitternde Hand und trank es aus.
Hinter dem Sessel des Königs stand Fürstenberg, Augusts treuer Gefährte, der Vertraute all seiner galanten Intrigen, dem er den familiären kurzen Beinamen „Fürstchen“ gegeben hatte.
„Fürstchen“, begann August-Apollo, zu seinem Günstling gewandt, in gedämpftem Ton, „der Akzisor hat die Wahrheit gesprochen. Wir müssen ihn zwingen, uns den Schatz, den er seit einigen Jahren so behutsam verbirgt, zu zeigen. Ich gebe dir carte blanche... tu, was du willst, spare weder Geld noch Mittel, nur zeige sie mir. Ich will seine Frau sehen.“ Fürstenberg lächelte. Diese Laune konnte ihm und anderen Vorteile bringen. Prinzessin Teschen, die augenblickliche Geliebte des Fürsten, hatte viele Feinde, namentlich unter den Parteigängern und Freunden des Kanzlers Beichling, dessen prächtiges Palais in der Pirnaischen Gasse nach seinem Sturz in ihren Besitz übergegangen war. Zwar verteidigte Fürstenberg die Mätresse des Königs gegen alle Angriffe seitens der Damen des sächsischen Hofes, aber das hinderte ihn nicht, jetzt gegen sie aufzutreten, sie der Gefahr auszusetzen, von einem anderen Weibe verdrängt zu werden. Die etwas verwelkte Schöne mit dem sentimentalen Wesen begann August, der bei den Frauen ein heiteres, mutwilliges Naturell liebte, zu missfallen. Fürstenberg, der dies wusste, erriet den Hintergedanken seines Gebieters. Er trat zu dem Finanzminister und raunte ihm ins Ohr: „Akzisor, Akzisor, ich erröte für dich, denn du hast eine freche Lüge ausgesprochen; du hast dich über uns lustig gemacht. Vergaßest du, dass dein König zugegen ist? Wir wollen ja glauben, dass deine Frau kein gewöhnliches Weib ist, allein eine Venus, eine Göttin, eine Teschen ist sie nicht. Gestehe es nur, du hast übertrieben.“
„Tausend Donnerwetter!“ schrie der Betrunkene. „Ich habe nicht gelogen! Jetzt aber lasst mich in Frieden, Blitz Element!“
August nahm die Heftigkeit Hoyms nicht übel. Bei den königlichen Trinkgelagen war alles erlaubt. Im betrunkenen Zustand durften die unbedeutendsten Gäste den Goliath ungestraft umarmen.
„Hoym!“ rief Fürstenberg laut. „Ich wette tausend Dukaten, dass deine Frau die Schönen des Hofes an Anmut nicht übertrifft.“
„Die tausend Dukaten sind mein“, jubelte der Akzisor, „sie sind mein!“
„Darüber werde ich entscheiden“, fiel August in ernstem Ton ein, „und zwar ohne Verzug. Hoym muss seine Gattin nach Dresden kommen lassen und sie uns beim nächsten Hofball vorstellen.“
„Er soll sofort schreiben, sogleich! Der königliche Eilbote bestellt den Brief!“ riefen verschiedene Stimmen. Das erforderliche Schreibzeug herbeizubringen und Hoym eine Feder in die Hand zu drücken, war das Werk eines Augenblicks.
Auf ein Zeichen des Königs fing der unglückliche Mann an zu schreiben, was ihm August diktierte. Sobald die an seine Frau gerichtete Aufforderung, unverzüglich nach Dresden zu kommen, zu Papier gebracht war, entriss man ihm den Brief, und einer der Höflinge stürzte mit demselben davon, um dem Eilboten des Königs den Befehl zu erteilen, das Schreiben nach Laubegast zu befördern.
„Fürstchen“, flüsterte der König seinem Günstling ins Ohr, „ich fürchte, dass Hoym seinen Befehl widerrufen würde, wenn er zur Besinnung käme. Gib ihm zu trinken, bis er sich nicht mehr rühren kann.“
„Sire, er hat sich ja bereits fast zu Tode getrunken“, meinte Fürstenberg.
„Desto besser!“ lachte der König. „Wenn er stürbe, ließe ich ihn auf meine Kosten mit Gepränge bestatten. Es fände sich schon jemand, der den Akzisor ersetzte.“
Dieser Scherz, der keineswegs im Flüsterton vorgebracht worden war und den die Zunächst stehenden gehört hatten, veranlasste einige Höflinge, sich um den beklagenswerten Akzisor zu scharen und ihn durch hunderterlei Sticheleien und Toaste zu zwingen, Glas auf Glas zu leeren. Eine halbe Stunde später fiel Hoym, wie vom Schlag gerührt, vom Stuhl.
Auf einen Wink des Königs sprangen zwei Heiducken herbei, um den Finanzminister aufzuheben und ihn aus dem Saal zu schaffen. Weniger aus Mitleid als aus Vorsicht ließ man den Bewusstlosen in ein an das Kabinett des Königs anstoßendes Gemach bringen, statt ihn in seine Wohnung zu transportieren. Er wurde auf ein Ruhebett gelegt und dem Riesen Kojanus mit dem gemessenen Befehl übergeben, nicht zu gestatten, dass er das Schloss verlasse, für den Fall, dass er aufwache und nach Hause zu gehen wünsche. Es wäre jedoch nicht nötig gewesen, diese Vorsichtsmaßregel zu treffen, denn Hoym verbrachte unter erbärmlichem Stöhnen die ganze Nacht in bewusstlosem Zustand.
Im Trinksaal wurde die Orgie fortgesetzt, nachdem ihn die Heiducken mit dem Akzisor verlassen hatten. Der König war bei heiterster Laune; seine Ausgelassenheit spiegelte sich auf den Gesichtern sämtlicher Hofleute ab. Als der Tag zu grauen begann, wurde August, der allein noch aufrecht saß, von den Heiducken auf sein Lager gebracht.
Vielleicht beschuldigt mich der Leser der Übertreibung...
Ach, leider entspricht jeder Zug, jede Einzelheit dieses Zeitgemäldes, selbst die geringfügigste, der reinen Wahrheit.
Fürstenberg, der sich geschickter Weise die volle Klarheit seines Geistes zu bewahren gewusst hatte, richtete sich auf und betrachtete eine Weile schweigend den Schauplatz der Orgie.
Dann sagte er bei sich: „Uns steht eine neue Herrschaft bevor. Lubomirska ist ein gefährliches Weib; sie könnte sich noch einen uns verhängnisvollen Einfluss erringen und den König nach Willkür leiten. Wozu braucht August eine Frau mit Verstand? Den König lieben, ihn unterhalten, darin besteht die Mission einer Favoritin. Wir werden uns diese Hoym ansehen!“
ZWEITES KAPITEL: Anna von Hoym
Laubegast liegt zwei Stunden von Dresden entfernt, am Ufer der Elbe. Zu jener Zeit bestand das kleine Dorf nur aus wenigen, inmitten uralter Linden und Buchen und hoher Tannen gelegenen, von reichen Edelleuten bewohnten Häusern.
Dorthin begab sich insgeheim der Finanzminister Augusts II., sooft es ihm die Geschäfte erlaubten, und brachte daselbst den Abend oder einen Teil des Tages zu. War der König nicht in Dresden, so hielt sich Hoym ganze Wochen in Laubegast auf. Hoyms Haus in Laubegast glich allen übrigen Häusern jener Zeit. Auf dem hohen Dach bemerkte man die den französischen Gebäuden eigentümlichen Mansarden.
Die Mauern waren mit Statuen und Zierrat in halb erhabener Arbeit geschmückt. Die Arbeiter, die aus Dresden gekommen waren, um das Haus zu restaurieren, hatten dem bescheidenen Gebäude ein fast elegantes Aussehen gegeben.
Man sah es demselben an, dass sein Besitzer bemüht gewesen war, es zu verschönern. Den kleinen Hof umgab ein geschmackvolles Gitterwerk, das von Vasen tragenden Säulen unterbrochen war. Zwei Pfeiler, welche die übrigen Säulen überragten, bildeten das Portal. Sie trugen eine Gruppe pausbäckiger Engel, die ihrerseits zwei Laternen emporhielten.
Hübsche Statuen und Marmorvasen mit exotischen Blumen schmückten das Peristyl. Von mächtigen Bäumen umgeben, sah das Gebäude stattlich genug aus. Doch es herrschte eine klösterliche Stille darin, es war dort öde wie in einer Ruine.
Man vermisste jene zahlreiche, lärmende, hin und her eilende Dienerschaft, die den herrschaftlichen Häusern eigen ist.
Zwei alte Kammerdiener, einige Mägde und eine Dame, die gegen Abend mit einem Buch in der Hand unter den hohen Bäumen im Garten lustwandelte, schienen die einzigen Bewohner des Hoymschen Hauses zu sein.
Der Anblick der Dame erregte bei den Bewohnern von Laubegast Ehrfurcht und Bewunderung zugleich. Im Gebüsch und hinter den Baumgruppen versteckt, lauerten sie ihr auf, um sie zu betrachten. Sie war aber auch eine seltsame Erscheinung für jenen Ort.
Noch niemand hatte etwas Ähnliches erschaut, etwas Schöneres erträumt. Die junge Frau war von hoher Gestalt und edler Haltung. Sie hatte schwarze, klare, durchdringende Augen und eine selten schöne blendendweiße Hautfarbe. Wenn sie so unter den hohen Bäumen dahinschritt, strahlend von Jugend und Schönheit, erfüllte sie alle, die sie sahen, mit einer Art Scheu. Es lag etwas Gebieterisches, Königliches in ihrem Wesen, sodass bei ihrem Anblick jeden die Lust anwandelte, sich ihr zu Füßen zu werfen.
Sie war immer traurig und ernst. Ihre Augen, ihre Lippen lächelten nie. Wenn sie zum heiteren Himmel emporschaute, drückte ihr Blick nicht die mindeste Freude aus. Sie blickte gewöhnlich entweder still vor sich hin, oder ihre Augen hafteten unverwandt an der grauen Wasserfläche der Elbe oder an den farbenreichen Blumen des Gartens, die sie niemals pflückte, aber deren Duft sie einsog. Sie schien unglücklich zu sein. Oder empfand sie nur Langeweile? Jedermann wusste, dass sie seit mehreren Jahren ein völlig zurückgezogenes Leben führte. Außer Frau von Vitzthum, der Schwester ihres Gatten, besuchte sie niemand. Hoym war es nichts weniger als angenehm, dass Anna mit seiner Schwester verkehrte. Er wusste, dass diese einst bei August II. eine Zeitlang in Gunst gestanden hatte und noch immer die Hoffnung hegte, den verlorenen Einfluss wiederzugewinnen. Hoym suchte seine Frau gegen die Kabalen des Hofes zu wappnen; er hätte seine gefährliche Schwester von ihr fernzuhalten gewünscht. Allein, Frau von Vitzthum zuckte bei seinen Bitten, der unschuldigen Anna keine Schilderungen des verderbten Dresdener Hofes zu machen, die Achseln und hörte nicht auf, ihre Schwägerin zu besuchen und ihr skandalöse Histörchen über August den Starken und dessen Umgebung zu erzählen. Die arme Einsiedlerin langweilte sich zum Sterben. Die Lektüre und die Promenaden bildeten ihren einzigen Zeitvertreib. Sie verschlang die frommen, schwärmerischen Werke protestantischer Schriftsteller und verließ das Haus nur unter der Obhut eines alten Kammerdieners.
Dieses einförmige Leben war freilich monoton genug. Auch keine Stürme der Leidenschaft wühlten dieses Leben auf.
Hoym, der am Anfang seiner Ehe mit Anna ungemein zärtlich und zuvorkommend gegen sie gewesen war, hatte ein allzu leichtfertiges Wesen, als dass er seinen liederlichen Neigungen lange hätte widerstehen können. Er war des Glückes zuletzt überdrüssig geworden und vergaß jetzt zuweilen, dass er eine Frau besaß. Zwar liebte er sie noch immer, aber auf eine eigenartige Weise, nämlich mit Eifersucht. Er suchte seinen Schatz vor der ganzen Welt zu verbergen und erlaubte seiner Gattin nur dann zu ihrer Zerstreuung nach Dresden zu kommen, wenn der König und der Hof nicht daselbst weilten und die Hauptstadt wie ausgestorben war. Die Gefangenschaft der letzten Jahre hatte die junge Frau mit tiefster Verbitterung erfüllt, die traurigsten Gedanken in ihr erregt und einen Abscheu vor der Welt in ihr geweckt, der sie asketisch stimmte. Für sie war das Buch des Lebens geschlossen. Sie hatte sich damit abgefunden, freudlos dahinzuvegetieren, bis ihr Geist erlöschen würde, und sie war doch schön wie ein Engel, zählte nur vierundzwanzig Jahre und sah so jung aus, dass sie für ein achtzehnjähriges Mädchen gelten konnte. Frau von Vitzthum, die im Alter der glühenden Leidenschaften sowohl ihre Jugendfrische als auch einen Teil ihrer Reize verloren hatte, konnte ihrer Schwägerin diesen Anschein ewiger Jungfräulichkeit nicht verzeihen. Auch die wunderbaren Eigenschaften der jungen Frau bereiteten ihr Ärger: Ihr edler Tugendstolz, die Entrüstung, welche jedwede Ausschweifung in ihr hervorrief, ihre Verachtung für Intrigen und Lügen, ihre wahrhaft königliche Hoheit erfüllten die so lebensfrohe, lebhafte und falsche Frau mit Neid und Bitterkeit. Oft regte sich in ihr der Wunsch, Anna gedemütigt zu sehen. Frau von Hoym liebte ihre Schwägerin nicht, im Gegenteil, sie empfand eine tiefe Abneigung gegen sie. Ihren Gatten aber verachtete sie. Von Frau von Vitzthum hatte Anna schon längst erfahren, dass Hoym ihr untreu war. Mit einem Blick hätte sie es vermocht, ihn zu ihren Füßen hinzustrecken; sie war sich ihrer Macht bewusst, jedoch schätzte sie ihren Gatten zu gering, als dass sie gewünscht hätte, ihn zu bestricken. Sie empfing ihn mit Kälte und entließ ihn mit Gleichgültigkeit. Seine Zornesausbrüche vermochten nicht, sie aus ihrer Apathie aufzurütteln oder sie zu veranlassen, ihre würdevolle Haltung aufzugeben.
Jeder Tag währte in Laubegast eine Ewigkeit. In den langen, einsamen Stunden gedachte die junge Frau oft ihrer Heimat, des geliebten Holstein, und sie fasste alsdann den Entschluss, nach Brockdorf, zu den Ihrigen, zurückzukehren; ein Entschluss, den sie jedoch bald wieder aufgab, weil sie von selten ihrer Angehörigen nichts als Gleichgültigkeit zu erhoffen hatte. Ihre Eltern waren schon längst gestorben. Auch war es wahrscheinlich, dass sie am Hofe der Prinzessin von Braunschweig, einer geborenen Fürstin Holstein-Plön, keine Aufnahme finden würde, weil diese ihr wohl noch nicht verziehen haben mochte, dass sie, Anna, ihre Hand gegen den Prinzen Ludwig Rudolf erhoben hatte, als dieser einst, von der Schönheit des Mädchens entzückt, versucht hatte, sie zu küssen. Wenn auch Dresden in geringer Entfernung von Laubegast lag und die Equipagen und Reiter der Hauptstadt zu jeder Stunde des Tages durch den Ort kamen, war es Frau von Hoym dennoch gelungen, von keinem der Höflinge Augusts jemals gesehen zu werden. Von keinem? Nein! Einer hatte sie erblickt, und zwar ein junger Pole, der vom Zufall oder vielmehr durch ein tückisches Verhängnis an den Hof Augusts II. gezogen worden war.
Während seines ersten Aufenthaltes in Polen unterließ August der Starke es nicht, die wunderbare Kraft, die ihm die Natur verliehen hatte, zur Schau zu steilen. Täglich gab er den polnischen Edelleuten nach der Mahlzeit einige Kunststücke zum Besten, Kunststücke, die darin bestanden, dass er einen Pokal aus massivem Silber zermalmte, Taler und Pferdehufe zerbrach. In Piekary sahen Augusts Gäste einmal staunend, aber schweigend einer solchen Kraftparade zu. Sie mochten sich im stillen fragen, was diese Riesenhände, in welche das Schicksal Polens gelegt worden war, aus ihrem Lande machen würden, als der Erzbischof von Kujawien plötzlich das Stillschweigen brach, den König mit Komplimenten überhäufte, jedoch anscheinend harmlos hinzufügte, dass er einen Mann, einen Jüngling, kenne, der das gleiche zu leisten vermöge.
Zornesröte ergoss sich über Augusts Gesicht. Da es aber am Anfang seiner Regierung war und er es für politisch hielt, den Liebenswürdigen zu spielen, verbarg er seinen Unwillen, den die Worte des Bischofs in ihm geweckt, und bat diesen, ihm seinen Nebenbuhler vorzustellen. Ihm sei noch nie im Leben ein Mensch begegnet, fügte der König hinzu, der sich mit ihm hätte messen können. Der Bischof verbeugte sich und versprach, dem Befehl gelegentlich nachzukommen, nahm sich aber im Stillen vor, dies aus Schicklichkeitsgründen zu unterlassen. Erst nachdem August ihn an sein Versprechen gemahnt hatte, ließ er Zaklika, so hieß der junge Herkules, durch seine Leute suchen. Zaklika, der einer alten, verarmten, adeligen Familie Polens entstammte und nicht die Mittel hatte, den in der Armee ihm gebührenden Rang einzunehmen, arbeitete seit einiger Zeit in einer dunklen Kanzlei in Warschau, um sich das tägliche Brot zu verdienen. Dort fanden ihn die Abgesandten des Bischofs. Da seine Kleidung alles andere als hoffähig war, ließ ihn der geistliche Herr vom Kopf bis zu den Füßen ausstatten. Mit dem Aussehen seines Schützlings wohl zufrieden, wartete der Bischof auf einen günstigen Augenblick, ihn dem König vorzustellen. Dieser Moment ließ nicht lange auf sich warten: Schon bei der nächsten Kraftschaustellung wandte sich der starke August gegen den in einer Ecke des Saales sitzenden Bischof Kujawiens und sagte: „Hochwürden, wo bleibt jener starke Mann, den Ihr uns zu zeigen versprächet?“ Der Bischof gab eine ausweichende Antwort. Als der König jedoch darauf bestand, den jungen Herkules zu sehen, ließ er den polnischen Edelmann kommen.
Zaklika war von hoher Gestalt und schönem, kräftigem Wuchs, doch sah er nicht aus wie ein Herkules, denn er war sehr schüchtern und hatte rosige Wangen wie ein junges Mädchen.
August der Starke lächelte, nachdem er Zaklika mit den Augen gemessen hatte. Da dieser von Adel war, durfte er dem König die Hand küssen. Hierauf ergriff August einen der beiden Silberpokale, welche vor ihm auf dem Tische standen, schloss denselben in seine Hand ein und zerdrückte ihn; der Wein, der sich noch auf dem Boden des Gefäßes befand, ergoss sich über den Tisch.
August schob dem Jüngling den zweiten Pokal hin und sagte mit einem ironischen Lächeln: „Jetzt triffts dich! Der Pokal ist dein, wenn es dir gelingt, ihn zu zermalmen.“ Zaklika näherte sich mit schüchterner Miene dem Tische, an dem König August saß, und nahm den silbernen Pokal in die Hand. Alle Anwesenden waren neugierig auf den Ausgang des Auftritts.
Ein Augenblick der Spannung. Es ergoss sich eine riefe Röte über das Antlitz des Jünglings. Dann ein Druck — und der Pokal war zermalmt.
Das Gesicht des Königs drückte höchste Verwunderung aus.
Er warf dem Bischof einen vielsagenden Blick zu, während die Höflinge sich bemühten, den Erfolg des Polen dadurch zu schmälern, dass sie behaupteten, der von diesem zerbrochene Pokal sei dünner als der des Königs und bereits versehrt gewesen.
August aber sagte kein Wort. Er fing an, Hufeisen zu zerbrechen, als wären sie von Glas statt von Eisen, und machte seinem Rivalen ein Zeichen, er möge ein Gleiches tun. Zaklika brach einige Hufeisen ohne jedwede Kraftanwendung entzwei. Von den Hufeisen ging man zu den Talern über. Es kostete August einige Anstrengung, einen Taler zu teilen. Die Hofleute hatten Zaklika einen spanischen Taler, der massiver war als der sächsische, hingeschoben, weil es ihnen, dem König zuliebe, darum zu tun war, dass der Pole ein Fiasko erlitt, allein Zaklika brach das Geldstück beim ersten Versuch entzwei.
Die Stirn des Monarchen verfinsterte sich. Die Höflinge waren verzweifelt darüber, dass ein so unschickliches Spiel aufs Tapet gebracht worden war. Nachdem König August dem polnischen Jüngling beide silbernen Pokale geschenkt hatte, sagte er, dass er Zaklika in seiner Nähe behalten wolle. Infolgedessen erhielt Zaklika eine bescheidene Stelle am Hofe Augusts II. Er bezog ein Gehalt von einigen hundert Talern, wurde mit glänzenden Kleidern versehen und hatte wenig oder gar nichts zu tun. Dem König aber, der nie mit ihm sprach, sich jedoch häufig nach ihm erkundigte und den Befehl erteilt hatte, dass dem jungen Polen alles, was er brauche, verabreicht werde, musste Zaklika stets folgen, wohin immer dieser sich auch begeben mochte. Indes hatte der junge Edelmann viel freie Zeit. Da die Personen, mit denen der junge Pole verkehren musste, nur deutsch und französisch verstanden, gab er sich dem Studium dieser beiden Sprachen mit Eifer hin.
Nach zwei Jahren sprach er sie ziemlich gut. Die Vergnügungen aber, welche am Hofe gang und gäbe waren, langweilten ihn, auch verachtete er die Höflinge. Er pflegte die Umgebung Dresdens zu durchstreifen. Da war kein Berg, den er nicht erklommen, kein steiler Abhang an der Elbe, der ihm nicht bekannt gewesen wäre. Noch war ihn nie, auch nicht an den gefährlichsten Stellen, ein Schwindelanfall überkommen, geschweige denn, dass ihm ein Unfall zugestoßen wäre. Während einer dieser Ausflüge sah Zaklika zu seinem Unglück Anna von Hoym. Ihr Anblick versetzte ihm den Atem, versteinerte ihn. Er glaubte zu träumen. Ihm war, als könne ein so schönes Geschöpf kein irdisches Wesen sein. Als die schöne Frau schon längst verschwunden war, stand Zaklika noch immer und starrte ihr traumverloren nach. Endlich kehrte er, von einer namenlosen Angst erfüllt, wie ein Trunkener nach Dresden zurück. Von diesem Tage an gehörte der arme Jüngling nicht mehr sich selbst. Er lief alle Tage nach Laubegast, und je öfter er hinausging, desto größer wurde sein Leid.
Da Zaklika keine Freunde besaß, vertraute er sich niemand an, und so konnte ihm auch niemand sagen, dass man in seiner Lage das Feuer fliehen müsse, um zu genesen, statt sich demselben immer wieder zu nähern. Die Liebe zu der schönen Einsiedlerin machte ihn zuletzt geistig und körperlich krank.
Annas Kammerfrauen, welche ihn tagtäglich um die Besitzung schleichen sahen, lauerten ihm auf und entdeckten gar bald, was in ihm vorging. Davon in Kenntnis gesetzt, ließ Anna den Unglücklichen, der ihr ohne Zweifel Mitleid einflößte, unverzüglich zu sich heraufbitten. Als Zaklika erschien, schalt sie ihn wegen seiner Unbesonnenheit aus und befahl ihm aufs nachdrücklichste, sich weder in der Nähe des Hauses noch in der Umgebung wieder sehen zu lassen.
Da niemand außer der Herrin des Hauses zugegen war, wagte Zaklika, den seine Liebe kühn gemacht hatte, der Dame seines Herzens zu sagen, dass es kein Verbrechen sei, ein Weib zu betrachten, und dass ihn kein anderer Wunsch beseele als der, seine Augen an ihrem Anblick zu weiden. Er lasse sich von niemand verbieten, nach Laubegast zurückzukehren, und er wolle sich das Glück, sie wiederzusehen, verschaffen, selbst wenn er dafür gesteinigt werden sollte, da er ja doch vor Schmerz sterben müsste, wenn er sie nicht mehr sähe.
Frau von Hoym war über die Kühnheit des Jünglings sehr erzürnt. Sie schalt ihn, sagte, sie werde ihren Gemahl von allem in Kenntnis setzen, sobald er sich wieder in Laubegast blicken ließe. Sie drohte vergebens. Zaklika ließ sich von dem gefassten Entschluss nicht abbringen.
Von diesem Tage an ging die schöne Frau am Ufer der Elbe spazieren, wo der junge Mann sie nicht mehr sehen konnte.
Mehrere Wochen Vergingen, ohne dass sie ihren zudringlichen Verehrer erblickt hätte. Sie glaubte schon, dass er ihre Spur verloren habe. Da bemerkte sie aber eines Tages auf der Oberfläche des Wassers einen Kopf. Es war der des verliebten Jünglings, der sich den Anblick seiner Schönen auf diesem ungewöhnlichen Weg verschaffte.
Diesmal geriet Frau von Hoym in hellen Zorn und rief ihre Leute herbei. Zaklika aber tauchte unter und war verschwunden. Fast hätte er den tollen Streich mit dem Leben gebüßt.
Die Kleider hemmten seine Bewegungen, und seine Glieder zogen sich krampfhaft zusammen, so dass er nur mit großer Mühe das Ufer wieder erreichte.
Es gelang ihm in der Folge, einen Winkel ausfindig zu machen, von welchem aus er Frau von Hoym sehen und das verhängnisvolle Gift der Liebe auf sich einwirken lassen konnte. Ob die Schöne dies wusste oder ob sie so tat, als merke sie es nicht, vermögen wir nicht zu sagen. Jedenfalls war in Laubegast von dem Jüngling nicht mehr die Rede. So auch am Hofe. Niemand achtete mehr auf ihn. August wäre es vielleicht nicht unangenehm gewesen, wenn er sich den Hals gebrochen hätte. Gleichwohl ließ er ihn ungestört seiner Wege gehen und kümmerte sich lange nicht um ihn.
Aber eines Tages ließ er ihn rufen. Seine Majestät hatte in einem Augenblick der Wut einem starken Pferd den Kopf abgehauen. Nun wollte August dem Hofe zeigen, dass ihm sein Nebenbuhler das nicht nachtun könne. Man führte denn ein altes Dragonerpferd vor, an dem das neue Experiment versucht werden sollte. Vorher hatte man den polnischen Jüngling beiseite geführt, um ihm zu sagen, dass er diesmal keine Probe seiner Riesenkraft zum Besten geben solle, wenn er sich die Gunst des Königs erhalten wolle. Für dergleichen höfische Subtilitäten war indes unser Held nicht geschaffen. Er verstand sie einfach nicht. Zaklika begriff nur eines: dass August einem Pferd den Kopf abgehauen hatte und dass man glaubte, er, Zaklika, könne so etwas nicht zuwege bringen.
Bei diesem Gedanken stieg ihm das Blut in den Kopf. Vor den Augen des Königs und denen des versammelten Hofes suchte er sich ein scharfes Schwert aus, prüfte dessen Schneide und hieb ohne weiteres den Kopf des Pferdes ab.
Er gestand später, ihm habe der Arm und die Schulter noch volle acht Tage danach geschmerzt. August sagte kein Wort.
Er zuckte nur mit den Achseln und entfernte sich, um seinen Unmut wegzutrinken. Von diesem Augenblick an richtete niemand mehr das Wort an den armen Zaklika. Jeder suchte ihn zu meiden, und diejenigen, die ihm noch wohlwollten, rieten ihm, in aller Stille schleunigst den Hof, die Stadt zu verlassen, da er sich durch sein Bleiben der Gefahr aussetze, bei dem geringfügigsten Anlass auf den Königstein abgeführt zu werden.
Raimund Zaklika zuckte bei diesen Warnungen furchtlos die Achseln und blieb.
Nun verfiel August der Starke auf den Gedanken, zu versuchen, ob sein Nebenbuhler sich mit ihm auch im Trinken messen könne. Dieses Experiment wurde natürlich mit Erfolg gekrönt, denn der arme Junge trank für gewöhnlich Wasser und konnte sich nur selten den Luxus eines Glases Bieres vergönnen. Gar bald bat er den König, er möge ihm gestatten, nichts mehr zu trinken. Allein August begnügte sich nicht mit diesem Sieg. Er zwang ihn förmlich, noch einen riesigen Humpen zu leeren, der den Jüngling vollends umwarf.
Zaklika wurde infolgedessen schwer krank. Ein heftiges Fieber hätte ihn beinahe hinweggerafft. Allein er genas wieder.
Auch seine Riesenkraft kehrte zurück, und zwar in einem solchen Grade, dass sich niemand mehr mit ihm zu messen wagte. Zaklikas kindische Wanderungen nach Laubegast begannen von neuem. Aber die Liebe bewirkte allmählich eine Umwandlung in ihm. Er wurde ernster, gesetzter, mit einem Wort, er wurde ein anderer Mensch.
Anna von Hoym hatte vor ihrem Gatten keine Geheimnisse, aber von Zaklika sprach sie nie mit ihm. Hatte sie den jungen Mann vergessen?
In Laubegast wurde das Gittertor bei einbrechender Dämmerung geschlossen. Die Diener lösten die Ketten der Hofhunde und gingen alsdann zur Ruhe. Nur Frau von Hoym blieb länger auf.
Während der König mit seinen Höflingen zechte und Hoym im trunkenen Zustand die Schönheit seiner Gemahlin rühmte, hatte diese kein Auge schließen können. Sturmwind sauste über die Felder, umkreiste heulend das Haus und brach krachend die Äste der Bäume ab.
Auf ihren weißen Arm gestützt, schaute die schöne Frau, in ernste Gedanken versunken, auf ein vor ihr liegendes, aufgeschlagenes Buch nieder. Es war die Bibel, in der Anna mit Vorliebe las. Die Apokalypse und mehrere Episteln Paulus' interessierten sie in hohem Grade.
Es war schon sehr spät. Die Lichter mussten erneuert werden.
Da ließ sich plötzlich das Getrappel herannahender Pferde vernehmen. Die Tiere schienen vor dem Hause anzuhalten.
Am Gittertor wurde heftig gerüttelt. Die Hofhunde fingen an, laut zu bellen.
Frau von Hoym richtete sich zitternd in die Höhe. Ein nächtlicher Überfall war zu jener Zeit eine Seltenheit, namentlich in dem Dresden so nahe gelegenem Dorf Laubegast. Immerhin kamen solche Überfälle zuweilen vor. Ausgeartete Soldaten, namentlich Fahnenflüchtige, die sich bei Tage in den Bergen aufhielten, erschienen nächtlicher Weise hin und wieder in den Dörfern und trieben allerlei Unfug, der ihnen den Kopf kostete, wenn es der Justiz gelang, sie zu erwischen. Frau von Hoym schellte und rief, um die Dienerschaft zu wecken. Gar bald waren alle Bewohner des Hauses munter. Unten wurde noch immer an dem Gitter gerüttelt, und die Hunde bellten ununterbrochen. Als die mit Waffen versehenen Diener in den Hof hinaustraten, erkannten sie bei dem flackernden Licht vieler Fackeln, dass der nächtliche Ruhestörer ein königlicher Bote war. Hinter diesem stand eine mit sechs Pferden bespannte Karosse. Vorreiter und Lakaien in der Livree des Königs, Fackeln in den Händen, umgaben den Wagen.
Nachdem den Hunden die Ketten angelegt worden waren, öffnete sich das große Tor, und der Kurier des Königs wurde zu der Herrin des Hauses geführt.
Als die junge Frau den Eilboten wahrnahm, meinte sie, es sei ihrem Gatten ein Unglück zugestoßen, und wechselte die Farbe. Als sie aber auf dem Schreiben die Schriftzüge Hoyms erkannte, erholte sie sich alsbald, musste jedoch unwillkürlich an den Kanzler Beichling denken, der während der Nacht urplötzlich verhaftet, auf Befehl Augusts nach Königstein gebracht und all seiner Habe beraubt worden war. Hoym hatte seiner Gattin wiederholt erklärt, dass ihm der unstete Charakter des Königs keine geringe Sorge mache und dass er sich nicht eher in Sicherheit fühlen würde, als bis er sich, seine Gattin und sein Vermögen ins Ausland gebracht hätte. Aus Erfahrung wusste man, dass man August am meisten zu fürchten hatte, wenn er am freundlichsten war, und dass er, gleich jenem gefährlichen Raubvogel, seine Opfer in Schlaf zu wiegen liebte, bevor er sie erwürgte.
Anna von Hoym glaubte also, dass ihren Gemahl das Schicksal des Kanzlers getroffen habe. Es war ihr bekannt, dass Hoym wegen der Akzise, die er eingeführt hatte, im ganzen Land verhasst war und dass seine Feinde nur auf eine Gelegenheit lauerten, um ihn zu stürzen. Sie war daher nicht wenig überrascht, als sie in dem Schreiben den Befehl vorfand, sofort nach Dresden, zu ihrem Gemahl, zu kommen. Diesem Befehle nicht Folge zu leisten, wäre nicht ratsam gewesen.
Außerdem trieb sie schon die Neugier an, sich so schnell wie möglich auf den Weg zu machen. Ihre Leute mussten schleunigst die Reisevorbereitungen treffen. In weniger als einer Stunde stieg Frau von Hoym in den königlichen Wagen. Die Pferde zogen an, und das Portal des Hauses, das sie nicht wieder betreten sollte, fiel klirrend zu.
Während der Fahrt durchkreuzten die seltsamsten Gedanken ihren Kopf. Es erfüllte sie eine geheimnisvolle Angst, eine tiefe Trauer, und in ihren Augen standen Tränen. Obgleich sie nicht wusste, welches Schicksal ihrer harrte, und nichts darauf hinwies, dass ihr ein Unglück bevorstehe, konnte sie sich dennoch einer namenlosen Angst nicht erwehren. Sie wusste, dass der König nach mehrjähriger Abwesenheit mit seinem, den Intrigen holden, Gefolge wieder in Dresden residierte.
Die Jagd nach königlicher Gunst, nach Ehren und Würden hatte bereits begonnen, eine Jagd, bei der keinerlei Mittel für unerlaubt gehalten wurde. Dem Anschein nach ging es an diesem Hofe immer lustig her; in Wirklichkeit aber spielten sich furchtbare, ja tragische Ereignisse nur allzu oft dort ab. Während die Besiegten, die Gestürzten, im Kerker schmachteten, tanzten die Sieger, die in Gunst Stehenden, zu den fröhlichen Weisen. Wie oft hatte Anna von Hoym nach der Höhe gebückt, auf welcher die Festung Königstein thronte, und hatte dabei an die Geheimnisse, an die Geopferten gedacht, welche diese grauen Steine bargen. Es war eine dunkle Nacht. Die königlichen Lakaien ritten mit Fackeln voraus, die Pferde mit dem Wagen folgten im Galopp. Sie hatten Dresden bald erreicht. Die Karosse hielt vor dem in der Pirnaischen Straße gelegenen Hause des Kabinettsministers, in dem alles schlief, obwohl der Akzisor noch nicht heimgekehrt war. Gräfin Hoym musste lange warten, ehe sie eingelassen wurde. In der Wohnung des Ministers, die den ganzen ersten Stock des Hauses einnahm und die nur aus einigen Empfangssälen, der Kanzlei und einem Schlafzimmer bestand, fand sich kein der jungen Frau gehörendes Gemach. Neben dem Arbeitskabinett lag ein großer, düsterer Saal, in dem sich die ermüdete Dame ein Lager bereiten ließ, nachdem sie durch alle Räume des Appartements gegangen war und zu ihrer Verwunderung ihren Gemahl nirgends gefunden, aber von der Dienerschaft erfahren hatte, dass der Minister einem Bankett des Königs beiwohnte und gewohntermaßen, wie sich der befragte Lakai ausdrückte, wahrscheinlich erst bei Tagesanbruch, wenn nicht noch später, nach Hause kommen werde.
Frau von Hoym schloss sich mit ihrer Kammerfrau in den düsteren Saal ein, ließ die Tür verriegeln und begab sich zur Ruhe. Sie konnte aber nicht schlafen, sondern verfiel in eine krankhafte Betäubung. Beim geringsten Geräusch schnellte sie empor und schaute sich geängstigt in dem leeren Raum um. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als sie endlich, von Ermüdung überwältigt, einschlief. Aber da ging die Tür des Nebenzimmers auf, ein schwerer Tritt ließ sich vernehmen, und Anna erwachte.
In dem Glauben, derjenige, der in dem anstoßenden Kabinett auf und ab ging, sei ihr Gatte, erhob sie sich vom Lager und ließ sich von ihrer Kammerfrau eiligst ankleiden. Gräfin Annas Morgentoilette war bald beendet. Das elegante Negligé erhöhte ihre Schönheit, Aufregung und Ermüdung verliehen ihr neue Reize. Mit raschen Schritten ging sie zur Tür, schob den Riegel zurück, öffnete und blieb überrascht auf der Schwelle stehen.
Vor ihr stand ein alter Mann im schwarzen, talarähnlichen Anzug der protestantischen Priester. Seine ungemein hohe Stirn war von einem Kranz weißer Haare umgeben, seine grauen Augen glänzten mit eigenartiger Pracht in ihren tiefen Höhlungen, um seinen Mund lag ein bitterer Zug. Das Gesicht des Alten, das nichts weniger als schön war, drückte Weltverachtung, Ernst und Milde zugleich aus und war so originell, so seltsam, dass es die Augen des Beschauers festhielt, ja bannte. Anna sah ihn unverwandt an, und er stand regungslos vor ihr, gleichsam als ob ihn die Erscheinung dieses himmlisch schönen Wesens erstarrt hätte.
Aus seinen Augen sprach ebenso viel Überraschung wie Bewunderung. Endlich machte er einen Schritt vorwärts. Dabei hob er seine Arme mit einer nicht zu beschreibenden Bewegung empor, es war, als wolle er die junge Frau zugleich segnen und zurückstoßen.
Die beiden sahen einander fragend in die Augen. Keines kannte den anderen. Anna schaute sich in dem Zimmer um, und als sie ihren Gatten nirgends erblickte, war sie schon im Begriff, sich wieder zurückzuziehen, als der Priester sie im Ton innigsten Mitleids fragte: „Kind, wer seid Ihr?“
DRITTES KAPITEL: Versuchungen
„Wer ich bin?“ wiederholte Anna von Hoym mit erstauntem Blick. „Diese Frage dürfte doch wohl eher ich an Euch richten, der Ihr in meinem Hause seid!“
„In Eurem Hause?“ rief der Priester verwundert. „Seid Ihr denn die Gattin des Ministers?“
Frau von Hoym bejahte die Frage des Geistlichen mit einer stolzen Kopfbewegung.
Der Fremde schwieg eine Weile. Sein Blick, der auf Anna gerichtet war, drückte Trauer und Teilnahme zugleich aus. Zwei schwere Tränen rollten über seine faltenreichen Wangen, und er sprach mit feierlicher Stimme, als er sich der jungen Frau näherte: „Warum betratest du diesen brennenden Boden?
Warum beschmutztest du deine reinen Füße mit dem Staub dieses Babylon? ... Oh, du strahlendes Geschöpf, sag mir, weshalb du nicht von diesem Ort der Verdammnis fliehst?
Wer war so niederträchtig, dich in diese unreine Welt zu locken? So sprich doch! Du stehst so ruhig und gleichgültig da, als wüsstest du nicht, welche Gefahr dir droht. Antworte mir ... seit wann bist du hier?“
Die junge Frau war so bestürzt über diese Rede, dass sie keinen Laut hervorbringen konnte. Die Worte des alten Priesters hatten sie bewegt, verwirrt, eingeschüchtert, aber zugleich auch empört. Indes fehlte ihr der Mut, ihrer Entrüstung Ausdruck zu geben; Noch ehe ein Wort über ihre Lippen gekommen war, fuhr der Geistliche fort: „Unglückliche! Wisst Ihr denn, wo Ihr seid? Wisst Ihr, dass Ihr auf schwankendem Boden steht, dass hier diejenigen verschwinden, welche anderen im Wege sind, dass hier das Leben für wertlos erachtet, dass es für einen Augenblick des Genusses hingeopfert wird?“
„Oh, mein Vater, wie fürchterlich sind die Bilder, welche Ihr mir da zeigt!“ rief Frau von Hoym. „Welchen Zweck verfolgt Ihr, indem Ihr mich derart erschreckt?“
„Meine Tochter, ich habe auf Eurer Stirn, in Euren Augen gelesen, dass Ihr unschuldig seid, dass Ihr keine Ahnung von dem habt, was hier vorgeht. Befindet Ihr Euch nicht erst seit kurzer Zeit hier?“
Anna erwiderte: „Seit wenigen Stunden.“ „Man sieht es Euch an, dass Ihr Eure Kindheit und Eure Jugend nicht in dieser Umgebung verbrachtet. Wie ganz anders sähet Ihr aus, wenn dies der Fall wäre!“ „Ich wurde im Holsteinschen erzogen.
Dort liegt meine Vaterstadt. Während meiner Ehe mit dem Grafen Adolf von Hoym lebte ich immer auf dem Lande, sah Dresden nur aus der Ferne und ...“
„Und niemand hat Euch erzählt, was in der Hauptstadt vorgeht“, ergänzte der würdige Mann in leisem Ton. „Ja, ja, all das hatte ich beim ersten Anblick erraten. Als ich Euch erblickte, erfasste mich das innigste Mitleid; mir war, als sähe ich eine blendendweiße Lilie, der sich eine Rotte schändlicher Menschen näherte, um sie zu zertreten. In jener Ferne, wo Ihr das Licht der Welt erblicktet, dort in der Einsamkeit hättet Ihr Euch entfalten sollen, für Gott allein!“ Der Geistliche schwieg und versank in tiefes Nachdenken. Nach langem Schweigen trat Anna an ihn heran und sagte mit bewegter Stimme: „Und Ihr, mein Vater, wer seid Ihr?“ „Ich?... Ich?...“ sagte er in gedehntem Ton. „Ich bin ein Unglücklicher, den alle verspotten und verachten. Ich bin derjenige, der den Verfall und den Ruin, die Zerstörung, die Tage der Prüfung und der Buße prophezeit. Meine Stimme ist zuweilen mächtig, auf dass die Menschen sie hören und — mich alsdann verspotten. Ich bin derjenige, dessen Warnungen verachtet werden, ein Tor in den Augen der Mächtigen und Reichen der Erde, vor Gott aber ein Gerechter!“
Bei den letzten Worten erlosch die Stimme des ehrwürdigen Mannes, und traurig neigte er das Haupt. „Welch seltsamer Zufall, dass ich Euch, mein Vater, an der Schwelle dieses Hauses begegnete“, sprach Frau von Hoym nachdenklich. „Ihr warnt mich vor den Gefahren, die mich umgeben. Ist das nicht ein Fingerzeig Gottes?“ „Es ist das Werk der Vorsehung“, erwiderte feierlich der Greis. „Wehe denen, die ihre Winke nicht befolgen! ... Aber Ihr wolltet erfahren, wer ich bin .. .Mein? Name ist Schramm. Ich bin nur ein armer Prediger, der zu seinem Unglück auf der Kanzel die Wahrheit gesprochen hat und den nun die Rache der Mächtigen verfolgt. Ich bin hierhergekommen, um Herrn von Hoym, der mich in seiner Jugend kannte, zu bitten, sich für mich zu verwenden. Was aber führte Euch hierher, verehrte Frau? Wer veranlasste Euch, nach Dresden zu kommen?“
„Mein Gemahl“, antwortete Frau von Hoym einfach. „Bittet ihn, diesen Ort all sogleich verlassen zu dürfen! Ich habe sie alle gesehen, diese Schönen des Hofes, und ich kann Euch versichern, dass Ihr tausendmal schöner als diese vielgerühmten Schönheiten seid. Wehe Euch, wenn Ihr hier verweilet.
Man wird Euch mit Intrigen umgarnen, kein Mittel scheuen, um Euch zu verführen. Mit süßen Reden, Sinnengenüssen, faszinierenden Blicken, Lügen ... wird man Euch zu Fall bringen. Sinne und Augen werden Euch geblendet werden, bis Ihr endlich, berauscht, entkräftet, besiegt in den Abgrund stürzt, der schon so viele verschlang.“
Die junge Frau furchte die Stirn und entgegnete: „Ich bin nicht so schwach, wie Ihr meint. Wohl weiß ich, dass man mir Fallen stellen wird, indes verlange ich nicht nach den Freuden und Genüssen dieser Welt, die ich von oben herab betrachte, weil sie tief unter mir liegt.“
„Vertraut Euern Kräften nicht, mein armes Kind“, rief der Priester, „entfliehet dieser Hölle und rettet Euch vor dem sicheren Verderben!“