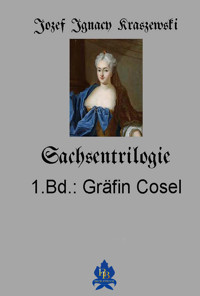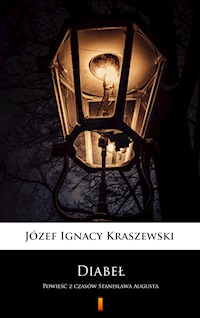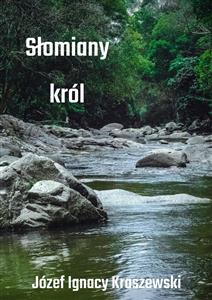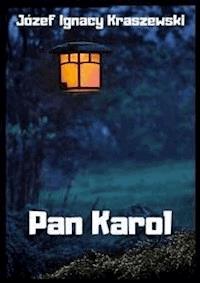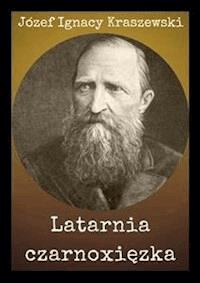4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BROKATBOOK
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Durch Intrigen und Ränkespiele wird Heinrich Graf Brühl erster Minister unter August III. Selbst vor seinem Freund, dem Grafen Sułkowski, macht Brühl nicht halt und lässt diesen kurzerhand aus der Nähe des Kurfürsten verbannen. Feinde werden durch unsaubere Mittel aus dem Weg geschafft. Interessanteste Szene ist dabei die Geschichte des Grafen Watzdorf, der in Franziska Gräfin Brühl verliebt war und sich ebenfalls ihrer Gunst erfreuen durfte. Graf Brühl lässt diesen in das sächsische Staatsgefängnis Königstein bringen, wo er nach 14 Jahren Haft starb. Sehr einseitige und subjektive Schilderungen der Person Brühls und seiner Frau, mir ungenauen historischen Tatsachen zur Person des sächsischen Premierministers.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jozef Ignacy Kraszewski
Sachsentrilogie
Impressum
Texte: © Copyright by Jozef Ignacy Kraszewski
Umschlag: © Copyright by Walter Brendel
Illustration: © Copyright by Walter Brendel
Übersetzer: © Copyright by Alois Hermann
Verlag:
Das historische Buch, Dresden / Brokatbookverlag
Gunter Pirntke
Mühlsdorfer Weg 25
01257 Dresden
Erster Teil: Aufstieg
Wir sind alle Schauspieler,
es kommt nur darauf an,
gut seine Rolle zu spielen.
H. Graf von Brühl
I Pagenleben
An einem wunderbaren Herbstabend, gegen Sonnenunter-gang, erklangen in dem Wald, wo uralte Tannen und Buchen standen, die letzten Hornsignale, die die Jäger zum Sammeln riefen. Auf der breiten Landstraße zogen die Jägerabteilungen des sächsischen Hofes dahin, Leute mit Speeren und Netzen, Berittene in grüner Tracht mit goldenen Tressen und Hüten mit schwarzen Federn. In der Mitte des Zuges sah man eine herausgeputzte Gesellschaft und Wagen mit dem erlegten Wild, das mit grünen Zweigen geschmückt war. Die Beute musste sehr groß gewesen sein, denn die Jäger waren in fröhlicher Stimmung. Von den Wagen ragten Hirschgeweihe in die Luft, und Wildschweine ließen ihre Köpfe und Klauen herunterhängen. Vorn war das Gefolge des Königs zu sehen: glänzende Gewänder, schöne Pferde und einige Amazonen mit rosigen Gesichtchen. Alle hatten sich wie zu einer Festlichkeit oder einem Hofball geschmückt, denn die Jagd war das Lieblingsvergnügen des damals in Sachsen und Polen mehr oder minder glücklich herrschenden August II.
Der König selbst führte die Jagd an; an seiner Seite ritt sein geliebter Erstgeborner Sohn, der Thronfolger Sachsens, dem die Hoffnungen des Volkes galten. Der König sah trotz seines Alters herrlich und rüstig aus. Er saß ritterlich auf seinem Pferd, und man konnte seinen Sohn, der ebenfalls eine schöne Erscheinung, nur mit etwas sanfteren Gesichtszügen, war, fast für seinen jüngeren Bruder halten. Ein großes und prächtiges Gefolge umgab die beiden. In dem nähen Schloss Hubertusburg sollte übernachtet werden; dort wollte der Sohn den Vater empfangen, denn dieses Jagdschloss gehörte ihm. Auf Hubertusburg erwartete sie die Kronprinzessin Josepha, die Tochter des kaiserlichen Hauses von Habsburg, die unlängst dem jungen Friedrich angetraut worden war.
Die Jagdgesellschaft umfasste so viele Personen, dass es schwierig war, alle im Schloss unterzubringen. In kluger Voraussicht hatte man daher in einem nahen Wäldchen Zelte aufgeschlagen. Dort sollte der größte Teil des herrschaftlichen Gefolges die Nacht verbringen. Die Tische waren schon zur Abendmahlzeit hergerichtet, und in dem Augenblick, als der König in das Schloss einritt, begannen seine ausgelassenen Gäste sich die zugewiesenen Plätze zu suchen. Allmählich brach die Dämmerung herein. In den Zelten ging es laut und lustig zu; das Lachen der Jugend, das nur die Gegenwart des Königs und der Älteren eindämmte, erklang jetzt freier. Nach den Mühen des Tages griff man zu den bereitstehenden Flaschen, obwohl der Marschall noch nicht das Zeichen zum Beginn der Mahlzeit gegeben hatte. Die Zelte für die Hofleute, im Schatten der Bäume, wurden von Laternen beleuchtet.
Gleich daneben standen an behelfsmäßig errichteten Krippen die Pferde, deren Wiehern manchmal das fürchterliche Fluchen der Stallknechte hervorrief. Die einander unbekannten Rosse begannen sich durch Beißen und Schnauben anzufreunden; das Klatschen der Peitschen stellte hier den Frieden wieder her. Die Hundemeute des Königs machte sich durch Knurren und Bellen bemerkbar. Man legte Koppeln an; auch hier hatten die Wärter genug zu tun, um Ruhe zu schaffen. Aber in den Zelten gab es keinen, der es gewagt hätte, das Lachen, die Lieder und den Streit der Jugend durch seine Autorität zu besänftigen. Man stritt sich um das schönste Gesicht, um den besten Schuss, um das Wort, das Seiner Majestät am besten geschmeichelt hatte.
Der Kronprinz war der Held des Tages; er hatte mit einer Kugel aus seinem Stutzen einen Eber, der direkt auf ihn zu rannte, mitten in den Schädel getroffen. Man bewunderte die ungeheure Geistesgegenwart und die Ruhe, mit der er lange gezielt und schließlich abgedrückt hatte. Als die Jäger auf den Schuss hin herbeieilten, um der wütenden Bestie mit den Hirschfängern den Garaus zu machen, lag diese schon am Boden und besudelte mit ihrem Blute die Erde. König August küsste seinen Sohn, der die Hand seines Vaters und Herrn ehrfurchtsvoll mit den Lippen berührte und auch nach seinem Erfolg so kalt und ruhig wie vorher blieb. Das einzige Zeichen seiner guten Laune war, dass er beiseite ging und sich eine Pfeife reichen ließ, um den Rauch in bedeutend größeren Wolken als gewöhnlich in die Luft zu blasen. Das Rauchen einer Pflanze „tobacco" genannt, kam damals allgemein in Gebrauch. Stanislaus Leszczyhski liebte sie, der Kronprinz Friedrich rauchte ebenso leidenschaftlich wie August der Starke. Vor allem bei Festen der Männer und beim Bier ging es nicht ohne Pfeifen. Man reichte sie am Hofe des preußischen Königs jedem, ob er rauchen wollte oder nicht, und wenn der Rauch jemandem Beklemmungen in der Herzgegend verursachte, bog man sich vor Lachen. Es gehörte zum guten Ton, zur Würde des trinkfesten Genießers, die Pfeife vom Morgen bis zum Abend zu schmauchen. Die Frauen ekelten sich davor, doch ihr Widerwille nahm den Herren von damals nicht die Lust an dem angenehmen Rausch, den dieser Tobacco verschaffte. Nur den ganz jungen Leuten war es untersagt, sich frühzeitig an diesen Rausch zu gewöhnen, der neben Wein und Kartenspiel als gefährlicher Verführer verrufen war.
So konnte man auch bei den Zelten kein Pfeifenglimmen beobachten. Die ermüdeten Reiter fielen fast von den Pferden, um auf Teppichen, Holzklötzen und Bänken die Nacht zu verbringen. Vom Schloss her schimmerte der Glanz der vielen angezündeten Kerzen, und der Klang der Musik tönte bis zum Hain hinüber, wo sich der Hof, die Bediensteten und das Gesinde niedergelassen hatten. Für den nächsten Tag war ein anderes Waldgebiet zur Jagd vorgesehen, und man hatte bekanntgegeben, dass alle frühzeitig bereit sein sollten. Auf dem Wege zum Schloss, in einiger Entfernung von den in Gruppen zusammenstehenden älteren Herren, spazierte ein schöner zwanzigjähriger Jüngling. An seinem Gewände erkannte man leicht den Leibpagen Seiner Majestät.
Diese sehr gewandte, wohlgeformte, biegsame und eigenartige Gestalt, die etwas von weiblicher Anmut an sich hatte, musste die Aufmerksamkeit auch des gleichgültigsten Auges auf sich lenken. Die Kleider umhüllten ihn, als wäre er in ihnen zur Welt gekommen, die Perücke ruhte auf seinem Haupt, als wäre er mit dieser Frisur geboren worden; sie war nicht einmal durch die Jagd in Unordnung geraten, und unter ihr schaute ein Gesicht wie aus Meißener Porzellan hervor - weiß, rosig, von einer fast kindlichen und mädchenhaften Schönheit. Stets hatte es ein Lächeln in Bereitschaft, das auf Wunsch seine Züge erhellen konnte. Seine scharfen Augen glänzten, harrten jedoch ständig der Befehle des Herrn. Der Glanz konnte jeden Augenblick verlöschen und zum Schweigen kommen oder aufflammen und das vorspiegeln, was in der Seele nicht vorhanden war.
Dieser schöne Jüngling war so anziehend wie ein Rätsel. Fast alle liebten ihn, auch der König, und trotzdem gab es kein gehorsameres, dienstfertigeres und sanfteres Geschöpf am Hofe. Er trachtete nie danach, sich besonders hervorzutun, er stellte niemanden in den Schatten, und immer, wenn er zu irgendeiner Arbeit gerufen wurde, führte er sie mit außerordentlicher Geschicklichkeit, Leichtigkeit, Schnelligkeit und Klugheit aus.
Es war dies ein armer Edelmann aus Thüringen, der letzte und jüngste der vier Gebrüder Brühl von Gangloff-Sommern. Sein Vater war an jenem kleinen Hofe in Weißenfels ein noch kleinerer Rat; nachdem er sein ganzes verschuldetes väterliches Gut verloren hatte, wusste er nichts mit dem Sohne anzufangen. Beizeiten schickte er ihn daher - damit er die Hof klinke fest in der Hand behielt - zur Fürstin Friederike Elisabeth, einer Witwe, die sich meistens in Leipzig aufhielt. Zu den damaligen Messen kamen die Fürstenhöfe in diese Stadt. August der Starke liebte sie überaus, und man erzählte, auf einer solchen Messe sei ihm der junge Page mit seinem lachenden Gesichtchen aufgefallen. Die Fürstin trat ihn gern an Seine Majestät ab. Es war sonderbar - der Junge, der einen solch vornehmen und prächtigen Hof mit seiner vollendeten Etikette noch nie im Leben gesehen und wahrscheinlich auch noch nicht davon geträumt hatte, schlug vom ersten Tage an instinktiv die richtige Bahn ein und verstand seinen Dienst so gut zu verrichten, dass er die älteren Pagen durch Eifer und Geschicklichkeit überflügelte. Der König gönnte ihm manch dankbares Lächeln; ihn ergötzte die Demut des Jungen, der ihm in die Augen blickte, seine Gedanken erriet, nie ein verdrießliches Gesicht zog und vor der Sonnenmajestät des Königs Herkules und Apoll voller Bewunderung auf das Gesicht fiel.
Seine Gefährten waren auf ihn eifersüchtig, doch versöhnte er sie bald durch seine Güte, Sanftmut, Bescheidenheit und sein hilfsbereites Herz Niemand dachte im Entferntesten daran, dass solch ein demütiges Geschöpf hoch steigen konnte. Arm war es auch noch. Die Familie derer von Brühl war trotz ihres alten Adels damals so heruntergekommen dass sogar die Verwandten sich ihrer nicht mehr erinnern wollten.
Er hatte also keinen anderen Protektor als sein anmutiges, liebes und lächelndes Gesicht. Er war aber auch zum Malen schön. Die Frauen, vor allem die älteren, blickten ihn mit lockenden Augen an; er ließ dann seinen Blick verwirrt zu Boden sinken. Niemals entschlüpfte seinem Munde ein bösartiges Wörtchen jener "Pagenwitz", der damals ein Kennzeichen der höfischen Jugend war. Brühl war seinem Herrn, den hohen Würdenträgern den Damen, den ihm Gleichgestellten und der ganzen Dienerschaft zutiefst ergeben, vor allem aber den Kammerdienern des Königs denen er eine außerordentliche Hochachtung bezeigte, gerade so, als ob ihm schon damals das Geheimnis bekannt gewesen wäre, dass durch die Kleinsten die größten Dinge vollbracht werden und dass die Lakaien in aller Stille Minister stürzen und den Ministern es dagegen selten gelingt die Lakaien anzutasten - all das diktierte dem so hoch begabten Jüngling der glückliche Instinkt, mit dem ihn die freigebige Mutter Natur ausgestattet hatte.
Als Hein (so nannte man ihn gewöhnlich voll Zärtlichkeit) einsam den Weg entlangspazierte, der vom Schloss zu den Zelten führte, hätte man annehmen können, dass er dies tat, um niemanden zu stören und trotzdem, von jedem Auge bemerkbar, jederzeit dienstbereit zur Verfügung zu stehen.
Solchen Menschen ist das Glück oft wundersam hold. Während er so ziellos dahinschlenderte, kam aus denn Schloss ein ebenso schöner Jüngling gelaufen. Er mochte fast im gleichen Alter sein, doch unterschied er sich durch seine Kleidung und sein Äußeres sehr von dem bescheidenen Brühl.
Man konnte ihm anmerken, dass er seiner selbst bewusst war und alles, was er sich wünschen konnte, besaß. Er war von stattlichem Wuchs, männlich gewandt; seine schwarzen Augen musterten scharf die Welt. Mit der Haltung eines Herrn schritt er lebhaft einher. Eine Hand hatte er hinter seine weite, reichbestickte Weste geschoben, die andere hinter die Schöße seines wunderbar betressten Jägerrocke". Die Perücke die er während der Jagd trug, ersetzte ihm den Hut. Seine Gesichtszüge hatten im Vergleich zu dem lieblichen, wie von einem italienischen Meister des XVII. Jahrhunderts gemalten Gesicht Brühls einen ganz anderen Ausdruck. Der erste war mehr zum Höfling geschaffen, der zweite zum Soldaten.
Alle, die ihm unterwegs begegneten, verneigten sich und grüßten höflich denn er war seit Kindesbeinen der Spielgefährte und Freund des Kronprinzen, sein liebster Jagdgefährte, der Vertraute seiner kleinen Geheimnisse. Es war der Graf Alexander Sulkowski, ein Sohn des unvermögenden polnischen Edelmannes, der als Page einst an den Hof Friedrichs gekommen war und dem heute das Haus- und Jagdwesen unterstand. Das wollte schon etwas heißen, dass der Kronprinz ihm das Liebste anvertraute, was er auf der Welt besaß, denn die Jagd war für ihn nicht Spiel oder Unterhaltung, sondern seine ganze Beschäftigung und wichtigste Arbeit. Man verehrte und fürchtete Sulkowski zugleich; denn obwohl August II. bei seiner Gesundheit und Kraft wie ein Unsterblicher aussah, so musste auch diese Gottheit doch einmal, früher oder später, wie ein ganz gewöhnlicher Sterblicher ihr Leben beenden. Mit der neuen aufgehenden Sonne musste auch dieser Stern am sächsischen Himmel aufgehen und ihm mit seinem Glanz leuchten.
Als Brühl Sulkowski herankommen sah, gab er als bescheidener königlicher Page den Weg frei, verwandelte sich in ein unschuldiges Lamm verneigte sich leicht, lächelte ihm lieblich zu und schien über diese Begegnung eine so große Freude zu empfinden, als ob zu ihm die schönste der Göttinnen am Hofe August II. herabgestiegen wäre. Sulkowski quittierte dieses Lächeln und die stumme, respektvolle Begrüßung zugleich würdevoll und gnädig. Schon von weitem grüßte er mit der Hand, die er aus der Weste herausgezogen hatte, neigte ein wenig den Kopf, verlangsamte den Schritt, kam näher, wandte sich Brühl zu und sagte fröhlich:
Wie geht es dir, Heinrich? Worüber sinnst du hier so allein nach? Du Glücklicher, du kannst dich ausruhen, während ich hier für alles verantwortlich bin und nicht weiß, was ich zuerst machen soll, um nichts zu vergessen."
„Wenn es mir vergönnt wäre, Euch, Graf, zu hellen.“ "Ach nein, ich danke dir von Herzen; man muss seine Pflichten erfüllen! Für solch einen Gast wie unseren Allergnädigsten Herrn ist mir jede Mühe lieb."
Er seufzte leicht auf. „Na? Die Jagd ist gelungen. Wie du weißt konnte ich nicht daran teilnehmen; den Jagdmeister habe ich mit den Equipagen weggeschickt, im Schloss mussten viele Vorbereitungen getroffen werden….“
„Ja, die Jagd ist außerordentlich gut gelungen. Der Allergnädigste Herr war so gut aufgelegt wie seit langem nicht mehr."
Sulkowski neigte sich flüsternd zu Brühls Ohr herab. „Wer regiert denn jetzt im Alkoven, hm? Sag mir's!"
„Wirklich, das weiß ich nicht. Wir haben jetzt offenbar ein Interregnum." „Aber, aber! Das kann doch nicht sein!" Sulkowski lachte auf.
„Dieskau? Nein..."
„Ach nein, das sind längst begrabene Dinge... Ich weiß es nicht. „Wie? Du, Page des Königs, solltest es nicht wissen?"
Brühl sah ihn lächelnd an.
„Wenn es alle wissen, so dürfen es die Pagen nicht wissen... Wir sind den türkischen Muezzins ähnlich, taub und stumm."
„Aha! Ich verstehe", entgegnete Sulkowski, „aber so unter uns..." Brühl näherte seinen Mund dem Ohr des Grafen und warf ein Wörtchen hinein, diskret und still, wie das Rauschen eines im Herbst vom Baum fallenden Blättchens.
„Intermezzo!" sagte Sulkowski. „Es scheint, dass wir uns jetzt nach vielen Dramen, von denen ein jedes unseren geliebten Herrn so viel Schmerzen, Geld und Kummer gekostet hat, mit Intermezzi zufriedengeben."
Sulkowski eilte es schon nicht mehr, seinen Gang zu den Zelten fortzusetzen oder zum Schloss zurückzukehren. Er schob seinen Arm unter den Brühls, was den Pagen offensichtlich beglückte, und begann, ganz in Gedanken versunken, mit ihm einen Spaziergang. „Ich kann einen Augenblick Atem schöpfen", bemerkte er. „Es ist mir lieb, diesen in Eurer Gesellschaft zu verbringen, obwohl wir beide ermüdet sind, so dass vielleicht sogar ein Gespräch eine Anstrengung sein wird."
„Oh! Für mich durchaus nicht!" entgegnete Brühl. „Und glaubt mir, Graf, für Euch setzte ich den Weg die ganze Nacht hindurch fort, ohne auch nur die geringste Müdigkeit zu verspüren. Vom ersten Augenblick an, als ich das Glück hatte, mich Euch zu nähern, empfand ich die höchste Verehrung und, wenn es sich mir auszusprechen geziemt, die herzlichste und tiefste Freundschaft. Soll ich's gestehen? Es ist wahr, ich habe mich zum Spaziergang auf diesen Weg begeben mit der leisen Ahnung, mit der stillen Hoffnung, dass ich Euch, wenn auch nur von ferne, zu sehen bekäme und Euch grüßen könnte - und da begegnete mir ein solches Glück."
Sulkowski schaute in das erfreute, strahlende Gesicht und drückte die dargebotene Hand.
„Glaubt mir", bemerkte er, „Ihr habt keinen Undankbaren erwählt. Am Hof ist solch eine uneigennützige Freundschaft selten, und wenn wir uns beide die Hände reichen, können wir viel ausrichten." Ihre Blicke trafen sich, Brühl nickte. „Ihr seid beim König und erfreut Euch seiner Gunst." „Oh, ich schmeichle mir nicht...", entgegnete Brühl. „Ich verbürge mich dafür! Ich hörte dies aus dem eigenen Munde Seiner Majestät. Er lobte Eure Dienstfertigkeit und Euren Verstand.
Ihr steht in seiner Gunst oder seid auf dem Wege dazu..., das hängt von Euch ab." Brühl faltete überaus bescheiden die Hände.
„Ich wage es nicht zu glauben."
„Ich sage es Euch", wiederholte Sulkowski, „ich besitze das Herz Friedrichs, ich kann mich dessen rühmen, dass er mich seinen Freund nennt. Ich glaube, er könnte mich nicht entbehren."
Ihr seid etwas ganz andere s", unterbrach ihn Brühl lebhaft.
„Ihr hattet das Glück, dem Kronprinzen von seiner frühesten Jugend an Gesellschaft zu leisten. Ihr hattet Zeit, sein Herz zu gewinnen. Wer konnte Euch nachdem er Eure Bekanntschaft gemacht, seine Zuneigung versagen? Was mich betrifft, so bin ich hier fast fremd. Ich verdanke es der Gnade der Fürstin, dass sie mich an der Seite Seiner Majestät untergebracht hat; ich versuche meine Dankbarkeit zu beweisen, aber es ist schwer, sich auf dem glatten Parkett des Hofes irgendwie zu behaupten. Je mehr Eifer ich für meinen verehrten und geliebten Herrn an den Tag lege, umso mehr Neider habe ich. Für jedes Lächeln meines Herrn muss ich einen Blick voller Gift in Kauf nehmen. Wenn der Mensch am glücklichsten sein könnte, muss er zittern." Sulkowski hörte zerstreut zu.
„Ja, das stimmt", sagte er leise, „doch es steht gut für Euch, und Ihr habt keinen Grund zur Besorgnis. Ich habe Euch beobachtet: Eine wunderbare Methode habt Ihr Euch zu Eigen gemacht. Ihr seid bescheiden und habt Geduld. Am Hofe genügt es, auf der Stelle stehenzubleiben, um vorwärts geschoben zu werden; wer dagegen zu sehr nach oben schnellen will, der fällt am leichtesten."
„Oh! Die teuersten Ratschläge schöpfe ich aus Eurem Mund!“ rief Brühl aus. „Was ist es doch für ein Glück, solch einen Führer zu haben!"
Sulkowski schien diesen Ausruf seines Freundes für bare Münze zu nehmen und lächelte mit kaum wahrnehmbarem Stolz. Ihm schmeichelte diese Anerkennung, die ihm das bestätigte, wovon er in der Tiefe seiner Seele selbst am meisten überzeugt war.
„Fürchte dich nicht, Brühl", fügte er hinzu, „schreite mutig vorwärts und rechne auf mich!"
Diese Worte schienen den jungen Heinrich in das größte Entzücken zu versetzen; er faltete die Hände wie zum Gebet, sein Gesicht strahlte vor Freude, er blickte auf Sulkowski und schien nur noch zu überlegen, ob er sich ihm nicht zu Füßen werfen sollte.
Der hochherzige Graf umarmte ihn mit der Güte eines Gönners. Da schallten vom Schloss her Trompetensignale. Das war anscheinend dem jungen Favoriten ein wohlbekanntes Zeichen. Er deutete seinem Gefährten bloß noch mit der Hand an, dass er sich sputen müsse, und eilte mit hastigen Schritten dem Schloss zu.
Brühl blieb allein; er überlegte eine Weile, was er nun anfangen konnte. Der König hatte ihn vom Abenddienst befreit und ihm diesen Abend zum Ausruhen geschenkt. Er hatte also vollkommene Freiheit. In den Zelten begann das Abendessen für den Hof. Zuerst wollte er sich hinzugesellen, um sich mit den anderen zu amüsieren, doch dann, nachdem er ihnen aus der Ferne zugesehen, schlug er einen Seitenweg ein und ging nachdenklich mit langsamen Schritten den Weg entlang, der in den Wald führte. Vielleicht wollte er mit seinen Gedanken allein sein, obwohl eigentlich sein jugendliches Alter und sein Gesicht eine solche Annahme nicht zuließen.
Eher hätte - bei den damaligen Verhältnissen am Hofe mit seinen Liebeleien und Frauenintrigen - der Verdacht einer Herzenskrankheit aufkommen können. Aber in dem ruhigen Gesicht las man nichts von Liebeskummer, der sich dort gewöhnlich mit leicht erkennbaren Symptomen bemerkbar macht. Brühl seufzte nicht, er blickte kalt, seine Augenbrauen waren zusammengezogen und die Lippen fest aufeinandergepresst. Er schien eher angestrengt zu rechnen und zu kombinieren, als mit einem Gefühl zu kämpfen. Ganz in Gedanken versunken, ließ er die Zelte hinter sich, die Pferde, die Hundemeute, die Lagerfeuer und die für die Jagd zusammengetriebenen Leute, die sich an in Säcken mitgebrachtem Brot und Salz stärkten, während dicht daneben für die Herren Hirsche gebraten und würzige Suppen gekocht wurden. Ungefähr zweihundert für die Treibjagd zusammengetriebene Sorben unterhielten sich leise in einer unverständlichen Sprache und trauten sich nicht einmal, laut zu lachen. Von den Zelten her erreichten sie fröhliche Rufe; sie blickten nach dort, und je lauter es dort herging, desto mehr waren sie bemüht, sich leise aufzuführen. Einige Jagdaufseher bewachten das Volk, das sein Brot von daheim mitbringen musste; denn für sie allein sorgte keiner im Schloss. Für die Hunde kochte man Futter in Kesseln, um sie scherte sich keiner. So hatten sie denn auch schnell ihre Abendmahlzeit aus Wasser und Brot beendet. Die meisten von ihnen legten sich unter den Bäumen ins Gras nieder, um sich bis zum Morgen mit Schlaf zu stärken.
Brühl warf kaum einen Blick auf sie und setzte seinen Weg fort. Der Abend war schön, ruhig, warm, hell. Wenn nicht die herabfallenden gelben Blätter der alten Buchen gewesen wären, hätte er an den Frühling erinnert. Ein leiser Windhauch durchzog die Luft, bewegte kaum ein Zweiglein und trug den wohligen Duft des Waldes, den Geruch verwelkten Grüns und die Ausdünstungen des Tannenholzes herbei.
Hinter dem Hain, in dem gelagert wurde, herrschten schon Ruhe, Einsamkeit und Leere. Der Lärm war hier kaum zu vernehmen, die Bäume verdeckten das Schloss. Weit entfernt von jeder Menschenseele hätte man sich hier wähnen können.
Brühl erhob sein Haupt und schöpfte freier Atem; sein Gesicht, das er nun für die Menschen nicht mehr zu verstellen brauchte, nahm, als ob es aller Fesseln ledig wäre, einen ganz anderen Ausdruck an: Ein leichtes, höhnisches Lächeln überzog es, und jene kindliche, gutmütige, sanfte Anmut war verschwunden. Die eine Hand stutzte er in die Hüfte, die andere legte er auf die Lippen. Er überlegte. Er glaubte sich hier vollkommen allein, doch wie groß war sein Erstaunen, ja seine Bestürzung, als er nur einige Schritt entfernt unter einer riesigen alten Buche zwei Gestalten erblickte - zwei unbekannte, verdächtige Gestalten. Unwillkürlich hielt er inne und begann genauer hinzusehen. In der Tat, nur einige Dutzend Schritt vom königlichen Lager mussten die beiden unter dem Baum sitzenden Menschen einen seltsamen Eindruck machen und Verdacht erregen. Neben ihnen lagen Wanderstäbe und zwei eben von den Schultern heruntergenommene Säcke.
Wegen der abendlichen Dämmerung vermochte Brühl weder die Gesichter noch die Kleidung zu erkennen; er erriet mehr, als er sah: Es waren zwei Männer in bescheidener Reisekleidung, jung wie er selbst
Nachdem er schärfer hingesehen hatte, konnte er ihre Gesichter erkennen die vornehmere Züge aufzuweisen schienen, als dies bei wandernden Handwerksburschen der Fall zu sein pflegte, für die er sie erst gehalten hatte. Leise wurde ein Gespräch geführt, doch er konnte nichts verstehen.
Was konnten hier, in der Abgeschiedenheit, in der Nähe des Königs, diese Reisenden wollen? Neugier, Besorgnis, Misstrauen ließen ihn verweilen Er erwog, ob er nicht im Lager Bescheid sagen sollte. Schließlich - mehr vom Instinkt als vom Verstand geleitet - beschleunigte er seinen Schritt und stellte sich so, dass ihn die am Boden Sitzenden sahen. Sein Erscheinen musste die Ruhenden überrascht haben denn einer von ihnen stand eilends auf und blickte den Ankömmling an, als wollte er ihn fragen, was er hier tue und von ihnen wolle. Brühl wartete die Frage nicht ab, sondern trat naher heran und sagte mit ziemlich strenger Stimme: „Was treiben die Herren hier?"
Wir ruhen aus", gab der auf der Erde Sitzende zur Antwort.
„Ist es Reisenden verboten, hier auszuruhen?" Seine Stimme klang sanft, und seine Sprache verriet einen gebildeten Menschen. „Einige Dutzend Schritt von hier befindet sich der Hof Seiner Majestät und der König selbst."
„Wäre es möglich, dass wir da störten?" entgegnete der Sitzende, der überhaupt nicht eingeschüchtert zu sein schien.
Aber Ihr könnt Euch selbst sehr schaden", erwiderte Brühl lebhaft, "jeden Augenblick kann einer der Jägermeister Euch hier entdecken und schlechter Absichten beschuldigen."
Mit einem sanften Lächeln antwortete der auf der Erde Ruhende. Er erhob sich, und als er aus dem Schatten der Bäume hervorgetreten war, zeigte sich Brühl ein Jüngling von schöner und edler Gestalt, mit langen Haaren, die ihm über die Schultern herabfielen. An seinem Gewände konnte man leicht den Studenten einer der deutschen Universitäten erkennen. Er hatte keine besonderen Merkmale an sich, doch kennzeichneten ihn genügend das einfache Kleid, die langen Stiefel, das aus der Tasche herausschauende Buch, das Mützchen, wie es die „Studiosi" trugen.
„Was treiben die Herren hier?" wiederholte Brühl. „Wir befinden uns auf Wanderschaft, um Gott in der Natur zu preisen, um die Luft der Wälder zu atmen, mit ihrer Stille die Seele zum Gebet zu stimmen", begann der Jüngling langsam.
„Die Nacht hat uns hier überrascht. Vom König, vom Hof wüssten wir nichts, wenn nicht der Lärm der Jagdgesellschaft bis zu uns gedrungen wäre." Die Worte und die Art und Weise, wie sie der vor ihm Stehende aussprach, frappierten Brühl. Dieser Mensch kam aus irgendeiner anderen Welt.
„Erlaubt, dass ich Euch, der Ihr hier bestimmt irgendein Amt innehabt meine Person vorstelle", fügte der Student ruhig hinzu. „Ich bin Nikolaus Ludwig Graf und Herr von Zinzendorf und Pottendorf, augenblicklich Studiosus, der die Quellen der Weisheit und des Lichtes sucht, ein im Labyrinth dieser Welt verirrter Wanderer." Er verbeugte sich.
Als er den Namen vernahm, wurde Brühl aufmerksamer. Das Licht des Abends und der matte Glanz des aufgehenden Mondes beschienen das schöne Antlitz des Sprechenden.
Einen Augenblick blieben sie stumm, als ob beide nicht wüssten, in welcher Sprache sie miteinander zu reden hätten. „Ich bin Heinrich Brühl, ein Page Seiner Majestät des Königs." Er verneigte sich leicht. Zinzendorf maß ihn mit den Augen.
„Ach! Ich bedaure Euch!" seufzte er auf.
„Wieso bedauern? Warum das?" fragte der erstaunte Page. „Darum, weil der Hof dienst Sklaverei bedeutet, und Pagentum ist ein Teil davon. Obwohl ich unseren Herrn achte, ziehe ich vor, mich mit Leib und Seele der Ehre und dem Dienst des himmlischen Herrn zu weihen, dem Herrn des Himmels und der Erde, und mich in Liebe zu Jesus Christus, dem Erlöser, zu versenken. Ihr habt uns hier im stillen Gebet angetroffen, als wir gerade bemüht waren, uns in Gedanken mit dem Herrn zu vereinen, der uns mit seinem Blut losgekauft hat." Brühl war so erstaunt, dass er um einen Schritt zurückwich, als ob er fürchtete, der Jüngling, der mit großer Süße und starkem Pathos diese Worte gesprochen hatte, sei wahnsinnig.
„Ich weiß", fuhr Zinzendorf ruhig fort, „dass Euch das alles irgendwie seltsam und vielleicht ungehörig anmuten muss - Euch, dem noch das Geplauder und das Lachen des Hofes in den Ohren klingt. Aber sooft es gelingt, an das Herz eines eingeschlafenen Christen zu rühren, warum sollte man es nicht tun?" Brühl stand schweigend da. Zinzendorf trat nahe an ihn heran. „Die Stunde des Gebets ist da... Hört, die Wälder singen den Abendchoral: ,Ehre sei Gott in der Höhe!' Der Fluss murmelt Gebete, der Mond ist aufgegangen, um dem Gottesdienst der Natur zu leuchten. Sollte unser Herz sich nicht in dieser feierlichen Stunde mit dem Erlöser verbinden?"
Der erstarrte Page hörte zu und schien nichts zu verstehen.
„Ihr seht einen Sonderling vor Euch", fuhr Zinzendorf fort, „doch begegnen einem nicht oft genug weltliche Sonderlinge, denen man verzeiht, und da sollte man nicht auch mit dem Entzücken, das aus heißer Seele aufsteigt, Nachsicht üben?"
„Doch", flüsterte Brühl, „ich bin selbst fromm, aber..." „Aber sicherlich verbergt Ihr Eure Frömmigkeit in der Tiefe Eures Herzens, weil Ihr fürchtet, die Hand oder das Wort eines Unwürdigen könnte sie berühren. Ich hänge sie wie eine Fahne heraus, da ich bereit bin, für sie mit meinem Leben und meinem Blute einzustehen. Bruder in Christo", sagte er, indem er noch näher an Brühl herantrat, „wenn dir das Leben im Strudeln und Wogen des Hofes zu schwer geworden ist - denn anders kann ich mir Euren einsamen abendlichen Spaziergang nicht erklären -, so setze dich zu uns, um mit uns zu ruhen, mit uns gemeinsam zu beten. In mir fühle ich das Verlangen nach dem Gebet, und zu zweit, zu dritt kann das Gebet, um vieles stärker durch die brüderliche Gemeinsamkeit, bis zum Thron dessen aufsteigen, der für uns Erdenwürmer sein Blut geopfert hat, Bruder!" Brühl wich etwas zurück, als ob er fürchtete, festgehalten zu werden. „Ich bete immer allein", sagte er, „und dort warten Pflichten auf mich, verzeiht mir also."
Er wies mit der Hand in die Richtung, aus der der Lärm kam.
„Ich bedaure Euch!" rief Zinzendorf aus. „Hätten wir hier unter diesem Baum gemeinsam als Abendlied angestimmt: ,Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen'..."
„Dann", warf der Page ein, „hätten es der Jagdmeister oder einer der Unterkämmerer des Königs gehört, und man hätte uns nicht in die Wachstube gesperrt, denn eine solche gibt es hier nicht, sondern nach Dresden gebracht und in der Hauptwache bei der Frauenkirche hinter Schloss und Riegel gesetzt."
Bei diesen Worten zog er die Schultern hoch, machte eine kleine Verbeugung und wollte gehen, doch Zinzendorf vertrat ihm den Weg.
„Ist es denn wirklich nicht gestattet, sich hier aufzuhalten?" fragte er.
„Es kann Verdacht auf Euch lenken und Euch Unannehmlichkeiten bereiten. Ich möchte mich entfernen. Hinter der Hubertusburg ist ein Dorf und ein Wirtshaus, wo Ihr ein bequemeres Nachtlager als einen Buchenstamm vorfinden werdet."
„Wie sollen wir gehen, um nicht Seiner Majestät in den Weg zu laufen?" fragte Zinzendorf.
Brühl zeigte die Richtung und schickte sich schon zu gehen an. „Es wird schwierig sein, die Landstraße zu umgehen, Graf; doch wenn ich Euch helfen kann, indem ich Euch unter meinem Schutz auf den Weg geleite: Bitte, verfügt über mich."
Zinzendorf und sein schweigender Gefährte ergriffen schnell die Bündel und Stöcke und eilten Brühl nach, der über diese Begegnung gar nicht froh zu sein schien. Zinzendorf hatte Zeit, sich etwas von seiner Ekstase zu erholen, in welcher ihn Brühl bei seinem plötzlichen Erscheinen angetroffen hatte.
Es stellte sich heraus, dass er ein Mensch aus der höheren Gesellschaft mit guten Umgangsformen war. Nachdem er sich etwas gefasst hatte, bat er sogar wegen seiner seltsamen Rede um Entschuldigung.
„Wundert Euch nicht", sagte er. „Wir nennen uns alle Christen und Söhne Gottes, und in Wirklichkeit sind wir Heiden trotz der bei der Taufe gegebenen Versprechungen. Die Pflicht eines jeden ist es, Apostel zu sein und zu bekehren; ich habe mir das zur Lebensaufgabe gemacht. Was nützt eine Lehre in Worten, wenn sie nicht durch Taten sichtbar wird?
Katholiken, Protestanten, Reformierte, alle sind wir durch unseren Lebenswandel Heiden. Wir beten keine Götzen an, weil es keine Altäre für sie gibt, aber wir opfern ihnen. Einige Geistliche bekeifen sich wegen der Dogmen, der Erlöser aber wird am Kreuze von seinem Blute überströmt, das vergebens in die Erde sickert, da die Menschen nicht erlöst werden wollen." Er seufzte. Als er seine feierlichen Worte beendet hatte, tauchte das Lager auf, das von dem klirrenden Anstoßen der Krüge, die lärmend gefüllt wurden, widerhallte. Zinzendorf sah das mit Entsetzen. „Sind das nicht Bacchanalien? Nur das Evoe fehlt noch!" rief er aus. „Fort von hier, ich fühle mich erniedrigt an der Erde kleben!" Der vorausschreitende Brühl erwiderte nichts. So umgingen sie das Lager. Brühl ging in einiger Entfernung von den beiden, er wies ihnen die nahe Landstraße und sprang selbst, als ob er so schnell wie irgend möglich von dieser Gesellschaft befreit sein wollte, zu einem erleuchteten Zelt.
Noch lagen ihm die wunderlichen Worte Zinzendorfs in den Ohren, als sich seinen Augen ein eigenartiges Schauspiel darbot. Eigentlich stand es in den damaligen Verhältnissen und an diesem Hofe gar nicht so beispiellos da, dass man darüber erstaunt sein konnte; doch zeigte sich selten jemand öffentlich in einem derartigen Zustand, in dem Brühl nun den Herrn Kriegsrat Pauli vorfand. Der Rat lag in der Mitte des Zeltes auf dem Boden, neben ihm eine riesige geleerte, bauchige Flasche, die zerschlagen war; beide Arme hatte er weit auseinandergebreitet, sein Gesicht war karmesinrot, die Kleider waren aufgeknöpft, zerrissen, und der große Jagdhund, der Liebling seines Herrn, saß daneben und leckte ihm jaulend das Gesicht... Der Kriegsrat Pauli, der verpflichtet war, ständig für den König wegen der vielen Korrespondenzen erreichbar zu sein, die er im nüchternen und trunkenen Zustand mit der Fertigkeit eines Kanzleischreibers abzufassen wusste, war nicht zum ersten Male so unglücklich von der Flasche besiegt worden. Es geschah öfter, dass er nach Trinkgelagen in ein weiches Bett, unter eine Bank oder in eine Ecke zu liegen kam; aber so skandalös dem Gespött der Menge ausgesetzt zu sein - das war zu viel des Guten!
Als Brüh) dies sah, stürzte er sofort zu dem Unglücklichen und versuchte ihn vom Boden aufzuheben. Die anderen besannen sich und halfen; so gelang es mit nicht geringem Kraftaufwand, den Herrn Rat den Augen der Neugierigen zu entziehen und ihn auf das in der Ecke bereitete Heulager zu betten. Als man ihn zu dritt von der Erde aufhob, erwachte Pauli. Er ließ seinen Blick über die nächsten Gesichter wandern und stammelte mühsam:
„Ich danke dir, Brühl..., ich weiß alles, ich begreife, ich bin nicht betrunken..., ja, die Ohnmacht. Du bist ein guter Junge; ich danke dir, Brühl." Nach diesen Worten Schloss er die Augen wieder, stieß einen tiefen Seufzer aus und brummte: „Ja, das ist der Dienst!" und entschlummerte.
II Als Sekretär
In dem königlichen Schloss hatten die Leibpagen Augusts II. ihre bestimmten Zimmer, wo sie, der Befehle harrend, Dienst taten. Für den Fall, dass einer von ihnen ausgeschickt werden sollte, standen immer Pferde bereit. Die Pagen wechselten sich an den Türen und in den Vorzimmern ab, sie begleiteten Seine Majestät und wurden oft, wenn Ältere nicht zur Hand waren, mit verschiedenen Schreiben und Befehlen abgesandt.
Eifrig verrichtete der junge Brühl seinen anstrengenden Dienst, wenn die Reihe an ihm war, und sogar gern für andere, so dass der König ihn oft unter seine Augen bekam und sich allmählich an sein Gesicht und seine Bedienung gewöhnte. „Ach, das bist wieder du, Brühl?" pflegte er zu fragen. „Zu Befehl, Eure Majestät." „Wird es dir nicht Zuviel?"
„Ich bin am glücklichsten, wenn man mir gestattet, das Antlitz Eurer Majestät zu sehen." Und der junge Bursche verneigte sich.
Nie blieb er eine Antwort schuldig, niemals gab es etwas, was ihm zu schwer oder unmöglich gewesen wäre; sofort sprang er davon und führte das, was man befahl, unverzüglich aus.
An diesem Tage erwartete man Armeepost, und Antworten sollten abgesandt werden; man wartete auf sie seit dem Morgen. Sehr oft traf die Post damals verspätet ein, weil ein Pferd krepierte oder ein Fluss Hochwasser führte oder der Postillion erkrankte; es gab also keine bestimmte Zeit für ihr Eintreffen.
Seit dem Morgen wartete der Kriegsrat Pauli, der dem König die Depeschen aufsetzte, auf die Post von den Grenzen und auf Befehle. Anfangs wartete er geduldig. Der Rat, den wir bei dem unglücklichen Ereignis auf der Hubertusburg kennenlernten, hatte sich dann ausgeschlafen, gewaschen und war aufgestanden. Er fühlte nichts außer einem peinigenden Durst. Er wusste, dass die Mutter Natur ihm eine Falle stellen wollte, um ihn zum Wassertrinken zu verleiten.
Er war aber schon seit langem ein geschworener Feind des Wassers und hatte die Gewohnheit zu behaupten, der Herrgott habe es für die Gänse geschaffen und nicht für die Menschen. Er ließ sich also durch den Durst nicht hinters Licht führen und ertränkte den Wurm im Wein. Gleich fühlte er sich wohler, rasch war jene Krankheit vergangen und nur eine trübe Erinnerung an sie übriggeblieben.
Der Rat hatte nicht vergessen, dass ihn Brühl an jenem Unglückstage gerettet und zum Schlaf gebettet hatte; seit jener Zeit knüpfte sich eine gefühlvolle Freundschaft zwischen dem alten Pauli und dem jungen Pagen Brühl, der keine Gunst verschmähte, schloss sich dem Rat an. Zwar war dieser schon ein nicht mehr junger Mensch, grässlich vom schweren Dienst an der Kanne mitgenommen, dazu ungemein wohlbeleibt, was ihm die Bewegungen erschwerte; auch die Beine wollten nicht recht mit; sofort nach dem Mittagessen war er zu schlafen bereit, wo es nur möglich war, und wenn es stehend sein musste. Das Gesicht Paulis war gerötet, mit einem Schein ins Violette, die Züge waren verschwommen, das Kinn hing herab. Die Hände, die Füße und der ganze Körper sahen wie gedunsen aus.
Doch wenn er sich für den Hofdienst fertiggemacht, zugeknöpft und die Haltung einer Amtsperson angenommen hatte, hätte man ihn für einen sehr angesehenen Menschen halten können. Er war so an den König gewöhnt und der König an ihn, dass er aus einem Wort, aus einem Blick Augusts einen ganzen Brief spann, den Gedanken erriet, die Form so traf, dass der König nie etwas zu verbessern brauchte.
Deshalb liebte er Pauli, benötigte ihn immer und wollte ihn ständig in seiner Nähe wissen; darum verzieh er dem Rat großherzig, sogar wenn dieser sich betrank, sich so volllaufen ließ, dass er in wichtigen Augenblicken sich nicht hochrappeln konnte.
Drei Kammerdiener mussten ihn dann wecken. Der Rat antwortete, ohne die Augen zu öffnen, wenn sie ihn im Bett herumwälzten: „Gleich! Sofort! Hier bin ich schon! Im Augenblick!" Aber er stand nicht eher auf, als bis ihm klargeworden war, was er angestellt hatte. Wenn er nüchtern wurde, pflegte er sich mit kaltem Wasser zu waschen. Man reichte ihm zur Aufhellung seiner Gedanken ein Gläschen mit irgendetwas Starkem, dann ging er zum König. Derartige Geschichten passierten damals nicht nur ihm allein, noch ganz andere Leute betranken sich, sogar Flemming, der Freund des Königs. Man lachte darüber, obwohl damals ein umnebelter Kopf als eine große Schande angesehen wurde.
An diesem Tage saß Rat Pauli, während man auf die besagten Nachrichten von der Armee wartete, im Marschallsaal und gähnte. Er hatte sich einen bequemen Stuhl ausgesucht, die Beine weit von sich gestreckt, die Hände über dem Bauch gefaltet, den Kopf gesenkt, um ihn bequem auf das Fundament seiner ausgedehnten Kinnpartie zu betten, und überlegte.
Von Schlaf konnte keine Rede sein, denn wer hätte ohne einen Schlaftrunk, ohne jede Vorbereitung durch eine kräftigende Wegzehrung, die einer Reise mit Morpheus in das Land der Träume angemessen war, einschlummern können? Er kannte die im Saal hängenden Bilder, also konnte er sie nicht mehr betrachten. Ab und zu gähnte er, und er gähnte dann so ungeheuerlich, dass ihm die Kiefer krachten. Es war dies ein herzzerreißender Anblick. Solch ein gewichtiger, hochverdienter Rat war gezwungen, nüchtern zu gähnen. Die Uhr zeigte die zehnte, dann die elfte Stunde an, und der Rat saß da, gähnte und schüttelte sich, denn Schüttelfröste der Nüchternheit überliefen ihn. Er war zu dieser Stunde der unglücklichste aller Menschen. Im selben Saal trieben sich viele Leute umher: Pagen, Unterkämmerer, Kämmerer, Personen, die auf Audienz beim König warteten oder davon zurückkehrten. Niemand wagte, die Ruhe des Herrn Rates zu stören.
Um elf Uhr kam der junge Brühl herein, um auf die Stunde seines Dienstbeginns zu warten. Wie ein Engel so schön war er in seiner Pagentracht, die er mit großer Eleganz zu tragen wusste. Sein Gesicht strahlte wie immer vor Gutmütigkeit und erlesener Artigkeit; niemand besaß einen wohlgeformteren Fuß als er, ein schöneres Bein, frischere Spitzen an den Manschetten, einen besser sitzenden Frack und eine kunstvoller frisierte Perücke. Seine Augen lachten, indem sie über die Gesichter und Wände glitten. Er war ein wirklicher Zauberer und eroberte alle Herzen mit einem Lächeln, mit Wort und Bewegung, mit seiner ganzen Gestalt. Als ihn der Rat erblickte, streckte er die Hand nach ihm aus, ohne sich zu erheben. Brühl lief hurtig herbei. „Wie bin ich glücklich!" rief er aus. Und er verbeugte sich demütig.
„Hoffentlich rettest du mich, Brühl! Stell dir vor, ich habe nichts im Magen! Wann kommt die Armeepost?"
Der Page schaute sofort auf die Uhr und zuckte bedauernd mit den Achseln. „Wer kann es wissen?" entgegnete er auf Italienisch, das neben dem Französischen fast zur Hofsprache geworden war, da sich damals die italienische Kolonie in Dresden langsam zu vergrößern begann.
„Elf Uhr! Und ich nüchtern! Die Natur macht ihre Rechte geltend! Ich werde Hungers sterben!" Bei diesen Worten gähnte der Rat, sein ganzer Körper erbebte. „Brrr! und er schüttelte sich.
Brühl stand da, als ob er über etwas nachdachte. Sein Rücken wurde ganz rund, und er beugte sich tief zum Ohr Paulis hinab.
Für alles gibt es einen Rat. Warum habt Ihr Euch hier wie auf einer gewöhnlichen Landstraße niedergelassen? Gleich nebenan befindet sich ein Zimmer, dessen Tür zum Gang führt, der in die Kuchen und Speisekammern mündet. Dort könnte man sich sehr gut, bevor hier etwas geschieht, eine Kleinigkeit aus der Küche oder dem Keller bringen lassen."
Die Augen des biederen Rates leuchteten auf. Sofort wurde er lebendig; doch für ihn war das Aufstehen gar nicht so einfach. Mit beiden Armen musste er sich auf die Armlehnen stützen, die Ellbogen in die Höhe drücken, und schließlich erhob er sich stöhnend mit seiner ganzen schweren Figur. „Mein Erlöser!" rief er aus. „Rette mich Unglücklichen!
Brühl nickte, und sie schoben sich beide durch die Seitentür, die in ein Kabinett mit einem Fenster führte... Hier, o Wunder, hatte eine Zauberhand, als ob man Pauli erwartete, den Tisch schon gedeckt. Davor stand ein breiter, bequemer Stuhl, der speziell für die Leibesfülle Paulis angefertigt zu sein schien. Auf dem schneeweißen Tischtuch standen ein weiß und blau gemustertes Gedeck aus Porzellan, eine kleine Terrine, ein Schüsselchen mit einem Deckel und eine ansehnliche bauchige Flasche voll von golden funkelndem Wein. Als der Rat dies sah, schwang er die Hand in der Luft, und als ob er fürchtete, jemand könnte ihm zuvorkommen, nahm er, ohne zu fragen, schnellstens Platz, schob die Serviette unters Kinn, langte mit der Hand nach der Suppenschüssel und wandte sich, erst jetzt an Brühl denkend, zu diesem um.
„Und Ihr?"
Der Page schüttelte den Kopf. „Das ist für Euch, lieber Herr Rat! „Die Götter mögen es dir vergelten!" rief Pauli voller Entzücken aus. "Möge dir Venus die schönste Jungfrau Dresdens schenken; möge dir Hygieia, die Göttin der Gesundheit, einen Magen schenken, der selbst Steine verdauen kann; möge dir Bacchus ewigen Durst bescheren und Ungarwein, um ihn zu löschen, möge dir..."
Aber das Essen gestattete ihm nicht, den Satz zu beenden; es nahm ihn voll in Anspruch. Brühl stand, mit einer Hand auf das Tischende gestützt, in anmutiger Haltung da und sah dem Rat lächelnd zu. Pauli füllte das erste Glas mit Wein. Er hatte mit einem leichten, gewöhnlichen Ungarwein gerechnet, der am Hofe gereicht wurde; doch als er einen Schluck nahm, erstrahlte sein Gesicht, seine Augen blitzten auf, und nachdem er ausgetrunken und in den Lehnstuhl zurückgefallen war, strich er sich nur noch mit glückseliger Zufriedenheit über die Brust. Ein Lächeln wie das eines Engels erschien auf seinen Lippen. „Ein göttliches Getränk! Du, mein Wundertäter, wo hast du es hergenommen? Ich kenne es, das ist der Wein des Königs, das ist Tokajer! Riech mal, koste: Ambrosia, Nektar!"
„Möge der Herr Rat ihm seine Gunst schenken und nicht zulassen, dass er in der Flasche eintrocknet oder die Lippen Unwürdiger benetzt, die, ohne ihn zu schmecken, ihn durch die Gurgel gießen." „Das wäre wirklich eine Entweihung!" rief der Rat aus, sich das zweite Glas eingießend. „Auf Eure Gesundheit, auf Euren Erfolg, Brühl..., ich werde dir dankbar bis an mein Lebensende sein: Du hast mir das Leben gerettet. Noch eine halbe Stunde - und man hätte eine Leiche von hier nach Friedrichstadt getragen. Ich fühlte, wie das Leben aus meinem Körper entwich."
„Ich freue mich sehr", entgegnete Brühl, „dass ich mit so geringer Anstrengung meines Verstandes dem Herrn Rat eine kleine Gefälligkeit erweisen konnte, aber bitte, trinkt doch!"
Pauli leerte das zweite Glas, schnalzte mit der Zunge und begann mit den Händen in der Luft den Vogelflug nachzuahmen. „Oh, was ist das für ein Wein! Was ist das für ein Wein! Das ist ja ein Getränk von jener Sorte, von der jedes folgende Gläschen immer besser mundet. Er ist wie ein guter Freund, mit dem wir uns desto verbundener fühlen, je besser wir ihn kennenlernen und je enger unsere Beziehungen zu ihm werden. Aber, Brühl, lieber Brühl, wenn die Depeschen eintreffen, wenn Seine Majestät rufen sollte, wenn ich einen Brief nach Berlin, nach Warschau aufsetzen müsste oder einen nach Wien..."
Er wandte den Kopf fragend um, goss sich aber das dritte Glas ein. „Herr Rat, solch eine Flasche für Euch? Was ist denn das? Das ist nur eine unschuldige Freude, das ist nur ein kleiner Ansporn, das ist... nichts."
„Du hast recht, Brühl; unsere Köpfe sind schon mit ganz anderen Dingen fertig geworden." Der Rat lachte auf. „Am gefährlichsten ist, die Getränke zu mischen. Wer kann wissen, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen? Sie können unversöhnliche Feinde sein, wie zum Beispiel der österreichische und der französische Wein. Sie beginnen sich gegenseitig im Kopf und Magen anzugreifen, und der Mensch muss es büßen. Aber wenn man einen anständigen, vernünftigen, reifeh Wein trinkt, hat es keine Gefahr: Er schaltet und waltet ruhig im Menschen und tut einem nichts Böses."
Während er so redete, aß er gebratenes Fleisch mit dickflüssiger Soße, dazu trank er Tokajer und lächelte vor sich hin.
Brühl stand da, sah zu, und wenn das Glas leer war, übernahm er das Amt des Mundschenks und goss fleißig nach.
Am Schluss sahen die Teller wie abgeleckt aus, das Brot war verschwunden. Nur eine halbe Flasche Wein war übriggeblieben. Pauli sah sie schmachtend an, seufzte und brummte unwillig: „Aber die Depeschen?"
„Wie könnt Ihr Euch überhaupt ängstigen?"
„Du hast recht, wenn ich Angst hätte, wäre ich ein Feigling, und auf der Welt gibt es nichts Verachtungswürdigeres als ein solches Geschöpf. Gieß ein! Auf deine Gesundheit! Du wirst es noch weit bringen! Im Kopf wird mir klarer! Es kommt mir so vor, als wäre die Sonne hinter den Wolken hervorgekrochen, denn erst jetzt erscheint mir alles fröhlicher. Ich fühle mich in der richtigen Stimmung, gut zu stilisieren. Jetzt würde ich etwas Ordentliches fertigbringen. Eh, wenn mir doch heute der König etwas Gepfeffertes zu schreiben gäbe! Eh, eh, das würde mir gut gelingen!"
Der Rat schaute auf die Flasche, die unten breiter wurde und noch für eine gewisse Zeit auszureichen versprach.
„Ich brauche nichts zu befürchten", redete Pauli wie zu seiner eigenen Beruhigung. „Ich weiß nicht, ob Ihr Euch darauf besinnen könnt: Einmal, erinnere ich mich, war ein sehr heißer Tag. Der Allergnädigste Herr hatte mich zu der unglücklichen Göttin geschickt, die sich Cosel nannte; dort hat man mich mit schäumendem, verräterischem Sekt traktiert. Er war schmackhaft wie dieser Tokajer hier, aber voller Tücke. Als ich die Straße betrat, bemerkte ich ringsumher ein Wirbeln. Oh! Schlecht stand es um mich, und ich musste gehen, um Depeschen zu schreiben. Zwei Hofleute liehen mir ihren Arm. Mir deuchte, ich hätte Flügel und flöge... Sie setzten mich an den Tisch, sie mussten mir sogar die eingetauchte Feder in die Hand drücken und das Papier zurechtlegen: Der König sagte einige Worte, und eine Depesche wurde geboren, wie man sie wünschte, eine ganz wunderbare! Aber am nächsten Tage erinnerte ich mich nicht mehr, was ich geschrieben hatte, und - schlag mich tot! - bis zum heutigen Tage weiß ich es noch nicht. Der König gab mir lachend zur Erinnerung an diese Tat einen Ring mit einem Saphir." Aus der Flasche floss der Wein in das Glas, und aus dem Glas floss er in Paulis Gurgel. Der Rat strich sich die Brust und lachte. „Ein Hundedienst", bemerkte er leise, „aber ein Weinchen gibt es hier, wie es der Mensch woanders nicht zu riechen bekäme."
Unter Seufzern ging die Flasche zur Neige. Das letzte Glas war etwas trübe; Brühl wollte es weggießen.
„Tyrann!" schrie der Rat auf. „Was tust du da! Die Natur hat diese Teile nicht deshalb ausgeschieden, damit sie weggegossen werden, sondern um auf dem Grunde die Wahrheit des Weines zu offenbaren: den Lebenssaft, die Substanz selbst und die nahrhaftesten Teile." Als Pauli nach dem Glas langte, holte Brühl unter dem Tisch eine zweite Flasche hervor. Bei ihrem Anblick wollte sich der Rat erheben, doch die Freude hatte ihn an den Stuhl geschmiedet. „Was ist das?" rief er, „was sehe ich!"
„Nichts, nichts", sagte der Page leise. „Das ist nur der zweite Band des Werkes, der den Schluss und die Quintessenz enthält. Leider konnte ich", fuhr der Page fröhlich fort, „als ich mich um ein komplettes Werk für den Herrn Rat bemühte, der die Literatur liebt..." Pauli kreuzte beide Arme und nickte.
„Wer hätte solche Literatur nicht gern?" Er seufzte.
„Als ich mich um ein komplettes Werk bemühte", schloss der Page lächelnd, „konnte ich leider nicht zwei Bände derselben Ausgabe bekommen. Dieser zweite Band" - dabei hob er langsam eine bemooste Flasche hoch - „ist von einer älteren, früheren Ausgabe: eine Erstausgabe!"
„Ach!" rief Pauli aus, indem er ihm das Glas hinschob, „gieß mir von dieser werten Gotik eine Seite ein: Man darf das verehrte Altertum nicht über die Maßen genießen."
„Aber was ist es schon wert, wenn es verwittert und sich der Geist der Jahrhunderte aus ihm verflüchtigt!"
„Die Wahrheit! Die tausendfache Wahrheit! Aber die Depeschen! Die Depeschen!" rief achselzuckend Pauli.
„Die Depeschen werden heute nicht eintreffen. Die Wege sind unpassierbar."
„Wenn doch die Brücken zusammengebrochen wären!" Ein weiteres Glas wurde eingeschenkt. Pauli trank es aus.
„Diesen Wein trinkt selbst der König nur dann, wenn er sich unwohl fühlt", flüsterte Brühl.
„Du Allheilmittel! Kein Frauenmund kann süßer sein!" „Na, na!" unterbrach ihn der Jüngling.
„Für Euch ist das etwas anderes, bemerkte der Rat. „Für mich haben sie schon jede Süße verloren. Aber der Wein! Der Wein ist ein Nektar, der bis zum Tode für mich seinen Zauber nicht verlieren kann. Wenn doch nur nicht diese Depeschen wären!' „Na und? Die Depeschen! Jetzt noch..."
„Es ist wahr! Hol sie der Henker!"
Der Rat leerte ein Glas nach dem anderen, aber offensichtlich schienen ihn diese rasch aufeinanderfolgenden Gläser in Träume einzuwiegen. Müdigkeit packte ihn, er ließ sich in einen Sessel sinken, lächelte, und die Lider wurden immer schwerer. „Jetzt ein kleines Schläfchen und..."
„Aber die Flasche muss ausgetrunken werden!" drang der Page in ihm ein.
„Gewiss, das ist die Pflicht eines anständigen Menschen: Entweder fängt man ein Werk gar nicht erst an, oder man führt es ganz zu Ende. Es stimmt doch?" meinte der Rat.
„Was eine Angelegenheit des Gewissens ist, muss gewissenhaft ausgeführt werden."
Nachdem Brühl das letzte Glas eingegossen hatte, holte er eine Pfeife und ein Säckchen mit Tabak hervor.
,Herr Rat, wie war's mit einem Pfeifchen?"
Du mein Engel!" rief Pauli, die Augen aufschlagend. „Auch daran hast du gedacht. Wird mich aber dieses Kraut nicht noch starker benebeln? Was meinst du dazu?" „Es wird Euch ernüchtern!" unterbrach der Page, ihm die Pfeife reichend.
Wie kann man dieser Versuchung widerstehen! Gib her! Gib schon! Was kommen soll, wird kommen. Vielleicht wird der Postillion sich das Genick brechen und die Post nicht eintreffen. Ich wünsche ihm nichts Böses, doch wenn er es sich doch ausrenkte?" Sie lachten. Gierig zog er den Rauch ein.
„Ein starker Tobacco." „Der des Königs", entgegnete der Page. Weil der König wohl mehr als ich verträgt, was?" Wahrscheinlich vom Tabak berauscht, murmelte der Alte nur noch; er machte noch einige Züge, dann rutschte ihm die Pfeife aus der Hand und fiel auf den Boden. Er ließ den Kopf auf die Brust sinken und begann fürchterlich zu schnarchen.
Durch den halbgeöffneten Mund kam ein sonderbares und unangenehmes Geräusch. Brühl sah ihm einen Augenblick zu, lachte kaum vernehmbar, ging leise auf den Zehenspitzen zur Tür und schob sich auf den Korridor hinaus. Hier verharrte er ein Weilchen und lief dann auf dem kürzesten Wege in das Vorzimmer des Königs.
Ein junger, stattlicher, vornehmer Junge, wie Brühl in Pagentracht, mit einer herrischen Miene, hielt den Eintretenden fest. Es war dies Anton Graf Moszynski. Sein weißes Gesicht, seine schwarzen Haare, seine nicht schön zu nennenden, aber ausdrucksvollen Züge, seine funkelnden Augen und vor allem seine aristokratische Haltung und die etwas gezwungenen Manieren zeichneten ihn unter den anderen Pagen des Königs aus. Gemeinsam mit Sulkowski diente er seit langem dem Kronprinzen und war jetzt zeitweilig zu August II. gelangt, der, wie man sagte, seine Geschicklichkeit, seine Lebhaftigkeit und scharfe Auffassungsgabe liebte. Man prophezeite ihm damals eine große Karriere am Hofe. „Brühl", fragte er, „wo warst du?" Der Page zögerte mit der Antwort. „Im Marschallsaal."
„Du hast jetzt Dienst." „Ich weiß, ich habe mich nicht verspätet." Er blickte auf die in der Ecke stehende Uhr.
„Ich dachte schon, dass ich dich vertreten müsste", fügte lachend der sich hin und her wiegende Moszynski hinzu. Über das Gesicht Brühls huschte gleichsam ein Schatten, der aber sogleich wieder verschwand.
„Herr Graf", sagte er sanft, „Euch, dem Favoriten des Königs, ist es gestattet, die Stunde zu versäumen und sich vertreten zu lassen; mir, der ich hier nur ein armer Diener bin, wäre so etwas unverzeihlich." Er verbeugte sich tief. „Ich habe oft andere vertreten, mich aber noch keiner."
„Du willst damit sagen, dass niemand in der Lage ist, dich vertreten zu können!" griff Moszynski auf.
„Oh! Herr Graf! Schickt es sich denn, mit mir armen, einfachen Menschen so zu scherzen? Ich muss mir das erst aneignen, worin Ihr Herren schon Meister seid."
Er verbeugte sich wieder. Moszynski reichte ihm die Hand.
„Es ist gefährlich, mit Euch ein Gefecht mit Worten zu führen, ich zöge eines mit dem Degen vor." Brühl nahm eine bescheidene Haltung an.
„Auf keinem Gebiet kann ich mir eine Überlegenheit anmaßen", fügte er leise hinzu.
„Na, viel Spaß!" rief Moszynski. „Euer Dienst beginnt jetzt. Auf Wiedersehen!" Er verließ das Vorzimmer.
Brühl atmete auf. Langsam ging er zum Fenster, blieb dort stehen und schien gleichgültig auf den Hof zu sehen, der mit Steinplatten ausgelegt war und einem großen Saale glich. Da unten wogte der zahlreiche, geschäftige und betriebsame Hofstaat des Königs. Soldaten in prächtigen Uniformen und Waffen, Kämmerer in goldbetressten Röcken, Kammerdiener und Lakaien, eine Unzahl von Dienstboten des Königs eilten dort hin und her. Einige Sänften standen an den Ausgängen; die gelbgekleideten Träger warteten auf ihre Herren; weiter Galakutschen und Reitpferde, deutsche und polnische Gespanne, Heiducken in roter Uniform, Kosaken - all das verhielt sich ziemlich ruhig und vermischte sich zu einem bunten, malerischen Ganzen. - Der Kämmerer kam vom König.
„Sind die Nachrichten von der Armee schon da?" fragte er Brühl. „Bisher noch nicht."
„Wenn sie eintreffen, bringt sie mir. Der Rat Pauli?" „Ist im Marschallsaal." „Ist gut, soll dort warten."
Brühl verneigte sich leicht. Langsam leerte sich das Zimmer; die Mittagsstunde trieb die Menschen auseinander. Brühl, der wie von irgendeiner Ungeduld erfüllt zum Fenster hinaussah, erblickte endlich auf einem schäumenden Pferd den in den Hof einreitenden Postillion mit seinem auf dem Rücken baumelnden Hörn, riesigen Stiefeln und einer Ledertasche auf der Brust.
Sofort sprang er die Treppen hinunter und hatte die versiegelten Pakete schon in der Hand, bevor sie die Bediensteten in Empfang nehmen konnten. Ein silbernes Tablett stand im Vorzimmer bereit; Brühl legte die Papiere darauf und ging zum König. August spazierte mit Hoym im Zimmer umher.
Als er den Pagen, das Tablett und die Papiere erblickte, streckte er die Hand danach aus und begann sofort, die Siegel zu erbrechen.
Er und Hoym näherten sich dem Tisch und sahen die angekommenen Briefschaften durch.
Brühl stand wartend da.
„Aha!" rief August aus. „Rasch, Pauli soll kommen!
Brühl bewegte sich nicht.
Geh und hole den Rat Pauli!" wiederholte der König ungeduldig. Der Page verneigte sich und lief hinaus. Er schaute in das Kabinett. Pauli schlief wie ein Stein. Brühl kehrte eilends zum König zurück. „Pauli!" rief August, als er ihn eintreten sah.
„Majestät!" stotterte Brühl, „der Rat Pauli... Rat Pauli...
„Ist hier?"
„Jawohl, Majestät."
„Warum kommt er nicht?"
„Rat Pauli", der Page schlug die Augen nieder, „ist etwas unpässlich.“
Und läge er auf dem Sterbelager, bring ihn hierher!" schrie der König. Er soll seine Pflichten erfüllen, dann kann er sterben, wenn er Lust hat!“
Brühl lief wieder davon, sah wieder in das Kabinett, schaute auf den Schlafenden, lachte und kehrte zum König zurück.
Augusts Augen brannten vor wachsender Wut, er begann zu erbleichen was das schlimmste Zeichen war; wenn er weiß wurde, begann seine Umgebung zu zittern.
Brühl blieb stumm und aufrecht an der Tür stehen.
„Pauli!" brüllte der König, mit dem Fuß aufstampfend.
„Rat Pauli ist in einem Zustand..."
„Betrunken?" griff August auf. „Ach, dieses widerliche alte Schwein! Wenn er doch nur für ein paar Stunden aufs Trinken verzichten konnte Begießt ihn mit Wasser! Stellt ihn unter den Springbrunnen! Traktiert ihn mit Essig! Der Arzt soll ihm eine Arznei geben, er soll ihn für eine Stunde zur Besinnung bringen, dann mag dieses Stück Vieh krepieren."
Der König tobte.
Brühl lief gehorsam noch einmal davon. Er versuchte, den Rat zu wecken, doch dieser war zu einem Holzklotz geworden. Kein anderer Arzt als nur die Zeit allein hätte ihn zur Besinnung bringen können. Langsamen Schrittes kehrte er nachdenklich zum König zurück. Er schien innerlich mit sich zu kämpfen, zu zögern, zurückzuschrecken, ängstlich zu sein. An der Tür sandte er einen Seufzer gen Himmel, bevor er die Klinke ergriff.
Der König wartete in der Mitte des Zimmers. Er hielt die Papiere in den Händen, seine Lippen waren aufeinandergepresst, die Brauen gerunzelt. „Pauli!"
„Es ist unmöglich, ihn zur Besinnung zu bringen." „Der Schlag soll ihn rühren! Die Depeschen! Wir wird mir die Depeschen ..., hörst du?"
„Allergnädigster Herr", sagte Brühl, sich mit über der Brust gekreuzten Armen halb verbeugend. „Allergnädigste Majestät, groß ist meine Kühnheit, sie ist fast verwegen. Möge mir Eure Königliche Gnade sie zu verzeihen wissen! Ich weiß, dass ich ohne Verstand bin, aber meine Liebe und Achtung zu Eurer Majestät leiten mich. Ein Wort, Allergnädigster Herr, ein Hinweis..., ich werde versuchen, die Depeschen abzufassen." „Du Milchgesicht?"
Brühl errötete. „Allergnädigster Herr, bestraft mich, wenn..."
August sah ihn lange an.
„Komm her", sagte er, zum Fenster gehend, „hier ist ein Brief, lies ihn durch, erteile eine abschlägige Antwort; aber lasse hinter der Absage durchblicken, dass die Absage nicht endgültig ist. Lasst eine Hoffnung offen, aber enthülle sie nicht allzu deutlich. Verstehst du?"
Brühl verbeugte sich und wollte mit dem Brief hinauseilen.
Ein silberner Tisch stand vor dem kleinen Kanapee. „Was? Wohin?" rief der König. „Hier" - er wies mit der Hand auf das Tischchen - „hier setzt du dich hin und schreibst sofort."
Der Page neigte noch einmal sein Haupt und setzte sich auf die Kante des mit seidenem, geblümtem Stoff bezogenen Kanapees. Mit einer Handbewegung warf er die Manschette zurück, beugte sich über das Papier, und die Feder begann in einer Schnelligkeit dahinzueilen, die den König wunderte.
August II. beobachtete den schönen Jüngling aufmerksam wie ein interessantes Schauspiel. Brühl hatte die gewichtige Miene eines Kanzlisten aufgesetzt und fasste die Depesche ab, als wäre es ein Liebesbrief.
Die Annahme wäre ein Irrtum gewesen, der Page hätte bei der Durchführung einer so wichtigen Aufgabe, die seine ganze Zukunft entscheiden konnte, seine Haltung vernachlässigt. Er hatte scheinbar widerwillig, ohne zu überlegen, Platz genommen und doch seine geschickten Füßchen manierlich gesetzt, seinen Händen eine zierliche Krümmung verliehen, den Kopf geschickt geneigt. Kühle Überlegung leitete ihn bei dieser Angelegenheit, die er in fieberhafter Eile auszuführen schien. Der König ließ kein Auge von ihm; Brühl fühlte dies.
Ohne lange nachzudenken, schrieb der Page; er schrieb, als ob man ihm fertige Gedanken diktierte. Nicht ein einziges Mal strich er etwas durch, nicht einen Augenblick hielt er inne. Die Feder ruhte erst dann, als die Depesche fertig war.
Dann überflog er sie noch einmal und stand in straffer Haltung auf.
Mit offensichtlicher Neugier, bereit, nachsichtig zu sein, kam der König etwas näher. „Lies!" befahl er.
Brühl räusperte sich; seine Stimme wurde leise und zitterte etwas. Wer weiß, ob dieser Beweis seiner Unsicherheit nicht auch kluge Berechnung war?
Der König fügte ermutigend hinzu: „Langsam, deutlich, laut." Der junge Page begann also die Depesche zu lesen; seine Stimme, die anfänglich gezittert hatte, wurde bald deutlich und metallisch klar. Auf dem Gesicht Augusts malten sich nacheinander Erstaunen, Freude, Fröhlichkeit, Bewunderung und eine gewisse Ungläubigkeit. Als Brühl zu Ende gelesen hatte, wagte er kaum, die Augen zu heben. „Noch einmal, von Anfang an!" befahl der König. Diesmal las Brühl noch lauter, mutiger und nachdrücklicher. Das Gesicht des Königs hellte sich auf; er klatschte in die Hände und rief: „Hervorragend! Pauli hätte es nicht besser, nicht einmal so gut getroffen. Schreib es ins reine!"
Brühl reichte mit tiefer Verbeugung sein Blatt hin, das so geschrieben war, dass es gleich verwandt werden konnte. August schlug ihm auf die Schulter.