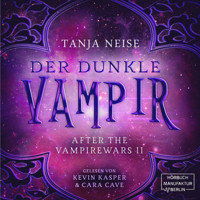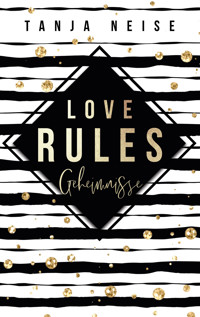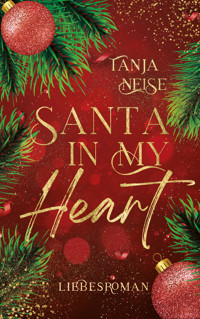
1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Glöckchen, das Glück bringen soll? Tami Biggs glaubt nicht an solchen übersinnlichen Kram. Kurz vor Weihnachten trifft sie im verschneiten New York auf den charmanten Adam Cooper und während die winterliche Atmosphäre die ganze Stadt erfasst, kommen die beiden sich näher. War die Begegnung der beiden wirklich nur Zufall oder etwa Schicksal? Ein Weihnachtsroman von der Bestseller-Autorin Tanja Neise über das Glück, die große Liebe und den Zauber von Weihnachten. Der Roman ist in sich abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
SANTA IN MY HEART
Tanja Neise
1. Auflage 2023
Copyright © 2023 Tanja Neise
Eine Kopie oder anderweitige Verwendung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Neise, Johannesstr. 30, 14624 Dallgow
Coverdesign: Kreationswunder by Katie Weber, kreationswunder.de
Lektorat: Sina Müller
Korrektorat: Das kleine Korrektorat – Ruth Pöß
Inhalt
Über das Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Epilog
Nachwort
Danksagung
Bücher von Tanja Neise
Bücher von Emma Bishop
Santa in my heart
TANJA NEISE
Über das Buch
Klappentext
Ein Glöckchen, das Glück bringen soll?
Tami Biggs glaubt an solchen übersinnlichen Kram nicht. Kurz vor Weihnachten trifft sie im verschneiten New York auf den charmanten Adam Cooper und während die winterliche Atmosphäre die ganze Stadt erfasst, kommen die beiden sich näher.
Doch war die Begegnung der beiden wirklich nur Zufall oder etwa Schicksal?
Ein Weihnachtsroman von der Bestseller-Autorin Tanja Neise über das Glück, die große Liebe und den Zauber von Weihnachten.
Der Roman ist in sich abgeschlossen.
Kapitel 1
Tami
Nein! Das kann doch nicht wahr sein!, fluchte ich innerlich.
Ich liebte Weihnachten und das Dekorieren meiner Boutique in allen Farben und Stilen. So war es nicht verwunderlich, dass ich mich auch dieses Jahr in den Rausch des Schmückens gestürzt hatte. Aber das, was in diesem Moment geschah, grenzte schon an Tyrannei des Schicksals.
Jetzt stand ich hier und kämpfte tatsächlich um mein Leben. Über die Theatralik meiner eigenen Gedanken hätte ich sicherlich grinsen müssen, wenn ich mich mittlerweile nicht bereits zum dritten Mal beinah mit der bunten Lichterkette erdrosselt hätte, die ich für die diesjährige Weihnachtsdekoration der Boutique ausgesucht hatte.
»Mischt!«, stieß ich undeutlich hervor, weil ein Teil der Dekokette zwischen meinen Zähnen klemmte und das, während ich auf einer Trittleiter balancierte.
Rückblickend betrachtet war auch die Entscheidung, meine hochhackigen schwarzen Samtpumps dabei anzulassen, nicht die beste Idee meines Lebens gewesen, aber sie passten so perfekt zu dem Kleid aus rotem Samt, der schwarzen Schärpe und dem weitschwingenden Unterteil. Ich brachte es einfach nicht übers Herz, eine solch perfekte Kombi auseinanderzureißen, nicht mal, um einen Genickbruch zu verhindern.
Ein irres Kichern kam über meine Lippen, doch dann seufzte ich erschöpft, streckte mich noch einmal so weit nach oben wie möglich und schaffte es endlich, die Kette dort einzuhaken, wo ich sie ursprünglich eingeplant hatte.
Die Dekoration draußen vor meinem Laden war schon nahezu perfekt. Das Einzige, was noch fehlte, um die Komposition aus weinroten Weihnachtssternblüten, silbrig glänzenden Engelsflügeln und weiß-grünen-roten Zuckerstangen zu vervollständigen, waren frische Mistelzweige. Die wollte ich in den nächsten Tagen in einem Park pflücken.
Dementsprechend musste auch drinnen die Deko perfekt sein. Und ich würde nicht eher Ruhe haben, bis alles so aussah, wie ich es mir bei der Planung vorgestellt hatte. Immerhin stand die Vorweihnachtszeit kurz bevor, die Zeit, die meine Einnahmen hoffentlich in schwindelerregende Höhen treiben würde.
Auf der New Yorker Fashion Week, die im September in diesem Jahr stattgefunden hatte, war ich mit meiner neuen Kollektion als Newcomer Brand dabei gewesen und die Weihnachtsdekoration im Innern meiner Boutique sollte die Farben dieser Kollektion widerspiegeln: Bordeauxrot, dunkles Grün und Karamellbraun. Oder wie die Reporter, die über die Trendfarben des Winters berichtet hatten, kreativ schrieben: Bordeaux-Lava-Red, Green-like-Wood und Spicy-Caramel.
Für mich grenzte das Erfinden neuer Bezeichnungen für altbekannte Farben ja an kreativen Aktionismus, aber ich war auch keine Marketing-Expertin, sondern Designerin.
Vielleicht hätte ich meine Ziele schneller erreichen können, wenn ich beides wäre …
Marketing war so gar nicht meins und dass man sich selbst in den Himmel loben und vermarkten musste, war etwas, das mir echt schwerfiel. Ich schüttelte den Kopf über mich und die Unfähigkeit, die ich in diesem Bereich vorwies oder besser gesagt nicht vorwies, und kletterte vorsichtig die Trittleiter herunter. Dafür, dass ich meine Boutique erst vor einem Jahr eröffnet hatte, lief alles prima. Meine Umsätze waren gut genug, dass ich den Kredit, den Mom mir gegeben hatte, schon fast abbezahlt hatte. Meine Kollektionen hatten es bereits in einige Modemagazine geschafft und, wie man so schön sagte: Gut Ding will Weile haben. Ich konnte zufrieden sein. Aber der Mensch griff so gern nach den Sternen und wollte weiterkommen und so war auch ich. Und dafür musste man auch noch geduldig sein, etwas, das mir echt schwerfiel.
Manchmal war ich tatsächlich zu ungeduldig, ich hätte es gut gefunden, wenn alles ein bisschen schneller gegangen wäre. Nach wie vor dachten Kunden, ich sei nur die Verkäuferin in diesem Laden, nicht die Besitzerin, und das sagte mir, dass ich noch nicht bekannt genug war, ansonsten würden sie mit meinem Gesicht auch gleich mein Label in Verbindung bringen. Oder etwa nicht?
Ich wollte so gern, dass die ganze East Coast mein Label TamBi kannte. Und danach die West Coast. Und im Anschluss die ganze Welt! Aber ich wusste auch, wie schwer es war, sich einen Namen zu machen. Die Branche war hart umkämpft und niemand wartete auf eine kleine New Yorkerin mit irren Ambitionen.
Allein der Gedanke, dass mein Traum irgendwann wahr werden könnte, ließ mich lächeln. Man durfte ja noch träumen! Und das tat ich in solchen Momenten öfter. Aber waren nicht alle Kreativen so wie ich? Jeder, der kreativ tätig war, sei es eine Sängerin, eine Autorin oder eine Designerin wie ich, wollte doch für seine Werke bekannt und gemocht werden. Klar stellte es ein ewiges Streben dar und harte Arbeit steckte dahinter, aber es war auch nicht völlig ausgeschlossen, dass sich eines Tages mein Traum erfüllen würde. Und dafür arbeitete ich hart, oft bis spät in die Nacht hinein, wenn ich eine Idee hatte und diese umsetzte, sei es am Zeichentisch oder direkt an der Nähmaschine. Zwar hatte ich mittlerweile eine Schneiderin anstellen können, allerdings arbeitete diese nicht vierundzwanzig Stunden und sieben Tage die Woche. Außerdem saß ich auch ganz gern mal selbst an der Nähmaschine. So hatte schließlich alles angefangen – designen und schneidern musste ich am Anfang beides können.
Langsam stieg ich die Trittleiter hinab, und als ich sie zusammenklappte, spürte ich plötzlich ein schmerzhaftes Ziehen an meinem Hinterkopf, was dazu führte, dass ich die Augen zusammenkniff.
»Aua!«, rief ich laut aus und griff nach hinten. Eine Strähne meines dunklen, widerspenstigen Haares hatte sich in der Leiter verfangen und es grenzte an eine akrobatische Leistung, meine Arme so weit nach hinten zu biegen, um die Bescherung zu lösen. Immer wieder verhedderten sich meine Locken in etwas, was mich total nervte.
»Okay«, sagte ich nach ein paar Minuten erschöpft zu mir selbst und ließ mich hinter dem Tresen auf den Hocker fallen. »Genug dekoriert für heute.«
Als ich nach dem Handspiegel griff, um das Chaos auf meinem Kopf zu beseitigen, hörte ich das leise Klingeln des Türglöckchens an der Eingangstür. Es bimmelte in einer Melodie, die mir unbekannt war. Doch dann erinnerte ich mich daran, dass meine Mom mir ein Neues geschenkt hatte. Sie hatte es mir mit den Worten übergeben, dass es ein magisches Glöckchen sei, dass mir Glück bringen würde. Dass ich das vergessen hatte, zeigte, wie sehr ich durch den Wind sein musste.
Ich blickte rasch auf die Uhr. Offiziell öffnete meine Boutique erst in fünfzehn Minuten, aber das war trotzdem okay für mich. Der Kunde war bekanntlich König und ich freute mich noch immer über jeden, der den Weg in meinen Laden fand. Normalerweise arbeitete Amy für mich in dem Laden. Als Halbtagskraft übernahm sie meistens die Frühschichten, damit ich länger schlafen konnte, weil ich oft nachts kreativ war. Aber sie war wegen Thanksgiving zu ihrer Familie nach Missouri gefahren und das für ganze zwei Wochen. Ich hoffte inständig, dass die Zeit schnell vorbeigehen würde.
Ich lächelte das Paar, das zur Tür hereinkam, freundlich an und stand auf. »Hallo, willkommen bei TamBi.« Schnell fuhr ich mit der Hand noch über meine Haare, um nicht so mitgenommen auszusehen, und konzentrierte mich anschließend auf meine beiden Kunden.
Der Mann hob die Hand zum Gruß und schenkte mir ein charmantes Lächeln, seine Freundin, eine typische New Yorkerin mit blonden, langen, glattgeföhnten Haaren, ignorierte mich geflissentlich. Sie tat so, als wäre ich gar nicht da. Das fühlte sich wie so oft nach einer Spur Abwertung an, wenn die Leute mich dermaßen ignorierten. Feinheiten, die Menschen, die nicht in Berufen tätig waren, in denen sie Kundenkontakt hatten, nicht mal auffielen. Aber ich hatte im Laufe des letzten Jahres gelernt, auf so etwas zu achten. Dabei war ich noch nie jemand gewesen, der im Mittelpunkt stehen wollte, aber ich gierte danach, respektvoll behandelt zu werden. Schließlich gehörte das zum guten Ton, egal, als was man arbeitete. Respekt hatte jeder verdient, denn unser System funktionierte nur, wenn sich alle Rädchen drehten. Zumindest war ich dieser Meinung.
Nachdem ich um den Tresen herumgegangen war, trat ich auf meine beiden Kunden zu. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich und lächelte die zwei an, obwohl das Lächeln nur für den freundlichen Mann bestimmt war, auf keinen Fall für die Frau, die mich weiterhin von oben herab behandelte.
Nun hob die Blondine den Kopf und sah sich einmal geziert in meinem Laden um, so als hätte sie das nicht schon beim Reinkommen getan. »Ich habe von diesem Laden in Missy Bellys Fashion Blog gelesen.« Sie machte eine Pause und blickte mich endlich an, jedoch nicht ohne mich dabei ihre Herablassung spüren zu lassen. »Missy Belly schreibt über …«
»… Newcomer in der Modeszene. Ich weiß. Ich bin die …« Gerade wollte ich ihr erklären, dass ich die Designerin des Labels und Besitzerin der Boutique war, doch ich kam gar nicht dazu, weil ich sofort in barschem Ton unterbrochen wurde.
»Wenn Sie darüber Bescheid wissen, muss ich Ihnen ja sicher nicht groß erklären, welches Stück ihr am besten gefallen hat. Ich will es haben! Genau das!«
Puh, war die anstrengend! Ich presste die Lippen aufeinander und verkniff mir einen bissigen Kommentar, räusperte mich und versuchte, freundlich zu sein. »Darf ich Ihnen beiden vielleicht ein Glas Prosecco anbieten, bevor ich die passenden Stücke heraussuche?« Ruhig bleiben und nicht auf das Niveau der Kunden herablassen war wohl im Moment das passende Mantra.
Die Kundin suchte den Blick ihres Freundes und verzog ihr Gesicht, um ihm klarzumachen, was sie von mir hielt.
»Gern«, sagte der und lächelte mich wieder freundlich an. Und das Lächeln erreichte sogar seine Augen, was ich ihm hoch anrechnete. Er war extrem attraktiv, groß und sportlich, mit diesen tollen dunklen Haaren, die der Welt verraten sollten, dass Stylingprodukte etwas für Loser waren und diese Haarpracht das nicht benötigte.
Mir war plötzlich ganz flau im Magen. Vielleicht war der Kerl irgendein Netflix-Star und die Frau an seiner Seite eine Newcomerin in der Filmbranche. Vielleicht ließ sie sich auch von dem Mann aushalten … Stopp! Keine Vorurteile! Ansonsten wäre ich nicht besser als die Menschen, die in mir die Verkäuferin sahen und mich von oben herab behandelten. Niemals kämen diese Menschen auf die Idee, dass ich diejenige war, die sich die Kreationen ausdachte. Im Grunde war es auch egal, aber irgendwie war ich ja auch stolz auf das, was ich tat und wollte die Lorbeeren dafür ernten. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, auf meinem Instagram-Kanal doch mal mein Gesicht zu zeigen.
Damit keiner der beiden bemerkte, wie sehr mich der Kerl durcheinanderbrachte und die Blondine aufregte, drehte ich mich von ihnen weg, um zum Kühlschrank in dem kleinen Abstellraum hinterm Tresen zu gehen. Wie jedes Mal, wenn ich ein solches Pärchen erlebte, fragte ich mich, wieso charmante, attraktive Männer immer auf diesen einen Typ Frau reinfielen. Warum suchten sie sich bloß immer diese verwöhnten Frauen?
»Gibt es keinen Champagner?«, rief die Frau mir hinterher.
Da ich mit dem Rücken zu beiden stand, erlaubte ich es mir, die Augen zu verdrehen. »Tut mir leid, der ist gerade aus«, antwortete ich, ohne mich umzudrehen. Ich füllte zwei Gläser mit Prosecco und ging wieder zurück in den Verkaufsraum.
Die beiden Kunden nahmen die Gläser entgegen. Der Mann prostete mir zu, die Frau stierte mich über das Glas hinweg aus zusammengekniffenen Augen an. Offensichtlich gefiel es ihr nicht, dass der Kerl so freundlich zu mir war. Ich schenkte ihr ein müdes Lächeln.
»Was ist jetzt mit dem Stück, über das Missy Belly geschrieben hat?«, fragte sie mich in ungeduldigem Tonfall, den diese Art von Kundinnen sich offenbar gegenseitig beibrachten.
»Ausverkauft«, antwortete ich knapp und schenkte der Blondine ein entschuldigendes Schulterzucken. »Aber wir haben tolle andere Sachen, die ich Ihnen gerne …«
»Sie wissen nicht, über welches Stück ich spreche, oder?«, unterbrach sie mich und hob dabei ihre perfekt gezupften Augenbrauen.
Ich wendete mich ab, schritt zu einem Kleiderständer am anderen Ende des Raums und spulte wie automatisch herunter: »Minirock aus karamellfarbener Wolle, mittellanger Schlitz auf der linken Seite. Ausverkauft. Hier sind die Röcke, die ich noch habe. Einige davon haben dieselbe Farbe.«
Die Kundin folgte mir zögerlich zu dem Ständer.
»Das hier ist …«, begann ich und zog einen Rock hervor, den ich ihr zeigen wollte, doch die Kundin stellte sich mir in den Weg. Es wirkte auf mich beinahe, als wolle sie mich schubsen.
»Ich sehe mir das selbst an, danke«, erwiderte sie.
»Bitte, gern.« Ich ging auf Abstand und stellte mich neben ihren Freund. Dabei musste ich mich beherrschen, nicht die Arme vor dem Körper zu verschränken und genervt die Augen zusammenzukneifen.
»Toller Laden«, versuchte der Mann, die Situation zu retten, und lächelte wieder.
»Danke«, antwortete ich kurz angebunden. Ich war einfach zu wütend und enttäuscht, dass es Menschen gab, die dachten, sie wären etwas Besonderes, nur weil sie mehr Geld besaßen als der Durchschnitt. Was bitte zeichnete solche Leute aus? Was machte sie zu besseren Menschen? Nichts. Rein gar nichts. Viel wichtiger war es doch, freundlich, mitfühlend und respektvoll zu sein.
Der Mann beugte sich etwas zu mir und ich nahm sein außergewöhnliches Parfum wahr, eine Mischung aus Sandelholz und etwas Frischem. »Sorry«, flüsterte er und nickte in Richtung seiner Freundin. »Normalerweise ist sie nicht so.«
Erstaunt hielt ich in meinem Unfrieden und wütenden Gedanken inne und tat so, als hätte ich nichts gehört, obwohl mir insgeheim danach war, ihn dankbar anzulächeln. Wir standen eine Weile da und beobachteten, wie die Blondine sich durch meine Kollektion wühlte, offenbar eifrig darauf bedacht, jedes einzelne Stück anzufassen. Mir war schon jetzt klar, dass sie nichts kaufen würde, einfach aus Prinzip, weil ich den Rock, den sie hatte haben wollen, nicht da hatte.
»Ich kann Ihnen auch noch etwas aus dem …«
Genervt fuhr sie zu mir herum und funkelte mich an. »Ich sagte, ich sehe mich alleine um. Aber bisher habe ich überhaupt nichts gesehen, das mir gefällt.«
Tief atmete ich ein. Ich wollte nicht antworten, doch dann entfuhr mir: »Für die Fashion Week hat es gereicht.«
»Da darf mittlerweile auch jeder hin.« Provozierend sah sie mich an.
Ich hob die Augenbrauen und presste erneut die Lippen aufeinander. Es lohnte sich nicht, mit solchen Menschen zu streiten, das würde mich nur noch mehr ärgern und wäre absolut unprofessionell.
»Beatrice!«, rief stattdessen ihr Freund neben mir laut aus und ich merkte, wie sich sein ganzer Körper vor Ärger anspannte. Entrüstet starrte er seine Freundin an. Offenbar hatte er seinen blonden Engel bisher wirklich noch nicht so erleben dürfen und nun wurden dem armen Kerl die Augen geöffnet.
»Ist schon okay«, murmelte ich ihm zu.
»Ist es nicht«, entgegnete er in ruhigem, aber sehr bestimmten Tonfall.
»Ich verstehe schon, wie es ist, wenn man sich beim Shoppen etwas ganz Spezielles gewünscht hat und es nicht findet. Ich bin schließlich auch eine Frau.« Ich zwinkerte ihm zu, um ihm zu zeigen, dass das Verhalten seiner Freundin mir nichts anhaben konnte. Doch sein charmantes und einfühlsames Lächeln, mit dem er mein Zwinkern erwiderte, verschlug mir die Sprache und ich wendete mich schnell ab.
»Sie sind wirklich eine nette und zuvorkommende Person«, bemerkte er leise. »Vielleicht holen Sie sich auch einen Prosecco, das überbrückt die Zeit leichter. Ich kümmere mich um Beatrice.«
Gelöst atmete ich leise auf und kassierte daraufhin einen wütenden Blick von der Blondine. Doch ich drehte mich von ihr weg, ignorierte sie und lehnte mich mit dem Rücken an den Tresen, um etwas Abstand zu den beiden zu bekommen.
Beatrice. Was für ein bescheuerter Name.
»Wenn es unbedingt sein muss, probiere ich diesen Rock an«, maulte sie, nachdem ihr Freund einen Rock gezeigt hatte, der ihm gefiel.
Ich schaute neugierig zu ihr und sah, wie sie einen schwarzen Minirock hervorzog. »Nein, Adam. S ist mir viel zu groß. Ich trage Size Zero.« Sie sah von ihrem Freund zu mir. Herausfordernd begegnete mir ihr Blick, der anschließend meinen Körper hinabglitt. »Es gibt Frauen, die das tragen können.«
Nun klappte mein Mund doch auf und in mir brodelte es gewaltig. Ich hatte nicht übel Lust, Miss Size Zero einen Kleiderbügel an den Kopf zu schmeißen. Ich war überhaupt nicht dick! Ich hatte eine völlig normale Figur! Okay, ich war nicht die Sportlichste, dennoch schlank und hatte Rundungen an den richtigen Stellen.
Aber weit weg von Size Zero …
»Ich sehe im Lager nach«, grummelte ich und sah im letzten Moment noch, dass dem netten Mann die Gesichtszüge entglitten waren.
»Vergessen Sie den Prosecco nicht«, rief der charmante Mann mir noch hinterher. »Für die Nerven.« Doch in seiner Stimme klang ein grollender Unterton mit. Vielleicht sollte ich gleich die ganze Flasche mitbringen und ihm nachschenken.
Kapitel 2
Adam
Ich war, gelinde gesagt, schockiert. Dennoch versuchte ich, mir nichts anmerken zu lassen. Bis vor gerade mal zehn Minuten schien mir Beatrice noch die perfekte Frau zu sein.
Sie hatte Modelmaße, ein schönes, ausdrucksstarkes Gesicht und ein charmantes, einladendes Lächeln, das einen Mann um den Verstand bringen konnte. Denn dieses Lächeln setzte Beatrice nur sparsam ein. Doch eventuell hatte ich mit der Einschätzung ihrer inneren Werte völlig danebengelegen. Bis wir diesen Laden hier betreten hatten, war ich von ihr verzaubert gewesen. Glaubte sogar, dass sie diejenige sein könnte, mit der ich endlich eine feste Beziehung eingehen könnte. Aber so, wie sie sich jetzt gebärdete und die nette Verkäuferin schlecht behandelte, zweifelte ich nun daran. Vielleicht hatte sie mir die ganze Zeit etwas vorgespielt, zumindest kam es mir gerade eben so vor.
Ich erinnerte mich an Charlys Worte, als ich ihr von Beatrice erzählt hatte. Meine Schwester hatte, begleitet von einem obligatorischen Augenrollen, klar zu erkennen gegeben, was sie von meiner neuen Freundin hielt. Sie war sogar so weit gegangen, mich vor ihr zu warnen, nachdem ich sie ihr vorgestellt hatte. Aber ich war da nicht wirklich drauf eingegangen, denn Charly hatte noch nie viel für die Frauen in meinem Leben übriggehabt. Von daher hatte ich ihre Reaktion auf Beatrice bis gerade eben sogar vergessen.
Ich war mittlerweile dreißig Jahre alt und konnte für mich selbst entscheiden. Es war mir völlig egal, was Charly von Beatrice oder den anderen Frauen hielt, die ich gedatet hatte. Es war mein Leben und meine Begleitung. Ich musste damit klarkommen. Das tat ich.
Meistens. Nicht immer. Jetzt zum Beispiel ….
Ich wusste, dass meine Schwester es mit ihren Ratschlägen nur gut meinte und ja, ich liebte sie dafür, dass sie so fürsorglich war. Es gab durchaus Momente – diesen hier beispielsweise – da hinterfragte ich meinen Frauengeschmack ganz gewaltig.
Es war ja auch nicht so, als sei es das Einfachste auf der Welt, die Liebe seines Lebens zu finden. Charly hatte Glück gehabt. Ihr Mann war Arzt, genau wie sie. Die beiden hatten sich klischeehaft an der Uni kennengelernt. Sie waren glücklich zusammen, doch ich hatte ein solches Glück bisher noch nicht gefunden. Jedenfalls nicht in der Liebe. Beruflich schon.
Der erste Roman, den ich am College einfach nur zum Spaß runtergetippt hatte, war in Rekordzeit zum Bestseller geworden. Plötzlich stand ich als der Shootingstar der US-amerikanischen Literaturszene da, und wer in Amerika, insbesondere in New York und Hollywood, als Shootingstar gehandelt wurde, wurde auch schnell mal in die High Society katapultiert. Dort hielt sich oft ein bestimmter Schlag Frauen auf. Die, die es selbst zu etwas gebracht hatten – das waren jedoch nicht viele – und diejenigen, die sich an jemanden ketten wollten, der erfolgreich war – davon gab es reichlich viele.
Bisher hatte ich leider nur die zweite Kategorie näher kennengelernt. Das hatte mich bis jetzt nicht besonders gestört. Nicht, weil ich oberflächlich war, sondern weil mein Fokus zu sehr auf dem Schreiben lag, meinem Sein als Thrillerautor und ich oft mit Abgabeterminen zu kämpfen hatte. So hatte ich kaum Zeit, die Frauen auf Herz und Nieren zu prüfen, die ich kennenlernte und nach ein paar Wochen stellte ich immer fest, dass ich wieder eine Frau in mein Leben gelassen hatte, die es nicht wert war, ihr nachzutrauern. Allerdings hatte ich auch nicht wirklich darüber nachgedacht, mir eine nette Frau aus einem anderen Kreis zu suchen, wenn ich ehrlich zu mir war. Dafür hatte ich schlichtweg keine Zeit, denn am liebsten saß ich nun mal vor dem PC und tippte die Geschichten in die Tasten, die mir in den Sinn kamen. Ich liebte meinen Job. Und wo hätte ich denn suchen sollen? In einer Bar? Dafür war ich ganz bestimmt nicht der Typ.
Vorsichtig stellte ich das leere Glas auf dem Verkaufstresen ab und beobachtete, wie Beatrice sich ein weiteres Mal durch die Kleider wühlte, nachdem sie aus der Umkleidekabine gekommen war. Im Moment hatte sie sowohl meine als auch die Anwesenheit der Verkäuferin vergessen. Ich sah mich nach der jungen Frau mit dem dunklen lockigen Haar um und unsere Blicke trafen sich. Sie hatte sich an den Tresen gelehnt und blickte mich unverwandt an. Ihre Mähne fiel über ihre Schultern und eine Strähne stand etwas ab. Erst jetzt sah ich, dass sie azurblaue Augen hatte und wie auf Kommando drängte sich das Bild einer meiner Protagonistinnen vor mein inneres Auge, einer Heldin, die erfolgreich gegen ein böses Kartell kämpfte. Sie sah in etwa so aus, wie ich mir meine Heldin während des Schreibprozesses vorgestellt hatte. Wild, durchsetzungsstark und in sich ruhend.
Oh ja, in sich ruhend war sie. An ihrer Stelle wäre ich wahrscheinlich schon längst explodiert. Beatrice benahm sich dermaßen daneben, dass es mir peinlich wurde und ich ernsthaft mit dem Gedanken spielte, den Laden zu verlassen und sie einfach stehenzulassen. Aber etwas hielt mich zurück, oder besser gesagt jemand. Die freundliche Verkäuferin. Ich konnte sie schlecht mit dieser Version meiner Beatrice allein lassen, zumal meine Freundin nach einem Abgang meinerseits sicherlich noch mehr aufdrehen würde.
»Das ist schrecklich«, hörte ich sie plötzlich sagen.
Ich riss den Kopf herum und sah, dass sie zuerst mich, dann die Verkäuferin böse anfunkelte. So, als wären wir für ihr Unvermögen, etwas Schönes in diesem Laden zu finden, persönlich verantwortlich. Dabei gab es hier so viele hübsche Kleidungsstücke, dass ihr davon bestimmt etwas gefallen könnte, wenn sie sich nur endlich von ihrem Wunschrock verabschieden würde. Aber sie war nicht zufriedenzustellen und wollte unbedingt der jungen Frau eins auswischen, wie mir schien. Nur warum? War das so ein Frauending?
Mit zwei Teilen in der einen und dem noch vollen Glas Prosecco in der anderen Hand schritt sie auf die Verkäuferin zu. »Das ist überhaupt nicht, was ich wollte, und Sie sind auch keine große Hilfe.«
»Das tut mir unendlich leid«, antwortete diese, doch weder ihre Stimme noch ihr Blick passten zu den ausgesprochenen Worten, was mich schmunzeln ließ.
»Hm. Tja.« Mir klappte der Mund auf, als ich sah, wie Beatrice ihren Prosecco auf den Tresen stellte und mit dem Ellbogen dagegen stieß. Das Glas kippte klirrend um und der gesamte Inhalt entleerte sich auf die beiden Designerstücke, die sie genau danebengelegt hatte. »Ups.«
»Was ...?«, entfuhr es der dunkelhaarigen Verkäuferin.
»Wir gehen, Adam«, sagte Beatrice, den Blick weiter auf die andere Frau gerichtet, so als warte sie darauf, dass diese etwas zu ihrem Missgeschick sagte. Doch sie erntete nur Schweigen. Beatrice drehte sich um, warf ihre Haare zurück und stöckelte erhobenen Hauptes an mir vorbei nach draußen, wo sie kurz über ihre eigenen Füße stolperte.
Ich starrte ihr mit offenem Mund nach. Hatte sie das gerade eben wirklich absichtlich getan, oder hatte ich das falsch gesehen?
Was war das denn eben?! Wer ist diese Frau? Zumindest nicht die, für die ich sie bis jetzt gehalten habe …
Langsam wandte ich meinen Kopf der Verkäuferin zu. »Das … das tut mir total leid!«
»Muss es nicht«, erwiderte sie leise, den Blick starr auf die beiden Kleidungsstücke gerichtet. Sie hob die Hand und strich fast zärtlich darüber.
Ich machte zögerlich einen Schritt auf sie zu, beinah überkam mich das Gefühl, sie trösten zu müssen. »Ich sollte …«, begann ich, doch sie hob energisch die Hand, sodass ich nicht weitersprach und sie stattdessen nur anstarrte.
»Sie sollten Speedy Gonzales nachlaufen, wenn Sie nicht wollen, dass das nächste Glas Ihren Kopf trifft. Schönen Tag noch.« Sie funkelte mich kurz an, griff sich die beiden Designerstücke und verschwand damit im Hinterzimmer.
Ich wusste nicht, was ich sagen oder tun sollte. Ich setzte zu einer weiteren Entschuldigung an, doch da pochte es plötzlich kräftig gegen das Schaufenster. Beatrice stand davor und stierte mich durch die Scheibe hinweg an. Ungeduldig wedelte sie mit der Hand, um mich dazu zu bringen, zu ihr nach draußen zu kommen.
»Dann gehe ich wohl«, gab ich resigniert von mir, aber ich erhielt keine Antwort von der Frau im Hinterzimmer. Also trat ich durch die Tür auf die Straße, bevor Beatrice auf die Idee kam, das Fensterglas zu ruinieren.
Sanft packte ich meine Freundin am Oberarm, um sie von dem Laden wegzuziehen. Ich brauchte keine Zuschauer, schon gar keine Zuschauerin mit wildem Haar und funkelnden Augen, die einem fiktiven Idealbild einer Frau ähnelte, das ich für einen Roman erfunden hatte.
»In diesen Laden gehen wir nie wieder«, rief Beatrice und riss sich von mir los.
Ich blieb stehen.
Sie ging ein paar Schritte, wendete sich mir jedoch noch einmal zu. »Was ist?« Beinah erinnerte mich ihr Tonfall an das Fauchen einer Katze. Einer wütenden Katze, der man nicht trauen konnte, weil sie einem die Augen auskratzen würde, wenn man nicht das tat, was ihr gerade in den Sinn gekommen war.
»Was war das da eben für ein Auftritt?«, fragte ich sie ruhig, obwohl es in meinem Innern brodelte. Wenn ich etwas nicht mochte, war es so ein Verhalten, das Beatrice an den Tag gelegt hatte. Was nichts damit zu tun hatte, dass die Verkäuferin meiner Protagonistin ähnlich gesehen hatte. Das war ein anderes Thema, das jedoch auch für eine gewisse Unruhe bei mir sorgte. Denn in diesem Moment wäre ich lieber in der kleinen Boutique gewesen als hier bei Beatrice. Das gab mir zu denken.
»Gar keiner«, flötete sie, kam auf mich zu, presste ihren Luxuskörper an mich und schlang die Arme um meinen Hals. »Aber wir können gern zu dir und dann gibt es einen ganz persönlichen, intimen Auftritt nur für dich allein.« Es fühlte sich an, als wäre sie die Schlange aus dem Paradies, die mich zu verführen versuchte. Doch im Gegensatz zu dem Adam aus der Bibel war mir klar, was sie im Schilde führte.
»Das sehe ich anders. Es war total daneben, wie du dich da drinnen benommen hast«, gab ich zurück und sah sie eindringlich an, während ich ihre Anspielungen auf einen Striptease geflissentlich ignorierte.
»Ach, sei doch nicht so. Das war gar nicht so gemeint.« Leicht legte sie den Kopf schräg, klimperte mit ihren Augen und fuhr mit ihrer Hand über meine Brust.
»Du warst extrem unhöflich. Um nicht zu sagen: unverschämt.« Ich blieb kalt. Ihre Annäherungs- und Beschwichtigungsversuche hatten keine Wirkung auf mich. Nicht mehr. Dafür war die Situation gerade eben zu ernüchternd gewesen.
»Ich bin eine Frau«, gab sie kühl zurück, ohne mich loszulassen, als wäre das die Erklärung und Entschuldigung für ihr schlechtes Benehmen.
Ihr Parfum drang mir in die Nase, eine Duftmischung mit Vanille und Früchten, die mich an letzte Nacht und zwei heiße Nächte davor erinnerte. Aber es machte mich nicht an. Nicht mehr. Ich brachte etwas Abstand zwischen Beatrice und mich. »Man behandelt Menschen nicht so. Du warst doch bisher nicht dermaßen anmaßend und herablassend zu anderen.«
Zumindest nicht in meiner Gegenwart.
Dieser Satz kam mir in den Sinn, begleitet von der Stimme meiner Schwester. In diesem Moment musste ich ihr recht geben. Beatrice war nicht die, die sie mir in den letzten Wochen vorgespielt hatte. Ich konnte mich sogar an den genauen Wortlaut von Charlys Rede erinnern:
»Das sind ein Haufen willenloser, charakterloser, aufgetakelter Tussen ohne Gewissen und ohne Wertvorstellungen, Adam! Immer der gleiche Typ Frau. Immer und immer und immer wieder. Und du wunderst dich, warum du nicht glücklich werden kannst!«
Ich versuchte, die Worte aus meinem Kopf zu bekommen, doch sie hatten sich festgesetzt. Bis jetzt war ich immer der Meinung gewesen, dass die Frauen, die ich datete, nicht alle gleich waren. Bei jeder hatte ich gedacht, sie sei anders. Beatrice hatte mir sogar erzählt, dass sie sich für kranke Kinder einsetzte, doch nun fragte ich mich, ob sie menschlich überhaupt dazu in der Lage war. Ob das alles nur zu der Show gehört hatte, mit der sie mich hatte ködern wollen.
Ich blickte Beatrice an und auf einmal sah ich sie in einem völlig anderen Licht. Ich sah sie mit den Augen meiner Schwester und plötzlich veränderte sich dadurch alles.
Sie war nicht mehr die umwerfend schöne Frau mit der goldblonden Haarmähne und dem Lächeln, das mich verzauberte.
Sie war jemand anderer. Jemand, den ich nicht leiden konnte. Jemand, mit dem ich nicht meine Zeit verschwenden wollte, weil sie oberflächlich und ein Biest war.
Kapitel 3
Tami
Ich wollte nicht theatralisch sein, aber wenn man Kleidung designte und zu einem großen Teil auch noch selbst herstellte – zumindest die Präsentationsstücke einer Kollektion – hing man an seinen Schätzen. Dementsprechend ging mir das Ganze nahe. Viel zu nahe. Mit zittrigen Fingern fuhr ich über die großen Flecken. Es waren ausgerechnet Stücke, die aus sehr anfälligen Stoffen genäht worden waren. Offenbar wusste diese Beatrice sehr genau, dass man aus ihnen kaum die Flecken richtig herausbekommen konnte.
Was tun, Tami? Heulen? Schreien? Irgendwo gegentreten?
»Oder die Blondine suchen und ihr das doofe Sektglas hinterherwerfen«, stieß ich wütend aus und hielt mir das erste Kleidungsstück vors Gesicht, um den Schaden noch besser begutachten zu können.
Es war ein kurzer Rock aus ockerfarbenem Tüll mit ein paar wenigen eingearbeiteten Pailletten. Handwäsche. Extrem heikel, was bestimmte Arten von Flecken angeht.
»Das hat diese blöde Kuh absichtlich gemacht.« Obwohl es deutlich zu sehen gewesen war, erleichterte es mich, dieses dumme Verhalten laut auszusprechen. Als wenn ich es damit nicht rückgängig machen konnte ... Nein, aber ich musste mir Luft verschaffen. Ich schüttelte den Kopf und griff nach dem zweiten Teil. Ein weißes, trägerloses Midikleid mit leicht ausgestelltem Saum und asymmetrischer Länge. Ausschließlich chemische Reinigung.
Die muss ich nun natürlich selbst bezahlen.
Ich hing den Rock und das Kleid zurück auf die dazugehörigen Kleiderbügel und verstaute sie auf einem Ständer hier im Lager. Danach steuerte ich den Kühlschrank an, nahm die angefangene Flasche Prosecco hervor und trank einen Schluck direkt aus der Flasche.
»Prost. Auf all die netten Kunden«, sagte ich in den leeren Raum hinein.
Ich merkte, dass ich immer noch total wütend war, und nahm wie automatisch mein Handy vom Tisch. Ein Klick auf die Schnellwahltaste genügte, um mich mit meiner besten Freundin Maria zu verbinden. In einem solch emotionalen Ausnahmezustand brauchte ein Mädchen eben seine beste Freundin und das, wenn nicht von Angesicht zu Angesicht möglich, über Facetime.
»Hey, Tami. So früh schon Drama?«, begrüßte sie mich und grinste mir von meinem Display entgegen.
»Ja. Kleiner Tipp: Mach dich nie selbstständig.« Ich verzog das Gesicht zu einer Grimasse.
»Sagt Luis auch immer«, antwortete sie lachend und ich konnte sehen, wie sie sich in einem Stuhl zurücklehnte und mich aufmunternd anlächelte. Ungeschminkt und mit einem Handtuch um den Kopf saß sie da und nippte an ihrer Kaffeetasse. In diesem Moment fiel mir ein, dass es ja erst kurz nach sieben bei Maria war.
»Wie läuft es mit der Liebe deines Lebens? Ist die Honeymoon-Phase schon vorbei?« Auch ich ließ mich auf den Stuhl am Tisch nieder und streckte die Beine aus.
»Du fragst das so, als ob du nur darauf wartest, dass die Sache mit mir und Luis auseinanderbricht.«
»Tue ich nicht.« Nicht wirklich. Doch ich vermisste sie ganz schrecklich.
»Du hast ein total falsches Bild von Männern.«
»Habe ich nicht.« Es war immer die gleiche Diskussion zwischen uns beiden.
»Okay, schön. Wir gehen nicht auf deine Probleme mit Männern ein, gut? Wir ignorieren den Vater, der dich früh verlassen hat und Jason, die Liebe deines Lebens, der dich ebenfalls verlassen hat und tun so, als ob das alles überhaupt kein Problem wäre und du total offen und optimistisch bist.« Kichernd zwinkerte sie mir zu.
Für einen Moment schloss ich die Augen, ehe ich antwortete: »Jason hat mich nicht verlassen, er musste beruflich nach Venezuela und hat … ähm … entschieden, nicht mehr zurückzukommen. Das ist total legitim.« Es war nicht so, dass ich grundsätzlich nicht an glückliche Beziehungen glaubte, aber oft sah die Realität anders aus, als uns Liebesromane und Liebesfilme glauben lassen wollten. Auch ich schmolz bei romantischen Szenen dahin. Und wenn ich ehrlich zu mir war – in ganz einsamen Stunden – musste ich zugeben, dass ich mir auch so etwas wünschte. Eine Beziehung, in der man sich vertrauen konnte. In der es keine Lügen und Heimlichkeiten gab. Aber wie oft hatten Menschen so etwas schon gefunden? Selten, sehr selten. Ich persönlich kannte niemanden. Und Jason hatte mittlerweile Frau und ein Kind. Wie abartig schnell er sich in seiner neuen Heimat eine neue Frau gesucht hatte, nagte noch immer an mir.
»Ist es.« Mit gehobenen Augenbrauen sah sie mich an, ohne irgendeine Emotion erkennen zu lassen.
»Und wieso reden wir überhaupt über mich? Ich wollte wissen, wie es bei dir läuft!« Noch einmal setzte ich die Proseccoflasche an und trank einen Schluck, was dazu führte, dass Maria laut lachte.
Als sie sich wieder gefangen hatte, erwiderte sie: »Super. Es läuft wirklich super. Luis ist toll. Wir verstehen uns blind. Vielleicht ist es, weil wir dieselben Wurzeln haben. Ich glaube, ich werde diesen Mann heiraten.«
»Die Vierzigerjahre rufen an und wollen Maria Rodriguez zurückhaben.« Ich prostete ihr zu und trank auch noch den letzten Schluck aus der Flasche und stellte sie daraufhin auf dem Tisch ab.
Maria lachte erneut laut auf. »Das ist überhaupt keine altmodische Einstellung, was redest du da?!«
»Wir leben in einer globalisierten und digitalisierten Welt. Es ist total illusorisch zu glauben, dass jemand dein Seelenverwandter ist, nur weil er ursprünglich mal aus demselben Land stammte wie deine Vor-vor-Vorfahren. Und selbst wenn es so wäre, musst du ihn ja nicht gleich heiraten.«
»Meine Vor-vorfahren, bitteschön.«
»Ich mache mir einfach Sorgen, Maria. Du stürzt dich immer Hals über Kopf in diese Beziehungen. Luis ist nicht der erste Mann, von dem du behauptest, er sei die Liebe deines Lebens.«
»Aber diesmal ist es echt.« Sie zog einen Schmollmund und ich merkte, dass ich sie mit meinen Worten verletzt hatte.
»Das hoffe ich, immerhin bist du ans andere Ende des Kontinents gezogen und hast mich hier alleine gelassen.« Ich schenkte ihr ein entschuldigendes Lächeln.
»Ha!«, stieß sie hervor und blickte mich triumphierend an.
Ich zuckte zusammen und schaute irritiert auf das Display. »Was? Ha?«
»Da haben wir sie wieder. Die Verlustangst. Du wirst nie einen tollen Mann finden, wenn du ständig Angst hast, jemanden zu verlieren und deshalb so abweisend bist.«
»Ich habe überhaupt keine Angst.« Fest biss ich die Zähne aufeinander, weil ich wusste, dass sie recht hatte.
»Ich sagte abweisend und ängstlich.«
»Ich bin überhaupt nicht abweisend«, gab ich pampig zurück, musste dabei aber grinsen.
Die Wahrheit war, dass ich seit Jason noch nicht einmal oberflächliche Beziehungen einging. Er war der einzige Mann gewesen, auf den ich mich je ernsthaft eingelassen hatte. Und als er nach Venezuela gezogen war, ohne auch nur eine Sekunde lang zu überlegen oder mich zu fragen, was ich davon hielt, war dieses ganze Thema für mich erledigt gewesen. Beziehungen funktionierten nicht, Punkt. Sie funktionierten nie. Die Scheidungsrate betrug in einigen Staaten in Amerika über 50 Prozent und ich hätte meinen Laden darauf verwettet, dass sie hier in New York noch um einiges höher war.
»Ich bin sicher, wenn du eine etwas offenere und freundlichere Einstellung an den Tag legen würdest, könntest du dir einen tollen Mann angeln«, erklärte Maria weiter.
»Okay, erstens: Ich will mir keinen tollen Mann angeln. Ich komme gut alleine zurecht. Danke. Meine Mutter hat nie einen Mann gebraucht und ich brauche ebenfalls keinen.« Ein Hickser löste sich aus meiner Kehle dank des Proseccos.
»Schön. Gut. Dann sei eben wie deine Mom.« Maria verdrehte gespielt die Augen.