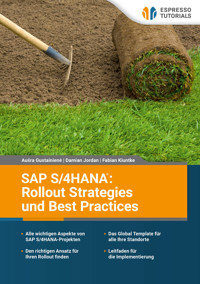
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Espresso Tutorials
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Einführung von SAP S/4HANA in einem globalen Unternehmen mit weltweiten Standorten erfordert ein strategisches Vorgehen, damit sie den angestrebten geschäftlichen Erfolg erzielt. In diesem Buch geben Ihnen die drei Autoren, die eine große Expertise mit internationalen ERPProgrammen haben, einen Leitfaden an die Hand, um eine solche Einführung erfolgreich zu meistern.
Sie erfahren, wie Sie mithilfe eines Target Operating Model (TOM) Ziele definieren, wie Sie ein »Global Template« für den Rollout an verschiedenen Standorten entwickeln und mit welchen Organisationsstrukturen Sie erfolgreich operieren. Die Frage der Harmonisierung und Standardisierung von Vorgängen an den einzelnen Standorten kommt zur Sprache, und ebenso, wie mit notwendigen Abweichungen umzugehen ist. Der (Erfolgs-)Faktor Mensch wird näher betrachtet, sowohl in seiner Rolle als Betroffener wie auch als Betreiber und Förderer der eingeführten Veränderungen. Sie erfahren, wie Sie mit den betroffenen Personen kommunizieren und diese im Rahmen eines Organizational Change Management »mitnehmen«. Abschließend werfen Sie noch einen Blick auf die Go-live- und Hypercare-Phase sowie den Übergang zum Support im laufenden Betrieb.
Am Ende haben Sie einen Werkzeugkasten zur Hand, mit dem Sie Ihr SAPProjekt zu einem erfolgreichen Abschluss führen!
- Alle wichtigen Aspekte von SAP S/4HANA-Projekten
- Den richtigen Ansatz für Ihren Rollout finden
- Das Global Template für alle Ihre Standorte
- Leitfaden für die Implementierung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
SAP S/4HANA®: Rollout Strategies und Best Practices
Aušra GustainienėDamian JordanFabian Kiuntke
Aušra Gustainienė, Damian Jordan, Fabian KiuntkeSAP S/4HANA® : Rollout Strategies und Best Practices
ISBN:978-3-960124-77-1
Lektorat:Bernhard Edlmann
Korrektorat:Sarah Trenca, Johann-Christian Hanke
Coverdesign:Philip Esch, Olesia Donchenko
Coverfoto:istockphoto.com | erikreis No.475405544
Satz & Layout:Johann-Christian Hanke
Alle Rechte vorbehalten
1. Aufl. 2025
© Espresso Tutorials GmbH, Gleichen 2025
URL:www.espresso-tutorials.de
Das vorliegende Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Übersetzung, des Vortrags, der Reproduktion und der Vervielfältigung. Espresso Tutorials GmbH, Bahnhofstr. 2, 37130 Gleichen, Deutschland.
Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text und Abbildungen verwendet wurde, können weder der Verlag noch Autoren oder Herausgeber für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwortung oder Haftung übernehmen.
Feedback:Wir freuen uns über Fragen und Anmerkungen jeglicher Art. Bitte senden Sie diese an: [email protected].
Inhaltsverzeichnis
Willkommen bei Espresso Tutorials!
Unser Ziel ist es, SAP-Wissen wie einen Espresso zu servieren: Auf das Wesentliche verdichtete Informationen anstelle langatmiger Kompendien – für ein effektives Lernen an konkreten Fallbeispielen. Viele unserer Bücher enthalten zusätzlich Videos, mit denen Sie Schritt für Schritt die vermittelten Inhalte nachvollziehen können. Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal mit einer umfangreichen Auswahl frei zugänglicher Videos: https://www.youtube.com/user/EspressoTutorials.
Kennen Sie schon unser Forum? Hier erhalten Sie stets aktuelle Informationen zu Entwicklungen der SAP-Software, Hilfe zu Ihren Fragen und die Gelegenheit, mit anderen Anwendern zu diskutieren: https://forum.espresso-tutorials.com/.
Eine Auswahl weiterer Bücher von Espresso Tutorials:
Andreas Schuster:
Praxishandbuch SAP
®
HANA – Administration
Martin Kipka:
SAP
®
Activate – Agilität in SAP
®
-Implementierungsprojekten
Manfred Sprenger:
Praxishandbuch SAP
®
-Basis – Troubleshooting in der Systemadministration
Cihan Kaya:
Datenarchivierung in SAP
®
Cihan Kaya
Praxishandbuch DSGVO und Retention Management mit SAP
®
ILM
Manfred Sprenger
Schnelleinstieg in SAP Fiori
®
Vorwort
Enterprise Resource Planning (ERP-)Systeme sind heute für die Verwaltung von Hunderttausenden von Unternehmen aller Größen und Branchen weltweit von entscheidender Bedeutung. ERP integriert die Funktionen eines Unternehmens in einer einzigen Lösung und ermöglicht so die Rationalisierung von Prozessen und Informationen innerhalb einer Organisation. Für Unternehmen, die über ERP verfügen, sind die Systeme eine »Single Source of Truth« und so wichtig wie der elektrische Strom, der alles am Laufen hält.
Wenn Sie für ein großes Unternehmen arbeiten, werden Sie höchstwahrscheinlich feststellen, dass es SAP einsetzt oder ein SAP-Produkt implementiert, denn SAP hat den größten ERP-Marktanteil [1]. Mehr als 300.000 Kunden in über 150 Ländern nutzen einige oder alle SAP-Module, und jedes Jahr werden Hunderte neue Implementierungsprojekte durchgeführt, um die Abläufe in Unternehmen zu verbessern.
ERP-Programme sind komplex, und für ihren erfolgreichen Einsatz müssen verschiedene Bausteine richtig eingesetzt werden, wie z. B.:
Die Verantwortlichen im Unternehmen müssen verstehen, warum Sie ein ERP-Programm brauchen
Klar definierte Ziele und Vorgaben
Unterstützung der Zielsetzungen und Ziele durch den richtigen Deployment-Approach
Schaffung eines geeigneten Rahmens (Mitarbeiter und Verfahren) für die Verwaltung und Steuerung des Rollouts, um sicherzustellen, dass die Ziele während des gesamten Programms eingehalten werden
Aufbau, Umsetzung und Anwendung des Programms
Einführung neuer Arbeitsmethoden, um den Wandel zu bewältigen und die Ziele zu erreichen
Der Übergang zu Business As Usual (BAU) und effizientes Arbeiten in der »neuen Normalität«
Dieses Buch befasst sich mit allen Aspekten großer ERP-Programme, einschließlich der für die Erreichung der Ziele erforderlichen geschäftlichen Umgestaltung. Die Umgestaltung des Unternehmens umfasst die notwendige Abstimmung zwischen Unternehmen und IT-Abteilung, um das Gesamtbild zu erkennen, über die verschiedenen Praktiken, Frameworks und Methoden hinweg zusammenzuarbeiten und das Programm gemeinsam umzusetzen. Solange Sie wissen, was Sie wollen, wird der Aufbau des Templates zum einfachen Teil! (Wir drücken Ihnen die Daumen!)
Warum wir dieses Buch geschrieben haben
Mit dem Aufkommen von SAP S/4HANA stehen Unternehmen, die in den 90er Jahren stark in SAP R/3 investiert und/oder in den späten 00er Jahren SAP ECC 6.0 neu implementiert haben, nun vor einer möglichen Neuimplementierung ihrer ERP-Landschaften.
Es gibt nur sehr wenige SAP-Programme, bei denen alle Zutaten für eine reibungslose Einführung stimmen. In den Medien hört man häufiger von den Misserfolgen bei großen ERP-Programmen als von den erfolgreichen Programmen, denn wer will schon über einen Erfolg lesen?
SAP S/4HANA ist zwar eine neue, exzellente Technologie, aber die meisten Implementierungsprinzipien der R/3- und ECC 6.0-Programme sind heute immer noch genauso relevant wie vor 20 Jahren – wenn nicht sogar mehr denn je. In 20 Jahren geht aber mithin viel Wissen verloren, und die Gefahr ist groß, dass sich Fehler aus der Vergangenheit wiederholen – schon alleine deswegen, weil sich seitdem die Belegschaft verändert hat.
Die meisten Bücher zur SAP-Implementierung konzentrieren sich auf ein einzelnes Projekt (Migration zu SAP S/4HANA, Greenfield-Implementierung), bieten Anleitungen zum Projektmanagement oder erläutern die SAP-Activate-Methodik.
Wir wollten einen End-to-End-Leitfaden (E2E) für Unternehmen verfassen, die SAP als ein Kernsystem über mehrere Standorte hinweg einführen möchten. Hierbei teilen wir unsere Erfahrungen mit Ihnen und erklären Ihnen, was unserer Meinung nach funktioniert und was nicht. So können wir Ihnen einige wertvolle Tipps mit auf Ihren Weg geben.
Für wen dieses Buch bestimmt ist
Wir gehen davon aus, dass Sie dieses Buch zur Hand genommen haben, weil Sie auf irgendeiner Ebene an einem ERP-Programm beteiligt sind. Dieses Buch richtet sich primär an betriebswirtschaftliche und technische Programm- und Projektmanager. Zudem wird jeder, der an einem Projekt teilnimmt oder bereits Mitglied eines Implementierungsteams ist, davon profitieren, wenn er das Gesamtbild sieht und dessen einzelne Aspekte versteht, so z.B. die Fragen: Welche Entscheidungen sind zu treffen, welche Dinge sind zu erbringen und welche Änderungen sind zu bewältigen?
Dieses Buch soll Ihnen und Ihrem Team dabei helfen, sich auf die komplexe, aber auch spannende Reise der SAP-Einführung vorzubereiten und durch diese sicher hindurchzunavigieren! Wir haben uns zusammengetan, um unsere kollektive Erfahrung (zusammen über 60 Jahre) zu teilen, die wir in einer Reihe von großen SAP-Implementierungen in sehr unterschiedlichen Branchen und in verschiedenen Rollen (siehe unsere Biografien) gesammelt haben. Wir haben für die unterschiedlichsten Parteien (Big4-Beratungsunternehmen, Systemintegratoren, Kunden, IT-Organisationen, SAP und Kompetenzzentren) gearbeitet. Hierbei haben wir von den besten bis hin zu den schlechtesten Szenarien alles erlebt und konnten die Aus- und Nachwirkungen gelungener wie auch völlig misslungener SAP-Programme in allen Facetten miterleben.
Aufbau dieses Buches
Dieses Buch beginnt damit, dass wir Ihnen in Kapitel 1 die wichtigste Frage stellen, nämlich die nach dem Warum. Dabei sehen wir es als essenziell an, schon am Anfang das Ende im Blick zu haben. Bevor wir uns also mit den Einzelheiten einer Implementierung befassen, möchten wir sicherstellen, dass Sie und Ihr Unternehmen verstehen und definieren können, warum Sie sich für diese groß angelegte Unternehmensumstellung entschieden haben. Wir geben Ihnen einige Hinweise, wie Sie diese Frage beantworten, und stellen Ihnen Schlüsselkonzepte vor, die unseren Empfehlungen zugrunde liegen.
In Kapitel 2 gehen wir auf die verschiedenen Einführungsstrategien ein und geben Ratschläge für die Wahl des richtigen Ansatzes, der richtigen Strategie.
Dann tauchen wir tief in den am häufigsten verwendeten Ansatz ein, das »Global Template«. Hier erfahren Sie, wie man ein Global Template erstellt, wie man ein Lokalisierungs- und ein Rollout-Projekt verwaltet und was die wichtigsten Unterschiede zwischen diesen genannten Aktivitäten sind.
Aufgrund unserer Erfahrungen aus über einem Dutzend Systemimplementierungen glauben wir, dass die Festlegung der Leitprinzipien für ein globales Programm einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren ist. In Kapitel 3 werden wir erörtern, wie SAP Best Practices genutzt, wie Prozesse strukturiert, harmonisiert und standardisiert werden können und wie Ihr Projekt und Unternehmen von der Einhaltung von Standards profitieren kann.
In Kapitel 4 geben wir Ratschläge dazu, wie die Global Template Governance Organization aussehen sollte. Diese betrachten wir sowohl von der Geschäfts- als auch von der IT-Seite, wir zeigen auf, wie die richtige Programm-Governance einzurichten und die richtige Implementierungsmethodik zu wählen ist.
Wie oft im Leben haben Sie die Notwendigkeit einer Veränderung gesehen, die dann jedoch nie stattfand? ERP-Implementierungen sind kostenintensiv und beruhen oft auf komplexen, gut etablierten Geschäftsszenarien. Wenn aber keine echte Veränderung stattfindet, verfehlt sie ihren Zweck, und das ist für alle Beteiligten eine Verschwendung von Zeit und Geld. Deshalb tauchen wir in Kapitel 5 tief in die Strategie des organisatorischen Change Managements ein – ein Thema, das in Büchern zum SAP-Projektmanagement normalerweise ausgelassen wird. Selbst die SAP Activate-Methodik geht nur am Rande auf das organisatorische Change Management ein.
Die Implementierung einer standardisierten und harmonisierten ERP-Lösung ist in der Regel ein bedeutender geschäftlicher Umbruch, der ohne den richtigen Fokus und die Aufmerksamkeit für die Aspekte der organisatorischen Veränderungen nicht erfolgreich sein kann.
Kapitel 6 konzentriert sich auf den Implementierungsansatz. Es beschäftigt sich mit den Programm- und Organisationsstrukturen, den nötigen Projektorganisationsstrukturen, Aktivitäten, Leistungen und den Verantwortlichkeiten in jeder Projektphase. Sie lernen die Unterschiede zwischen dem Global Template und dem lokalen Rollout-Projekt anhand von Beispielen kennen und erhalten Tipps für jede Phase.
Ein Projekt ist noch nicht zu Ende, wenn die Lösung in Betrieb ist. Vielmehr wird die Organisation Unterstützung benötigen, falls etwas schieflaufen sollte. Das erreicht man durch eine Hypercare-Phase von einigen Wochen. Darüber hinaus werden sich Organisationen weiterentwickeln, sich verändern und neue Funktionen benötigen. Das Template muss an diese veränderten Anforderungen angepasst werden. In Kapitel 7 gehen wir auf die kontinuierliche Veränderung ein, die ein Global Template für die IT-Support- und Betriebsfunktionen mit sich bringt. Sie erfahren, wie Sie Änderungen an einem Global Template verwalten und wie dabei Endbenutzer und Unternehmen das richtige Maß an Aufmerksamkeit erhalten.
Danksagung
Ich möchte einen besonderen Dank an Gary Davies, Global Program Lead, richten, der mich in die Welt der globalen SAP-Implementierungen eingeführt hat, denn ohne ihn wäre dieses Buch nicht möglich gewesen. Mein Dank gilt auch ehemaligen SABMiller-Kollegen und erfahrenen Managern (Lee Miller, Paul Capp, Steve Higgs, Itrat Taqvi, George Murgatroyd, Don Elliot und vielen anderen großartigen Teammitgliedern) für die Weitergabe ihrer Erfahrungen, ihres Wissens und ihres Mentorings bei der Leitung globaler Template-Implementierungen. Außerdem danke ich Hayley Wood, PMO-Direktorin, für die Weitergabe ihrer Erfahrungen bei der Definition von Program Governance und der Einrichtung der richtigen Organisationsstrukturen; Saurav Mukherjee, Digital IT Services Head, für hilfreiche Inputs im Bereich Global Service Delivery Management und Björn Braemer, SAP Senior Program Manager, für seine Ermutigung und seinen festen Glauben an mich, der aus dem Traum ein Ziel und schließlich ein Buch entstehen ließ.
Aušra Gustainienė
Ich möchte mich besonders bei den folgenden Personen bedanken: Ken Agena, ein wahrer Verfechter von SAP, der Unternehmen leidenschaftlich dabei hilft, den Wert von ERP zu verstehen und der mir im Laufe meiner Karriere zahlreiche Gelegenheiten geboten hat; Chris Palmer, eine unglaubliche Führungspersönlichkeit, Manager und Freund (wie alle hier Anerkannten), der mir beigebracht hat, wie man eine große ERP-Implementierung leitet; April Zanelli, die mir gezeigt hat, wie exzellentes Change Leadership aussieht und wie wichtig es ist, die Menschen an Bord zu holen; Austin McEvoy, der eine brillante Führungspersönlichkeit ist, ein wahrer Verfechter von Change Leadership, und der mir gezeigt hat, wie man den Menschen hilft zu verstehen, was Change Leadership ist; Deborah Williams, eine der besten Kommunikationsmanagerinnen, die es gibt, die mir so viel beigebracht hat und die die Geduld einer Heiligen hat, wenn es darum geht, mein schriftliches Englisch zu verbessern; Chantell Coetzee, die nicht nur eine erstklassige Change Leaderin ist, sondern auch eine Person mit erstaunlichen Fähigkeiten und einer Leidenschaft für die Förderung von Business Engagement; Deirdre Smith für ihr Coaching bei der Entwicklung von Change-Leadership-Produkten und ihre ständige Ermutigung, das Buch zu schreiben; Eric Plunkett, der den besten SAP-Schulungsansatz und die besten Produkte auf dem Markt hat; und nicht zuletzt Steve Hitchcock-Smith für die frühmorgendlichen Radtouren, die Ratschläge und die Anleitung. Ich danke Ihnen allen für Ihre Hilfe, Freundschaft und Unterstützung.
Damian Jordan
Ich möchte mich besonders bei den folgenden Personen bedanken: Steffen Butschbacher, der mich in die Technik und somit in die Welt von SAP eingeführt hat, Kim Mathäß, der eine unglaubliche Führungspersönlichkeit darstellt und der mir gezeigt hat, wie People Management aussieht; Ralf Schlachter, Frank Bröhan und Thomas Weinerth, drei brillante Köpfe, bei denen die Gemeinschaft, also das Team immer Vorrang hat und die mich durch ihr Handeln immer wieder daran erinnern; Manuel Zeise und Stefan Kreil für die vielen Treffen und die zahlreiche Hilfe in meiner Karriere. Auch möchte ich mich bei meinen Eltern Tabea & Martin sowie meiner Frau Sabine und dem noch kleinen Paul für ihre Unterstützung und Hilfe bedanken
Fabian Kiuntke
Ebenso möchten wir uns bei allen anderen Kollegen, Freunden und SAP-Beratern für die hilfreichen Anregungen und konstruktiven Diskussionen bedanken, die uns geholfen haben, die Qualität dieses Buches zu verbessern. Und nicht zuletzt bei unseren Familien, die Verständnis für unsere Arbeit am Wochenende und die Abende am Computer haben.
Im Text verwenden wir Kästen, um wichtige Informationen besonders hervorzuheben. Jeder Kasten ist zusätzlich mit einem Piktogramm versehen, das diesen genauer klassifiziert:
Hinweis
Hinweise bieten praktische Tipps zum Umgang mit dem jeweiligen Thema.
Beispiel
Beispiele dienen dazu, ein Thema besser zu illustrieren.
Achtung
Warnungen weisen auf mögliche Fehlerquellen oder Stolpersteine im Zusammenhang mit einem Thema hin.
Übungsaufgabe
Übungsaufgaben helfen Ihnen, Ihr Wissen zu festigen und zu vertiefen.
Die Form der Anrede
Um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, verwenden wir im vorliegenden Buch bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen zwar nur die gewohnte männliche Sprachform, meinen aber gleichermaßen Personen weiblichen und diversen Geschlechts.
Hinweis zum Urheberrecht
Zum Abschluss des Vorwortes noch ein Hinweis zum Urheberrecht: Sämtliche in diesem Buch abgedruckten Screenshots unterliegen dem Copyright der SAP SE. Alle Rechte an den Screenshots hält die SAP SE. Der Einfachheit halber haben wir im Rest des Buches darauf verzichtet, dies unter jedem Screenshot gesondert auszuweisen.
1 Die Frage nach dem Warum
Wenn Sie in irgendeiner Rolle an einem ERP-Programm beteiligt sind, sollten Sie in der Lage sein, folgende Frage zu beantworten: »Warum nehmen wir das in Angriff?« Als Erstes brauchen Sie eine klare Vision und Mission, Sie müssen Leitprinzipien definieren und diese mit allen wichtigen Interessengruppen abstimmen. In diesem Abschnitt finden Sie einige Schlüsselkonzepte und Hinweise zur Beantwortung der so wichtigen Frage nach dem Warum.
1.1 Die Gründe verstehen
Die Frage nach dem Warum ist die erste und wichtigste Frage, die man sich stellen muss, wenn man an einem ERP-Programm teilnimmt – ganz gleich in welchem Stadium der Entwicklung es sich befindet oder welche Rolle man dabei innehat. Bei unseren eigenen Programmen hat sie uns geholfen, die Ursache für viele Probleme zu finden. Daher ist sie aus unserer Sicht die wichtigste Frage, die es zu stellen gibt.
Leider vergessen die Menschen allzu oft, warum sie ein ERP-Programm einführen. Das Problem, kein klares Warum zu haben, kann sich in den folgenden Symptomen äußern (diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit):
Es ist nicht möglich, die wichtigsten Interessengruppen für das Programm zu gewinnen, da sie dessen Bedeutung nicht erkennen.
Den Mitgliedern des ERP-Programmteams mangelt es an Motivation, weil sie den Zweck des Programms oder dessen Vorteile nicht verstehen.
Die erstellte oder sogar implementierte Lösung entspricht nicht den betrieblichen Anforderungen.
Unklare Prioritäten innerhalb des Programms führen zu einer großen Zahl an unkoordinierten Aktivitäten, sodass am Ende kein zählbares Ergebnis herauskommt.
Die Vorteile des Programms kommen nicht zum Tragen, weil sie nicht richtig verstanden werden.
Es ist schwierig, zusätzliche Mittel für Änderungen des Programmumfangs zu erhalten, bzw. es werden Kürzungen vorgenommen, die die Qualität des Programms stark beeinträchtigen.
Wie können Sie diese Probleme angehen?
1.2 Die Notwendigkeit der Veränderung erkennen
Es ist von enormer Bedeutung, den Bedarf an Veränderungen zu definieren. Es geht darum, eine Vorstellung zu entwickeln und mit den Verantwortlichen zu vereinbaren, was die Organisation in Zukunft tun und was sie lassen soll. In diesem Zusammenhang sind zahlreiche interne wie externe Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören auch die Abbildung von rechtlichen Anforderungen, die Umsetzung neuer Technologien sowie die Notwendigkeit, neue Arbeitsweisen einzuführen. Es geht darum, die Elemente zu erfassen, die das Unternehmen voranbringen, und sie mit den Zielen in Einklang zu bringen.
Es geht darum, betriebswirtschaftlich relevante Ergebnisse zu erreichen – und hier liegt der Schlüssel zur Vermeidung einer der häufigsten Fallen, in die Sie tappen können: ein rein technologiegeleitetes Programm, das nicht auf die geschäftlichen Anforderungen abgestimmt ist.
Die Treiber der Veränderung identifizieren
Nehmen Sie sich für jedes SAP ERP-Programm einen Moment Zeit, um die folgenden Fragen zu beantworten:
Welche externen Faktoren treiben den Veränderungsbedarf an, auf den das ERP-Programm die Antwort ist (z.B. gesetzliche Anforderungen, Veränderungen in der Branche, neue Arbeitsweisen, Herausforderungen des Marktes, die Notwendigkeit, schneller zu reagieren, Aktivitäten der Wettbewerber, Kundenbedürfnisse, Anforderungen der Lieferanten, technologische Veränderungen)?Welche internen Faktoren begründen den Bedarf an Veränderungen (z.B. Standardisierung und Harmonisierung im Unternehmen, schwieriges Verständnis der Geschäftsleistung und des Betriebs auf Unternehmensebene, reibungslosere End-to-End-Geschäftsabläufe, Optimierung der Betriebskosten)?Welche weiteren Faktoren sprechen für die Notwendigkeit von Veränderungen?1.3 Definition eines Target Operating Models (TOM)
Die Notwendigkeit von Veränderungen wurde nun klar erkannt. Als Nächstes müssen Sie sich die Frage stellen: Wie soll die Organisation aussehen, wenn das Programm abgeschlossen ist?
Für diesen Schritt gibt es viele Bezeichnungen und Konzepte, z.B. »Target Operating Model« (TOM), »Strategieplan«, »Ziel-Zustand« oder »Soll-Zustand«. Sie ermöglichen letztendlich eine neue Arbeitsweise in einer globalen Struktur mit gemeinsamen Ressourcen, integrierten Prozessen und Daten.
Für die Zwecke dieses Buches verwenden wir das Target Operating Model (TOM). Die einzelnen Komponenten eines TOMs werden in den nachfolgenden Abschnitten behandelt.
1.3.1 Die drei Bereiche, die ein TOM abdecken muss
Ein Target Operating Model (TOM) ist eine Beschreibung des gewünschten Ziel-Zustands des Geschäftsmodells einer Organisation.
Ein solides TOM befasst sich mit den in Abbildung 1.1 dargestellten drei Hauptbereichen:
Abbildung 1.1: Hauptbereiche eines TOM
(Geschäfts-)Prozesse
: Wie organisieren Sie die Arbeit in Ihrem Unternehmen am besten? Müssen Sie Prozesse rationalisieren, neue Verfahren und Prozesse einführen, um einen Schwachpunkt auszumerzen, oder Prozesse zentralisieren oder dezentralisieren? Erstellen Sie einen Plan der zukünftigen Geschäftsprozesse, der klar beschreibt, wie diese in Zukunft funktionieren werden. Dies wird ein Schlüsseldokument in den späteren Phasen des Programms, die so genannte Business Process Master List (BPML).
Menschen
: Wie organisieren Sie Ihre Teams am besten, um das künftige Zielbetriebsmodell (die oben genannten Prozesse) zu unterstützen? Dabei müssen Sie Organisationsstrukturen, Kontrollbereiche, die erwarteten Verhaltensweisen, Unternehmenskultur und Fähigkeiten berücksichtigen. Das wichtigste Ergebnis dieser Überlegungen ist ein zukünftiges Organizational Model, das beschreibt, wie die Organisation auf globaler, regionaler und lokaler Ebene strukturiert ist.
Technologie
: Was sind die besten Werkzeuge (Systeme), um Ihr Unternehmen (Prozesse) mit Ihrer Organisation (Menschen) zu betreiben? Was können Sie automatisieren (und damit wertvolle Humanressourcen für wertschöpfende Aufgaben freisetzen), vereinfachen oder beschleunigen, um Ihr Unternehmen mit Ihrer Organisation effizient zu führen? Das wichtigste Ergebnis ist eine prinzipienbasierte System Roadmap, die detailliert aufzeigt, welche Prozesse und Aktivitäten in jedem System durchgeführt werden sollten.
Definieren Sie ein Target Operating Model (TOM)
Wenn Sie ein vordefiniertes TOM haben, sollten Sie die darin festgelegten Ziele nach dem genannten Schema – Prozesse, Menschen und Technologie – aufteilen.
Wenn Sie noch kein TOM haben, ist es jetzt an der Zeit, ein solches zu definieren. Sie brauchen einen Plan, wie die Organisation in Zukunft arbeiten soll, um die anstehenden Herausforderungen des Unternehmens zu bewältigen. Wenn Sie jetzt noch keine klare Vorstellung davon haben, wo Sie am Ende landen wollen, besteht das Risiko des Scheiterns.
1.3.2 Harmonisierung voranbringen und lokale Besonderheiten herausarbeiten
Bei der Definition des TOM sollten Sie sich darüber im Klaren sein, welche Teile allgemeingültig sein sollen, um bewährte Verfahren und Harmonisierung zu fördern, und was an verschiedenen Standorten den lokalen Marktbedingungen angepasst werden kann.
Hier müssen klare Leitplanken für die Prozesse definiert werden, die implementiert werden sollen, um die Umwandlung voranzutreiben. Es muss aber auch klargestellt werden, welche Prozesse je nach Marktbedingungen geändert werden können, damit die Unternehmensteile wendig und flexibel bleiben und sich auf ihren jeweiligen Märkten Wettbewerbsvorteile verschaffen können. Dies wird später bei der Festlegung der globalen und lokalen Templates für das Programm von entscheidender Bedeutung sein.
Identifizierung von global und lokal im TOM
Überprüfen Sie Ihr TOM und kategorisieren Sie wie folgt:
Wo gibt es global definierte Prozesse und harmonisierende Prozesse, die für die unternehmensweite Umsetzung von Best Practices sorgen?Was sollte an die lokalen Marktbedingungen angepasst werden? Wurden Optionen für die Lokalisierung definiert, anstatt unterschiedliche Prozesse für jeden Standort zuzulassen?1.3.3 Vereinfachung der IT-Landschaft
Ein weiterer Aspekt von TOM ist die genutzte Technologie. Während der Arbeit an der Definition eines Soll-Zustands ist der richtige Zeitpunkt, um über eine Vereinfachung der IT-Landschaft nachzudenken. Wie in jeder großen Organisation mit mehreren Standorten in verschiedenen Ländern kann in der Vergangenheit eine komplexe Systemlandschaft entstanden sein – die es zu reduzieren gilt. Die Gründe hierfür können vielfältig sein:
Fusionen und Übernahmen
Einzelne geografische Gebiete oder Abteilungen arbeiten als separate Unternehmen ohne eine übergreifende IT-Strategie
In den verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Geschäftsprozesse
Verschiedene Machtzentren innerhalb des Unternehmens
Vertrautheit mit lokal beschafften ERP-Systemen
ERP-Systeme, die aufgrund von Budget- oder Zeitbeschränkungen lokal implementiert werden
Bevorzugung von ERP-Systemen in der Landessprache
Lokale Teamkontrolle über die ERP-Systeme, um flexibler und schneller Änderungen vorzunehmen
1.3.4 TOM-Reifegradmodell
Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Genauso wenig wie eine hochleistungsfähige Organisation. Daher müssen Sie Phasen planen, in denen Sie die Ziele Ihrer Organisation erreichen. Es gibt hierzu viele verschiedene Reifegradmodelle, mit denen Sie dies bewerkstelligen. Das im Folgenden vorgestellte bietet einen guten Ausgangspunkt:
Einen guten Start hinlegen
– sicherstellen, dass die Grundlagen stimmen und eine solide Basis geschaffen wird, die skalierbar ist, um die Unternehmensvision zu unterstützen
Besser werden
– das Geschäftsmodell Schritt für Schritt verbessern
Klassenbester werden
– Innovation vorantreiben hinsichtlich der Art und Weise, wie Sie Ihr Unternehmen betreiben
Dieses Modell ist simpel, aber effektiv. Es können je nach Bedarf auch komplexere TOM gewählt werden.
Wichtig zu wissen: Die Implementierung des TOM kann auch einem anderen Zeitplan folgen als eine SAP S/4HANA-Implementierung. Es kann sein, dass die SAP S/4HANA-Einführung der Enabler für das TOM ist, aber auch, dass bestimmte Aspekte unabhängig von der SAP S/4HANA-Implementierung umgesetzt werden können.
Reifegrad beurteilen





























