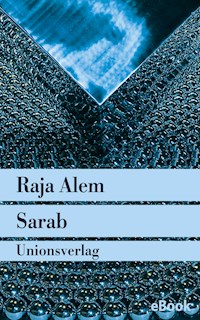
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
An einem Morgen des Jahres 1979 hält die Welt den Atem an. Ein Trupp von terroristischen Fanatikern besetzt die Große Moschee in Mekka und nimmt Tausende von Gläubigen als Geiseln. Unter den Aufständischen, in Männerkleidern versteckt, ist das Mädchen Sarab. Als der Gegenangriff beginnt und es Fallschirmjäger vom Himmel regnet, flieht sie in die Katakomben und stößt auf einen bewusstlosen französischen Soldaten. Durch einen Abwasserkanal schleppt sie ihn ins Freie und versteckt sich mit ihm in einer leeren Wohnung. Zwischen den beiden, die sich zunächst bis aufs Blut hassen, beginnt eine Geschichte, die in Mekka, dann in Paris, alle Grenzen überschreitet. Raja Alem lässt eine Liebe zwischen zwei Menschen entstehen, die auf beklemmende Weise unauflöslich wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
An einem Morgen des Jahres 1979 überfallen Fanatiker die Moschee in Mekka und nehmen Tausende als Geiseln. Unter den Aufständischen, in Männerkleidern versteckt, ist das Mädchen Sarab. Auf der Flucht durch die Katakomben stößt sie auf einen bewusstlosen französischen Soldaten. Es beginnt eine Geschichte, die alle Grenzen überschreitet.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Raja Alem (*1970) studierte Anglistik in Dschidda, Saudi-Arabien. Für den Roman Das Halsband der Tauben erhielt sie den renommierten International Prize for Arabic Fiction.
Zur Webseite von Raja Alem.
Hartmut Fähndrich (*1944) ist seit 1978 Lehrbeauftragter für Arabisch und Islamwissenschaften an der ETH Zürich. Neben seiner Übersetzertätigkeit arbeitet er auch als Herausgeber und Publizist.
Zur Webseite von Hartmut Fähndrich.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Raja Alem
Sarab
Roman
Aus dem Arabischen von Hartmut Fähndrich
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Übersetzung dieses Werks wurde unterstützt durch die UBS Kulturstiftung.
Die deutsche Fassung wurde aus dem Manuskript übersetzt.
Originaltitel: Sarab
© by Raja Alem 2018
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Ausschnitt der Installation von Shadia Alem The Black Arch, Biennale di Venezia 2011 (Foto Shadia Alem)
Umschlaggestaltung: Peter Löffelholz
ISBN 978-3-293-30963-0
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 18.05.2024, 04:09h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
SARAB
Erster TagZweiter TagDritter TagVierter TagFünfter TagNach MedinaDer ErlöserDer KriegZwanzigster NovemberScharfschützenHerabschwebende Satane, verschwindende EngelDes Todes letzter AbschnittWenn Gespenster betenDer CountdownStahlwolkenAuftrag Nr. 3016Wärst du doch tot!Unsichtbare GespensterTomatenrotEnde Nummer einsEnde Nummer zweiDas TodesarchivUnterirdische WeltenVorwiegend sonnigStürmischTeilweise wolkigEnde Nummer dreiEnde Nummer vier: 21. Juni 1980AdenDer Umzug einer grünen SchildkröteEin schwarzer HalbmondDie Geburt nach christlichem KalenderEndlich auf der BühnePistazien schälenWorterklärungenMehr über dieses Buch
Hartmut Fähndrich: Hintergründe zum Jahr 1979
Über Raja Alem
Über Hartmut Fähndrich
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Raja Alem
Zum Thema Frankreich
Zum Thema Religion
Zum Thema Islam
Zum Thema Frau
Zum Thema Liebe
Weitere Informationen über diesen Romanund seine historischen Hintergründe finden Sie aufwww.unionsverlag.com
Erster Tag
Das Gas der Granaten zwang die Rebellen, ihre Stellungen an den großen Toren aufzugeben und sich in die Gewölbe des Heiligen Bezirks zurückzuziehen. Dort verschanzten sie sich, bereit für den Kampf bis zum Tod.
Aus den Hubschraubern regnete es Fallschirmtruppen. Wer das sah, mochte an jene Vogelscharen denken, von denen es im Koran heißt, sie hätten Steine aus gebranntem Ton auf die Soldaten Abrahas, des äthiopischen Herrschers über den Jemen, geworfen, die, geführt von einem Elefanten, angerückt seien, um den Heiligen Bezirk zu zerstören. Das war in der Zeit vor der Erleuchtung, um das Jahr 535 n. Chr. gewesen. Doch anders als die Vögel von damals verbreiteten die Fallschirmspringer Angst und Schrecken. Sie verteilten sich, Gasmasken über dem Gesicht, in Windeseile und durchkämmten die Säulenhallen des Heiligen Bezirks, um letzte Widerstandsnester auszuräumen. Dann öffneten sie rasch die Portale, und die Einheiten der Nationalgarde rückten ein.
Man schrieb den 27. November 1979. Giftige Wolken lagen über dem Heiligen Bezirk und verzogen sich nur langsam. Den Soldaten der Nationalgarde gelang es, nicht ohne schmerzliche Verluste, die Kontrolle über Hof und Hallen zurückzugewinnen.
Panik und Chaos breiteten sich unter den Rebellen aus, als unter Strom gesetztes Wasser in die Gewölbekeller strömte, in denen sie sich zusammendrängten. Mit flackerndem Blick und blutunterlaufenen Augen stolperten sie Schutz suchend durch das Geflecht der unterirdischen Zellen, in die sich sonst die Gläubigen zurückziehen, um Gott zu suchen. Wie mit Blindheit geschlagene Insekten tappten die von langer Belagerung und brutalem Kampf ausgemergelten Männer herum. Alle spürten, das Ende war gekommen. Ein aussichtsloser Kampf spülte sie hinweg, ein Kampf, in dem sie den Tod nur verzögern konnten, umkommen würden sie auf jeden Fall. Das Gewirr von Kammern verlangsamte die Ausbreitung des elektrisch geladenen Wassers. So verlängerten sich die Stunden des Widerstands oder, besser gesagt, die Stunden des Todeskampfes. Aber das war nur ein Aufschub, denn plötzlich, es war am 3. Dezember, begann es, über ihren Köpfen zu dröhnen. Sofort begriffen sie, dass dort gigantische Bohrer am Werk waren, die sich durch die Decke über ihnen hindurchfraßen. Und dann prasselten durch diese Löcher Granaten mit Zeitzündern auf sie herab, die in der Finsternis explodierten, sie zerfetzten und chemische Giftstoffe freisetzten. Körperteile flogen umher, und der Geruch von warmem Blut füllte die Räume.
Die Fallschirmtruppen schienen zu triumphieren. Doch die Rebellen schickten weiterhin blindwütig ihre Salven aus der Tiefe empor. Viele Soldaten kamen um, und ihre Leichen deckten die Bohrlöcher zu. Andere Soldaten rückten nach, machten die höllischen Öffnungen wieder frei, und sofort spritzten wieder tödliche Schüsse aus der Tiefe empor. Eine Kugel traf eine Gasgranate, die detonierte. Das Gas breitete sich in den Gewölben aus. Es war ein schreckliches Chaos auf beiden Seiten. Das Gas entschied schließlich den Kampf – zum Vorteil der Soldaten. Die Gewehre der in der Tiefe verschanzten Rebellen verstummten nach und nach, und durch die aufgebohrten Gewölbedecken hörte man die Geräusche des Todeskampfes, das Röcheln der Erstickenden, das Zetern der hilflosen Geblendeten. Der Widerstandsgeist der Rebellen war gebrochen, taumelnd wie Marionetten quollen sie aus den Gewölben ins Freie, um sich vor dem Gas in Sicherheit zu bringen. Doch draußen traf sie das Tageslicht, blind stolpernd und stürzend wurden sie von Scharfschützen in Empfang genommen und im Kugelhagel niedergemacht.
Die unterirdischen Kammern verwandelten sich in einen gärenden, stinkenden, leichenübersäten Schlachthof.
Als die Soldaten der Nationalgarde noch dabei waren, die letzten Widerstandsnester auszuschalten, tauchte in einem unterirdischen Gebetsraum hinter einer ausgemusterten Kanzel eine vermummte und blutverschmierte Gestalt auf, ein junger Mann, der mit großem Kraftaufwand den Deckel eines Abwasserschachts öffnete. Plötzlich spürte er einen blauen Lichtstrahl, scharf wie ein Skalpell, die Dunkelheit durchschneiden und sich vorsichtig der Tür nähern. Er erstarrte, seine Augen sprühten Funken. Den sicheren Tod erwartend, hielt er den Atem an. Das Licht wurde breiter, und an der Tür erschien ein kräftiger Soldat in Uniform, um den Raum zu durchsuchen. Er trat einen Schritt in den stockfinsteren Raum und durchschnitt die Dunkelheit mit seinem Lichtstrahl. In dem Augenblick, in dem er die Person auf der Erde erblickte, löste sich etwas Schweres, Schwarzes von der Decke. Die kauernde Gestalt sah mit Entsetzen, wie es krachend auf den anderen herabfiel. Es klang, als wenn Fels auf Fels geschlagen hätte. Der Soldat stürzte zu Boden. Die Lampe erlosch, und die völlige Finsternis kehrte zurück. War da ein menschlicher Körper herabgefallen, oder ein Stück Decke, oder gar einer dieser Folterengel, die sich in den Wolken aus Tränengas und Finsternis versteckt hielten? Als alles wieder schwarz und still war, stürzte sich der junge Mann auf den völlig benommen daliegenden Soldaten, riss dessen Sturmgewehr an sich und richtete es auf dessen Kopf. Er zwang ihn, in den Abwasserkanal zu steigen, folgte ihm und zog den Deckel von innen wieder zu.
Im Dunkeln gingen sie los. Ein Schatten, der ein Gewehr auf einen zweiten Schatten gerichtet hielt. Eine kleine, drahtige Gestalt in einer verdreckten Nationalgardistenuniform, die den athletischen Körper eines französischen Soldaten in blauer Uniform vor sich herschob. Beide stumm in dieser dröhnenden Stille, beide auf der Flucht vor diesem apokalyptischen Schrecken, umherirrend in den Eingeweiden der Erde, im Zersetzungs- und Verwesungsgestank um Luft ringend, blind voranstolpernd im endlosen, sich immer weiter verzweigenden Netz der Abwasserkanäle.
Beim geringsten Anzeichen eines Zögerns stieß die hagere Gestalt das Gewehr gegen die Schulter ihres immer noch benommenen Opfers, eine offensichtliche Drohung, ihm das Hirn auszupusten.
Sie zwang ihn zu rascher Flucht aus diesem Areal des Todes, wo die Granaten teuflisch geplant von der Decke fielen, die Verbindungswege des Gewölbegeflechts abschnitten und so die letzten Reste der Rebellen von ihrem Führer trennten. Trupp um Trupp konnte vernichtet werden.
Nur Mudschan, der Anführer, setzte in der Tiefe des Labyrinths, von einem verwinkelten Gang aus, den Widerstand noch lange fort und dezimierte die angreifenden Soldaten, bis er schließlich umzingelt und festgenommen wurde.
Als die beiden fliehenden Gestalten aus dem Kanalisationsschacht stiegen, standen sie mitten im al-Muddaa-Markt, außerhalb des Heiligen Bezirks. Immer noch betäubt vom Giftgas, torkelten sie durch die frische Luft, die schmerzhaft stechend in ihre Lungen eindrang.
Die beiden Schatten tasteten sich ihren Weg durch die engen Gassen. In der gespenstischen Stille schienen ihre Schritte zu dröhnen. In plötzlicher Angst, auf der Suche nach einem Versteck, stieß die hagere Gestalt den vom Gas benommenen Soldaten in eine Seitengasse, trieb ihn durch ein offen stehendes Holztor hinein ins finstere Treppenhaus eines verlassenen Gebäudes. In den unteren Stockwerken waren alle Türen verschlossen, weswegen sie immer weiter die steinernen Treppen hinaufstiegen.
Im obersten Stock rief der hagere Junge: »Gott verzeihe uns …«, und trat mit seinem Militärstiefel die Tür auf. Vor ihnen lag eine kleine Wohnung, eine Küche und ein einziges Zimmer, eine Art Kinderzimmer. An der zitronengelben Tapete hingen Fotos eines vielleicht siebenjährigen Mädchens, aus verschiedenen Winkeln aufgenommen. Es hüpfte heiter in die Luft, sein kurzer roter Rock flatterte im Wind, auch seine kurzen schwarzen Haare.
Mitten im Zimmer stand ein etwa einen Meter hohes Schaukelpferd, erstarrt in einem lautlosen Wiehern. Ihm gegenüber ein einschüchternd überdimensionierter Fernseher. Und rundherum ganze Reihen von Puppen, starrend saßen sie da, die meisten enorme Plastikpuppen, einige wenige handgefertigt aus Baumwollstoff. Die grellweiß leuchtenden Gesichter der baumwollenen glotzten ausdruckslos vor sich hin. Sie hatten riesige Glupschaugen, die mit grobem schwarzem Faden angenäht waren, darüber extrem nach oben gebogene Brauen. Sie schienen sich über die beiden Gestalten zu mokieren, die da keuchend und unaufgefordert in ihre vergessene Welt hereinplatzten.
Die beiden Gestalten erschraken bei dem seltsamen Anblick. Und wie auf ein Zeichen schauten sie sich an und realisierten gleichzeitig ihre Gegenwart. Die tödliche Entschlossenheit, die der Aufständische ausstrahlte, war mit Händen zu greifen, und mit dieser Entschlossenheit ließ er einen heftigen Schlag auf den Kopf seines Gefangenen sausen, der zu Boden ging. Doch der bewusstlose Körper machte den Rebellen noch wütender. Er trat mit den harten Stiefeln der Nationalgarde blindwütig auf ihn ein, Stiefel, die ihm offensichtlich zu groß waren. Er zielte bewusst auf die Mitte, offenbar hingerissen von dem Vergnügen, das ihm jeder Tritt gegen das empfindliche, schutzlose Geschlechtsteil bereitete. All der Hass und all die Angst, die er unter den Aufständischen durchlitten hatte, schienen sich an diesem männlichen Geschlecht zu entladen. Die zu großen Schuhe flogen ihm vom Fuß, und so trat er sein Opfer mit nackten Füßen weiter. Er schien wie in einem Lustrausch, der sich mit jedem Tritt gegen das Symbol männlicher Herrlichkeit steigerte. Er trat in wilder Hysterie, bis er an der blauen Uniform seines Opfers Blut sah, das von seinen eigenen Füßen stammte. Denn er war barfuß zu seiner Todesmission aufgebrochen und hatte sich erst später dieser Stiefel bemächtigt.
Plötzlich schien ihm der Körper des unterworfenen Riesen wie ein Mehlsack, ihn zu treten, bereitete kein Vergnügen mehr. Er kniete neben seinem Feind nieder und starrte ihn an, mit zitternden Fingern, die danach gierten, zwischen seinen Beinen zu wühlen oder die muskulöse Brust zu betasten. Als wolle er mit dem Blut des Feindes seinen lodernden Hass löschen. Doch anstatt ihn zu zerfetzen, begann er, seinem Feind die Kleider vom Leib zu reißen, angefangen mit der blauen Militärhose.
Ohnmächtig und noch halb im Delirium, empfand der Körper des französischen Soldaten die Demütigung, die ihm galt, er spürte die wilde Hand, die ihm das Hemd zerriss und ihm die geheimen Rettungsapparaturen abnahm: das Funkgerät, den Kompass, die Taschenlampe, Karten, eine Handgranate und Stricke, außerdem Ernährungskapseln für Notfälle. Doch wichtiger noch als all das: Sie nahm ihm seinen Stolz und die Kriegsmaschine, die in ihm wohnte. Als die Klauen seine Unterhose erreichten, erstarrten sie plötzlich und ließen ihm jene letzte Scheibe Stolz. Doch tief im Leib des französischen Soldaten weckte die Demütigung durch diese Art Gewalt ein Verlangen, wie er es noch nie erlebt hatte. Schließlich versank er in vollständige Bewusstlosigkeit.
Der Rebell verharrte kniend. Was sollte er mit diesem Körper anfangen? Er hatte ihn nicht so prächtig und vollkommen erwartet. Praktisch splitternackt lag er unter ihm, was seine Verwirrung noch erhöhte. Keiner seiner revolutionären Kameraden hatte so satanisch erregende Muskeln, keiner eine so schmale Taille besessen. In keinem seiner Kameraden hatte eine solche Gefahr gelauert, nagend selbst durch die Bewusstlosigkeit hindurch. Einen Augenblick schoss dem schmächtigen Rebellen der Gedanke durch den Kopf, sich auf dieses Paket zu stürzen, es Muskel um Muskel zu zerreißen und in die Hölle zu werfen, wo es herkam. Als Opfer für all die anderen Opfer, die er hinter sich gelassen hatte. Es würde ihn würdig machen, sich seinen Kameraden, den Kämpfern, anzuschließen, die in den vergangenen Tagen den Märtyrertod erlitten hatten und denen zweifellos das Paradies offenstand.
Doch dann rissen ihn die rundum starr glotzenden Augen aus diesen Gedanken. Unzählige Puppenaugen beobachteten die Szene. Er sammelte seine letzten Kräfte und stand auf, möglichst ohne die Puppen anzusehen. Trotzig setzte er sich in Bewegung und schloss die Tür und die vier Fenster, die auf eine ummauerte Dachterrasse hinausgingen.
Mit seinen letzten, rasch schwindenden Kräften schleifte er den Gefangenen zu einer hölzernen Säule in der Mitte des Zimmers, neben dem Fernseher. Dort setzte er ihn auf eine geblümte Decke und band ihn mithilfe eines Verlängerungskabels, das er im Zimmer fand, fest. Mit hektisch hysterischen Bewegungen bedeckte er die Gesichter der Puppen mit allem, was ihm dafür im Zimmer in die Hände fiel: Tuchfetzen, Papier, Handtücher. Schließlich ließ er sich auf eine Gymnastikmatte aus Schaumgummi fallen. So lagen die beiden Männer da, halb ohnmächtig, und noch immer benommen von dem Gas. Der Duft von Süßigkeiten, verpackt in Schachteln, die in einer Ecke des Zimmers gestapelt waren, hüllte sie ein. Ein Geruch, der die Absurdität der Szenerie noch verstärkte. Um sie herum summten große, blaugrün schillernde Fliegen, die zwischen den Süßigkeiten und den Gesichtern der beiden Männer hin und her flogen.
Zweiter Tag
Raphael erwachte, sein ganzer Körper schmerzte. Als er seine gefesselten Hände nicht befreien konnte, stieß er eine Flut von groben französischen Flüchen aus. Mit eisernem Willen ignorierte er den unerträglichen Schmerz an seinen von den brutalen Tritten lädierten Genitalien. Sein Blick fiel auf den völlig entkräfteten Körper, der auf einer abgewetzten Schaumgummimatte lag. Besonders fielen ihm die langen schwarzen Zöpfe auf, die unter dem schwarz-rot karierten Schumagh, der traditionellen Männerkopfbedeckung, hervorhingen.
Entweder lassen diese Terroristen ihr Haar wachsen wie ihre Ahnen, oder ich bin einem warmen Extremistenbruder in die Hände gefallen, dachte er.
Die ganze Szene schien ihm unwirklich. Halb nackt lag er da, gedemütigt, wie verspottet. Er war nicht einmal fähig zu schwitzen und die Hitze abzuleiten, die sich in seinem Innern gestaut hatte. Mörderische Kopfschmerzen, Resultat der Schläge mit dem Gewehrschaft, vernebelten ihm die Sicht. Seine Genitalien waren taub, und sofort fürchtete er um seine Manneskraft. Das Gas hatte in seinem Kopf ein beängstigendes, wildes Pfeifen ausgelöst, und sein Hals war trocken wie verklumpte Asche. Aber in seinem Inneren brannte der Wille, dieses schmächtige Bürschchen plattzumachen, das ihn überwältigt und wie einen lahmen Hund festgebunden hatte.
Der Rebell spürte die durchdringenden Blicke seines Gefangenen. Er erwachte und steckte hastig seine Zöpfe unter die Kopfbedeckung. Er sprang auf und verließ den Raum. Staunend sah der Franzose die grazilen Bewegungen des schmächtigen Bürschchens. Er wurde immer wütender, auf sich selbst und auf diesen Gegner.
Verfolgt von den Blicken seines Gefangenen, ging der Junge hinaus auf die Dachterrasse vor dem Zimmer. Er hielt sich gebückt, damit sein Kopf die Mauer nicht überragte und ihn keine lauernden Blicke von den umliegenden Dächern entdeckten.
Durch die Löcher in der Mauer, die der Dekoration und dem klammheimlichen Hinausschauen dienten, blickte er auf den Heiligen Bezirk hinüber. Furcht und Wut loderten in ihm auf. Verzweifelt suchte er nach Zeichen des Belagerungsringes um den Heiligen Bezirk. Doch es gab keine sichtbaren Hinweise, nur die Sirenen der Polizeiautos und der Ambulanzfahrzeuge, die sich mit dem Gurren der Tauben auf dem Geländer der Terrasse mischten. Alles deutete darauf hin, dass seine Kameraden vernichtet und zum Schweigen gebracht worden waren. Da war er nicht mehr imstande, seine Erschütterung zu kontrollieren.
Angsterfüllt stürmte Saifallah zurück ins Zimmer, direkt zu den Schachteln, die sich in einer Ecke türmten. Blindlings riss er die Deckel auf und zerrte den Inhalt heraus. Halb wahnsinnig vor Hunger, begann er, die Süßigkeiten und die Kekse in sich hineinzustopfen. Der Kontrast zwischen den hübschen Keksen und dem Tod, der aus dem Gesicht des Rebellen sprach, sprang Raphael in die Augen. Saifallahs Blicke waren unstet, sie blieben nirgends haften. Aus ihnen sprach die lange Belagerung, die Aushungerung, der letzte Angriff mit Gas und elektrisch geladenem Wasser. Der Anblick der Leichen seiner Rebellengefährten und die Haufen toter Geiseln.
Raphael beobachtete Saifallah wütend. Wie in drei Teufels Namen konnte er sich von dieser Null niederringen und die Waffe abnehmen lassen?
»Ihr müsst wissen: Diese Beduinen kämpfen wie von Dschinnen besessen.« Er rief sich den Satz ins Gedächtnis zurück, den er in einem Crashkurs in Südfrankreich gehört hatte, als er und seine Kameraden instruiert wurden, wie die Besetzung des Heiligen Bezirks aufzubrechen sei. Die Vorstellung von Dschinnen hatten er und die ganze stählerne Truppe mit verächtlichem Gelächter quittiert. Sich von einem Kampf mit unsichtbaren Wesen einschüchtern zu lassen, war lächerlich. Eine Beleidigung für diese durchtrainierten, waffenstarrenden Muskelprotze.
»Wer den Tod nicht fürchtet, kämpft wie ein Teufel.« Der Ausbilder warnte sie, die Sache nicht auf die leichte Schulter zu nehmen.
Und nun saß er da, in der Hand eines Aufständischen, der Kekse verschlang. Der Wunsch fraß an ihm, aufzustehen und ihm mit bloßen Händen die Haut abzuziehen, diese angeblichen Dschinnen darunter freizulegen und sie in der Luft zu zerfetzen. Wenn er nur könnte, würde er nicht stechen oder schießen, sondern diesem Bürschchen seine stählernen Finger in die weichen Muskeln graben.
Plötzlich sprang Saifallah auf, rannte zur Toilette und erbrach alles, was er in sich hineingestopft hatte. Er kotzte förmlich seine Eingeweide aus.
Als er ins Zimmer zurückkam, schien er völlig verloren. Was sollte er jetzt tun? Was machen mit seinem Gefangenen? Fahrig hielt er Raphael eine Schachtel hin und steckte ihm einen Keks in den Mund. Er stand da und beobachtete ihn beim Kauen. Und gleichzeitig packte ihn die Wut über die nachgiebige Geste, mit der er seinen Feind fütterte.
»Ich habe Durst.« In Zeichensprache bat Raphael um etwas zu trinken. Doch Saifallah schaute völlig ungerührt und traf keinerlei Anstalten, seine Bitte zu erfüllen. Der Durst dieses besiegten Gottlosen aus dem Westen befriedigte ihn. Als Raphael daraufhin wütend den Keks ausspuckte, erhielt er von Saifallahs bloßen Füßen sofort heftige Tritte in Brust und Beine. Doch völlig unerwartet packte Raphael mit den Fingern der linken Hand den tretenden Fuß und schleuderte Saifallah in die Höhe, sodass er auf den Rücken fiel. Der Franzose zerrte wie ein Wahnsinniger an dem Kabel, mit dem er festgebunden war. Fast hatte er sich befreit, doch da stürzte sich Saifallah auf ihn.
»Verflucht sollst du sein, du gottloses Schwein!«, bellte er.
Es war ein verlorener Kampf für den gefesselten französischen Soldaten der Eingreiftruppe der Nationalgendarmerie. Der schmächtige Rebell war zwar nicht mit den Dschinnen im Bund, doch er kämpfte mit dem Willen seiner gefallenen Kameraden, die er zurückgelassen hatte.
»Ich heiße nicht umsonst Saifallah! Ich bin Gottes Schwert!«, zischte er, während er die Kontrolle über die Situation zurückgewann und das Kabel an den Handgelenken seines Widersachers brutal festzurrte. »Probier noch einmal zu fliehen, und ich schmeiß dich sofort in das Loch, aus dem du kamst: die Hölle.«
»Du blödes Stück Scheiße, dich sollte man zusammen mit deinen Kameraden, diesen Kakerlaken, in den Abwasserkanälen ersäufen«, platzte es, in arabisch-algerischem Dialekt, aus dem Soldaten heraus.
Saifallah war überrascht, er wurde noch wütender. Dieser Ungläubige konnte Arabisch reden! »Ich werde dich hier verhungern lassen, du Teufelsbrut. Ich werde dich Stück für Stück der Hölle verfüttern«, schrie er.
»Ich werde bald mit größtem Vergnügen zuschauen, wie dich die Polizeihunde aufspüren und zerfleischen.« Die Beschimpfung bereitete Raphael wildes Vergnügen. Er spürte, dass seine Worte sich dem Rebellen ins Fleisch bohrten und neuen Hass weckten.
Saifallah spuckte Raphael an. Seine hektischen Bewegungen verrieten eine tiefe Verunsicherung. Er ging ins Treppenhaus und inspizierte jeden Stock. Das Haus war, wie die meisten Gebäude um den Heiligen Bezirk, aus vulkanischem Gestein gebaut. Durch die mit dichten Holzgittern bedeckten Fenster drang nur spärliches Licht herein. Die alten Holztüren waren allesamt durch solche aus Eisen ersetzt, die Saifallah nie und nimmer würde aufbrechen können. Der Schweiß lief dem Jungen über die Stirn, als er sich gezwungen sah, sich wieder in den Oberstock zurückzuziehen. Er spürte, dass er im Netz dieses lächerlichen Spielzimmers gefangen war, das in schreiendem Gegensatz zu dem Todesdrama im Heiligen Bezirk stand, dem er gerade erst entkommen war.
Eine tiefe innere Leere lenkte seine Schritte in die Küche neben dem Zimmer, wo ihn eine weitere Absurdität empfing: Auf den Regalen und in den Schubladen fanden sich nur ein paar Dosen mit gesüßtem Haferbrei für Babys – Quaker-Flocken! Er richtete sich einen Haferbrei und spürte die Demütigung: Während seine Kameraden den Märtyrertod starben, folgte er der Gebrauchsanweisung für Babynahrung. Wortlos setzte er sich Raphael gegenüber und begann zu löffeln. Völlig unvermittelt bot er dem Franzosen einen Löffel voll an, den dieser, ohne zu zögern, annahm. Einen Löffel, dann den nächsten. Der Franzose schluckte alles artig herunter, ganz im Einklang mit dem Überlebenstraining, in dessen Genuss er als Soldat gekommen war.
»Ich werde dich mästen und dann schlachten«, brummelte Saifallah und rechtfertigte so vor sich selbst und vor seinem Widersacher die großzügige Geste. Er versuchte, seine Aufmerksamkeit von der Nacktheit dieses Feindes abzulenken, jener sündigen Nacktheit, die das Zimmer mit unreinem, heißem Dampf erfüllte.
Raphael war sich der irrealen Absurdität dieser Situation völlig bewusst, in die ihn das Gas und der Schlag auf den Kopf gebracht hatten. Doch da war noch etwas Mysteriöses in der Gestalt seines Widersachers, etwas, das Raphael seines eisernen Panzers beraubte. War es wirklich der Schlag, den er durch die Hand dieses Winzlings empfangen hatte, dieses schmächtigen Extremistenbürschchens? Oder war es die Demütigung, der er jetzt ausgesetzt war? All die Jahre war er auf zahllosen Kampfplätzen ein unantastbarer Gott gewesen, der seinen Opfern das Leben nahm oder schenkte, ganz wie es ihm gefiel. Gab es geheime Kräfte in diesem Land der Dschinnen und der Geister, die den Schutzschild um sein stolzes Ego herum zerstörten? Raphael fühlte sich zutiefst verunsichert, ja, er erschrak über die Gefühle, die an ihm zerrten. Zerbrechlichkeit entsprach nicht dem Bild, das er von sich selbst als Kriegsmaschine auf zwei Beinen hatte. Mit jeder weiteren Minute kam sich Raphael mehr als Schildkröte vor, die von einer geheimen Kraft jenseits ihres eigenen Willens aus ihrem harten Panzer gedrängt wird.
In Saifallahs Bewegungen lag etwas Seltsames. Diese Bewegungen erinnerten ihn an sich selbst als Heranwachsender, bevor ihn der Wunsch gepackt hatte, sich der Eingreiftruppe anzuschließen und sich diesem brutalen Training auszusetzen. Durch Bodybuilding samt der Einnahme von Steroiden hatte er seine Schmächtigkeit abgeworfen, sich groß aufgebläht, wie der Geist aus der Flasche. Sein altes, schmächtiges Ich hatte er so unwiederbringlich begraben. Und nun kam dieses Beduinenkind und holte es aus seinem Grab zurück ins Leben und ließ ihn Faszination für seine Schwäche verspüren, die er überwunden geglaubt hatte. Raphael, ein Narziss, der sich noch einmal in sein Bild verliebt, das ihn schon lange nicht mehr darstellt.
Warum erlaubte er diesem seltsamen Wesen, die Tötungsmaschine zu blockieren, die lange Jahre des Kampfes in ihn eingebaut hatten, auf höllischen Schlachtfeldern, wo das Leben eines Menschen nicht mehr wert war als dasjenige eines Insekts. Wo man einen Menschen so selbstverständlich umlegte, wie man sich nach dem Essen eine Zigarette anzündete. Wo die Vernichtung des Feindes wie die abschließende Signatur eines vollendeten Gemäldes war. Wo das Leben von einem Zorn geleitet war, von dem er nicht wusste, gegen wen er sich eigentlich richtete.
In gegenseitiger abgrundtiefer Verachtung schienen die beiden Gegner ineinander verstrickt, entblößt dahintreibend in einem Gefühl der Unwirklichkeit, wie herausgefallen aus der Welt, die sie mit Blut getauft hatte. Der Rhythmus der beiden verlangsamte sich. Sie hatten keine andere Wahl, als sich in dieser Falle einzurichten. Sie hatten sich von den Gesetzen ihrer Welten und ihren beengenden Formen gelöst.
Schließlich ergaben sich die Rebellen. Mehr als zwei Wochen nach dem Beginn des Angriffs auf den Heiligen Bezirk wurde ein Rudel von zerzausten, verdreckten, bärtigen Gestalten unsanft in düstere Kastenwagen gestoßen. Verlaust, verschmiert und ausgehungert von der langen Belagerung, atmeten sie auf, erleichtert darüber, eine von ihnen selbst geschaffene Hölle hinter sich lassen zu können. Aus den Häusern rund um den Heiligen Bezirk beobachteten die wenigen, dort verbliebenen Anwohner wortlos und mit angehaltenem Atem das Schauspiel. Doch in der Stadt herrschte noch so viel Angst, dass niemand die Ausgangssperre brach, nicht einmal, nachdem das Ende der Belagerung offiziell verkündet worden war. Die Nachricht von der Kapitulation der Rebellen war noch nicht in die Gehirne gedrungen, und die Bewohner der Stadt, alt und jung, zuckten bei jedem lauten Geräusch zusammen, als erwarteten sie noch immer, von einer dieser Scharfschützenkugeln niedergestreckt zu werden, von denen sie zwei Wochen lang gejagt worden waren.
Der Hof des Heiligen Bezirks versank in tiefer Stille. Überall waren Blutspuren und verwesende Teile menschlicher Körper. Die verunsicherten Soldaten machten einen Bogen um sie herum, wenn sie, in Blau und Kaki gekleidet, zum x-ten Mal die Hallen und Gänge, die Gewölbe und Minarette der Heiligen Moschee durchkämmten, die letzten Widerstandsnester ausräumten und die Schlange des Zwists endgültig beseitigten. Über der ganzen Szenerie schwebten noch die Wolken des Giftgases und schützten die Soldaten vor der prallen Sonne.
Die Häuser vibrierten. Panzer und gepanzerte Fahrzeuge schoben sich durch die Straßen. Durch die spaltbreit geöffneten Fenster und Läden stahlen sich Blicke auf die Kolonne der Lastwagen, auf deren Ladefläche sich die Körper der Gefallenen türmten, von den kakifarbenen Plachen nur unzureichend zugedeckt. Der Konvoi schob sich durch die Chalil-Straße, südwärts Richtung Bir Jachur, wo die gesamte Ladung in ein Massengrab gekippt und dem Vergessen anheimgegeben wurde.
Scharen von Tauben schauten von den Geländern der Dachterrassen der umliegenden Häuser herab, unsicher, ob sie ihren Flug am Himmel über dem Heiligen Bezirk gefahrlos wieder aufnehmen konnten, Seite an Seite mit den gigantischen Helikoptervögeln, die immer noch über der Stätte kreisten. In ihrer Erinnerung lebten noch die Schemen bärtiger Scharfschützen, die von den Minaretten der Heiligen Moschee herab unerbittlich auf jeden Schatten schossen, der sich bewegte, in der Nähe oder auf den Bergen um die Stadt.
Irgendwann überwand dann doch eine erste Menschengruppe ihre Angst. Sie eilte herbei, um sich an der Säuberung des Heiligen Bezirks zu beteiligen. Möglichst bald sollte von den Minaretten wieder der Gebetsruf herabregnen statt der tödlichen Kugeln. Doch die Mehrzahl der Häuser blieb gelähmt durch Gerüchte, die über die Flucht einiger Rebellen umliefen. Sie hätten sich am Rand des Heiligen Bezirks neu gesammelt. Die Schießereien, die in verschiedenen Teilen und Tälern der Stadt aufflammten, wo man versuchte, der Flüchtigen habhaft zu werden, bestärkten sie in dieser Annahme. Die Fantasien wucherten, und man sah in jedem Schatten einen Kämpfer, in jedem Ast, der sich bewegte, ein Gewehr, und in jedem Gewand, das wehte, den Angriff unbekannter Heerscharen.
Dritter Tag
Saifallah kam barfuß ins Zimmer, an Gesicht, Händen und Unterarmen noch Spuren vom Wasser der Waschung. Er schaute sich nach einem Platz um, an dem er sein Gebet verrichten konnte. Raphael beobachtete seine unsicheren Bewegungen. Er schien außerstande, eine Stelle zu finden, wo er geschützt war vor dem Blick des kleinen Mädchens, das ihn aus den Bildern auf der Tapete verfolgte. Raphael schloss die Augen, überwältigt von seinen widersprüchlichen Empfindungen: Zorn, vermischt mit der Faszination, sich selbst im beweglichen, schmächtigen Körper jenes Rebellen zu sehen. Wie sollte er sich selbst den unerträglichen Drang eingestehen, diese völlig unbehaarten, glatten Arme zu berühren und gleichzeitig zu zerfetzen. Von diesen samtweichen, schlanken Fingern berührt zu werden, die nicht die Finger eines Kämpfers waren, die aber trotzdem bei ihrem jüngsten Kampf schmerzhafte Spuren auf seinem Körper hinterlassen hatten. Nach der Waschung leuchteten Saifallahs feine Gesichtszüge heller. Und seine Körperbewegungen beim Gebet brachten Raphael aus dem Gleichgewicht, versetzten ihn in einen Zustand der Hypnose. Durch die Demütigung, durch die Zerstörung der stählernen Schale, in der er sich so sicher gefühlt hatte, war er wie entblößt und äußerst dünnhäutig geworden. Seinen schon fast krankhaft geschärften Sinnen entging keine Bewegung, kein Geruch, nicht einmal das Krabbeln einer Ameise. Er befand sich in einem schmerzhaften Zustand der Wachheit, spürte ein vages, unkörperliches Hungergefühl.
Saifallah stand wie festgenagelt mitten im Zimmer. Er war auf diese Puppen aufmerksam geworden, die er anfangs in den Hintergrund geschoben und dann vergessen hatte. Jetzt nahm er, durch die Bedeckung hindurch, die er über sie gelegt hatte, die Konturen ihrer Gesichter wahr. Sie schauten ihn verstohlen an. Einige Plastikbeine und -arme hoben die Hüllen hoch und begannen, sich zu winden – sündig geschmeidig, fast fließend. Die Engel, die herabgeflogen waren, um sein Gebet zu bezeugen und entgegenzunehmen, stoben davon. Das nackte Plastikfleisch erfüllte ihn mit Schrecken. Er spürte den Teufel, der sich in diesen groben Rundungen über ihn und seine Versuche lustig machte, sich für den Tod zu reinigen und in diesem Zimmer Gottes Gegenwart zu suchen, damit er ihm den verlorenen Kampf gewinnen half.
Er wandte sich rasch um, um an der Tür zu beten, die auf die Terrasse hinausführte. Nun bot er seinen wehrlosen Rücken als offenes Ziel Raphael und den Puppen dar, deren spöttische Blicke auf sein rundes Hinterteil gerichtet waren. Saifallah vollzog eine Niederwerfung, sein Innerstes bebte. Das Blut strömte ihm heiß in die Ohren, er verlor das Gleichgewicht und sank vor Gott auf Knie und Hände. Und in dem Augenblick, in dem seine Stirn den Boden berührte, quollen aus seinen trockenen Augen Tränen und fielen auf den kalten Boden. Sein ganzer Körper tauchte ein in eine lange Niederwerfung voller Sehnsucht nach einer Grube oder einem Grab, in dem seine Asche wohnen konnte.
»O Herr, ich bin Dein Schwert, zerbrochen, wenn Du mich nicht mit Deiner Gnade lenkst. Teuflische Zweifel nagen an mir. O Gott, siehst Du mich flüchtig aus der Schar Deiner Soldaten? Ich bin nichts als Dein Knecht. Deinem Willen habe ich mich ergeben, wie Du ihn für uns gewollt hast damals, als Du uns mit einem Erbeben Deines Heiligen Hauses geprüft hast. Du hast unseren Kampf gesehen, bis zum letzten Atemzug, als unsere Herzen in die Kehlen aufstiegen und unsere Augen den Todesengel Asrail erblickten. Ich bin geflohen, um den Kampf fortzusetzen. Und hier bin ich vor Dir, zu schwach, um weitere Deiner Prüfungen zu bestehen.«
Etwas zerbrach in Raphael, als er Saifallahs kleinlautes Klagen vernahm. Überzeugungen barsten in ihm, die er jahrelang für uneinnehmbar und unerschütterlich gehalten hatte. Saifallah in dieser Gebetshaltung kauern zu sehen, ließ ihn unkontrollierbar erbeben. In sein Gehirn drängte sich ein Bild, nicht dasjenige Saifallahs, sondern von sich selbst, Raphael, kauernd und eingekreist von wilden Tieren in Menschengestalt, außer Rand und Band. Lange unterdrückte Erinnerungen entschlüpften der Flasche, wo er sie all diese Jahre eingeschlossen hatte. Es war im zweiten Monat des höllischen Trainings gewesen, an dessen Ende die Aufnahme in die Eingreiftruppe stehen sollte. Zwei Monate lang hatten sie ihn schon über die Grenzen des Erträglichen gefordert, zwei endlose Monate, während derer ihm immer wieder der Gedanke kam, sich auf eine Granate zu werfen, um all dieser Quälerei ein Ende zu machen. Sicher hatten die Ausbilder seine Verzweiflung bemerkt. Sie trieben ihn in immer unerträglichere Situationen.
Die Soldaten sollten über sich selbst hinauswachsen, und zwar bei einem Überlebenstraining in der Wildnis. Man brachte sie in die Regenwälder von Madagaskar und überließ jeden sich selbst im Kampf gegen die Natur. Raphael fand sich in einer verlassenen, feindlichen Welt wieder, die nur von Fabelwesen bewohnt war. Der Schauplatz war mit Bedacht gewählt worden, um in ihnen die letzten noch verbliebenen Würzelchen von Sanftheit und Menschlichkeit zu eliminieren.
Kaum war Raphael gesprungen, geriet er mit seinem Fallschirm in einen tropischen Wirbelsturm, der ihn herumbeutelte und Tausende Fuß weitertrug, bis er in die Tiefe des undurchdringlichen Waldes fiel. Wie eine Höhlenwelt zog sich der Dschungel der Erde entlang, kein Sonnenstrahl gelangte auf ihren Grund. Er irrte durch die dampfende Dunkelheit. Weiter und weiter stolperte er auf der Suche nach einem Pfad, außerstande, seinem Kompass zu folgen. Alles Gerät, das er bei sich hatte, erwies sich als unbrauchbar. Wie ein Insekt fühlte er sich, allein im endlosen Wald. Bäche, die ebenso plötzlich verschwanden, wie sie hervorgebrochen waren. Überall lauerten grässliche Schlingen. Benommen schlüpfte er unter ein Wurzelgeflecht und machte ein Feuer, das träge schien, ohne Farbe, ohne Bewegung, ohne Wärme, ein Feuer, das nur die bedrohlichen Schatten um ihn herum in die Länge zog. Nicht einmal sich zu bewegen wagte er, da sein Schatten enorm wurde, sich in alle Richtungen dehnte und sich auf alles legte. Da war nichts als er selbst, ein sich selbst spiegelndes Monster, das die Tiere des Urwalds aufschreckte. Auch hinlegen konnte er sich nicht, der glitschige Boden war bedeckt mit einem wimmelnden Teppich aus winzig kleinem Getier. Über ihm ein Geflecht aus Boaschlangen, jede einzelne mit sieben Hörnern, zischend und verschlungen, die glotzenden Augen auf ihn gerichtet. Er wagte nicht, dieses Obdach zu verlassen. Um sein Versteck herum brüllte der Stier, der umherjagte und Menschen verschlang. Diese mythischen Fantasiebilder aus madegassischen Märchen und Geschichten hatten sie während der Ausbildung amüsiert. Doch hier in diesen todbringenden Urwäldern waren sie präsenter und gefährlicher als die Bewaffnung, die er, Raphael, mit sich schleppte.
Die Zeit zog sich endlos dahin. Raphael verlor seine antrainierte Selbstkontrolle. Mal hoffte er, dies alles sei ein Albtraum, aus dem er gleich erwachen würde. Dann hoffte er, ein Raubtier möge ihn in Stücke reißen. Doch es kam keine Erlösung. Er musste weiter. Kriechend und tastend drang er in diese dampfenden, schwarzen Tiefen vor. War es Tag, war es Nacht, er konnte es kaum feststellen. Kein Sonnenstrahl drang bis auf den Grund dieses Pflanzengewirrs. Klingenscharfe Pflanzen rissen seine Haut auf. Zum Schlafen ließ er sich in eine dunkle Höhlung gleiten, die ihn aufnahm wie eine feuchte Leibeshöhle. Doch als er sich umschaute, grinsten ihn verwesende Menschenschädel an. Panisch floh er und schleppte sich weiter. Die Linien und Legenden auf seiner Karte waren nutzlos geworden. Alles hatte seinen Sinn verloren. Die Finsternis hatte jedes Lebenszeichen um ihn herum verschlungen. Übrig waren allein diese Gespenster, die in seiner alten Wunde bohrten, der schwärenden Verletzung seiner Kindheit. Da war er wieder, der Schmerz seines Vaters, den die Mutter für einen anderen verlassen hatte. In dieser Verzweiflung des Vaters versank Raphael aufs Neue, um sie zu rächen, war er Soldat geworden. Sie nagte an ihm wie die Feuchtigkeit am Knochen.
Wie viel Zeit war vergangen? Minuten? Stunden? Eine Ewigkeit? Nein, Zeit interessierte ihn nicht mehr. Die Zeit schien stillzustehen. Er wollte nur noch eines: heraus aus dieser Dunkelheit. Da registrierten seine überscharfen Sinne das Knacken brechenden Holzes, ein mattes, kaum hörbares Ticken, und in ihm erwachte neue Hoffnung auf Rettung. Er fuhr herum, sah nichts. Doch da stieß ihn etwas von hinten. Er fiel vornüber auf eine massive Riesenwurzel, die wie eine Bank, wie ein Altar aus der Erde hervorgewachsen war. So lag er, das Gesicht nach unten, geknickt, gefaltet, dargeboten als Schlachtopfer eines Teufels, der nun begann, sich an seinem festgenagelten, ausgelieferten Körper zu befriedigen. Seine Hosen wurden zerrissen, seine Eingeweide erstarrten, als Klauen begannen, damit herumzuspielen, Klauen ohne Zahl, die sich in sein Fleisch gruben. Jetzt war er fest davon überzeugt, dass die bösen Geister des Dschungels Gestalt angenommen hatten, um ihn zu verfolgen. Gleichzeitig hörte er Weinen von zahllosen Kinderstimmen, und ihm fiel ein, was der Ausbilder von Kindern erzählt hatte, die hier zu Zeiten des Unheils geboren werden: Man legt sie auf Ameisenhaufen, damit sie bei lebendigem Leib gefressen werden. Raphael spürte erbarmungslose Ameisenzähne in seinem Unterleib nagen. Er drehte und wand sich, aber er konnte sich nicht befreien. Hölzerne Speere schienen sich in seinen Unterleib zu bohren. Gierig, lüstern und unerbittlich rissen sie seinen After auf. Er wurde zu einem willenlosen Nichts, bis schließlich der Schmerz den Höhepunkt erreichte und in ihm aufplatzte wie eine Blase.
So ließen sie ihn liegen. Als er sich schließlich erhob und weiterging, einen Blutfaden hinter sich herziehend, zuckte er vor jedem Käfer, jedem Tier, jedem Schatten zusammen. Der ganze Dschungel stank ekelhaft und faulig nach seinem vom Sperma des Teufels verpesteten Innern. Seine Waffe hatte er zurückgelassen mitsamt der hoch entwickelten Ausrüstung, mit der man sie vor dem Absprung in diese Hölle ausgestattet hatte. Tastend setzte er seinen Weg fort. Dass er halb nackt war, kümmerte ihn nicht.
Dann tauchte vor ihm jenes Monster auf. Pechschwarze Hautfalten hingen wie Lappen an seinem grellweißen Skelett. Dieses Skelett war das erste Helle, das ihm auf seinem Weg begegnete. Augen wie glühende, gleißende Kohlen, eine schlaffe Oberlippe, die wie ein Vorhang über die monströs langen Zähne hing. Die Gestalt gab Raphael mit einem Zeichen zu verstehen, ihr zu folgen, doch ihre Füße weckten Raphaels Argwohn. Sie zeigten nach hinten, nicht, wie die Füße menschlicher Wesen, nach vorn. Er hätte gern kehrtgemacht und das Weite gesucht, doch das faltenumhüllte Monster erlaubte ihm nicht, sich zu entfernen. Es wies Raphael an, das vor ihm liegende Meer aus kristallenen Klingen zu überqueren – von der Natur geformte scharfe Schneiden, dicht nebeneinander, ohne Zwischenräume. Da war kein Platz für die Füße, darauf zu treten war nicht möglich. Raphael wollte fliehen, doch der faltige Gigant tauchte erneut vor ihm auf und führte ihn tiefer und tiefer aufs Klingenmeer hinaus. Benommen setzte Raphael Fuß um Fuß auf diese Kristallmesser. Es war ihm egal, ob das Fabelwesen ihn seiner endgültigen Vernichtung entgegenführte. Er folgte ihm ohne Widerstand, bis zum Eingang einer riesigen Höhle, einem schwarzen Loch, das ihn einzusaugen schien. Kaum drinnen, zog es ihn durch endlose Gänge in die Tiefe. Nichts war zu sehen, und doch hatte er keinerlei Zweifel, dass die Wände dieser Höhlen mit Toten ausgekleidet waren. Ein Massengrab für die Überreste eines kolonialistischen Krieges, flüsterte eine Stimme in seinem Kopf. Und plötzlich waren da wieder die Warnungen seines Ausbilders vor den Gräbern der Madagassen: »Nie mit dem Finger auf ein Grab zeigen. Euer Finger wird abfallen!« Obwohl er diese Vorstellung einfältig fand, bemühte Raphael sich, seine Faust geschlossen zu halten und nicht auf eine der Grabstätten ringsum zu zeigen. Hatte man ihn zu jenem Ritual der »Knochenwende« geführt, bei dem die Toten feierlich ausgegraben und in neue Leichentücher gehüllt werden, damit sie im Tode glücklich bleiben und ihre Zufriedenheit sich auf die lebenden Verwandten überträgt?
Raphael spürte, dass er von Skeletten umgeben war, weiß mit schwarzen Streifen und gekrönt von Schädeln, die den Vorübergehenden mit saugendem Blick anstarrten. Die Knochen leuchteten und erhellten die Grotte.
Da wurde die Nacht plötzlich mondhell. Er wurde hinaus ins Leben gestoßen und trieb auf den Wassern des Indischen Ozeans, auf dem sich die funkelnden Sterne spiegelten. Es war still. Er überließ seinen geschundenen, fiebrigen Körper, mit den schwärenden Wunden dem salzigen Wasser und dem Wind. Am Ende hatte er nun doch einen Weg aus diesen Dschungeln gefunden.
Zurück bei seiner Gruppe, wehrte er sich gegen alle Versuche seines Ausbilders, ihn medizinisch behandeln zu lassen. Er ertrug schweigend das Fieber und die Fäulnis in seinem Innern und den Verdacht, von seinen Kameraden vergewaltigt worden zu sein, von diesen Kameraden, die ihn tyrannisierten, seit er sich der Einheit angeschlossen hatte. Aufgrund seiner Verletzlichkeit, ein Erbe der Mutter, hatten sie ihn für einen Schwulen gehalten. In seiner Zerbrechlichkeit sahen sie eine Einladung zur Schändung und hatten vor, ihm das so auszutreiben. Doch Raphael, der im Dschungel an seine Grenze gekommen war, reagierte nur mit einem unstillbaren Zorn beim Zerstörungstraining und brillierte fortan als Soldat. Mit dem Tod stand er nun auf vertrautem Fuße.
Und nun, als sich dieser schmächtige Rebell vor Raphaels Augen zum Gebet niederwarf, erinnerte sich Raphael an seine lang zurückliegende Vergewaltigung. Die Maske des wilden Tiers, hinter der er Schutz gesucht hatte, war gefallen. Aus der Tötungsmaschine der Einsatztruppe kam wie eine bunt schillernde Seifenblase der empfindsame Jugendliche hervor, den er in den Höhlen von Madagaskar zurückgelassen hatte. Er wusste nicht, warum, aber irgendwie fand er sich mit Saifallah verstrickt, ja, er spürte die unausweichliche Notwendigkeit, ihn zu schützen.
Raphael zuckte zusammen. Er begriff, dass er drauf und dran war, seine militärische Ausbildung zu verraten, die aus ihm eine zu allem bereite Kampfmaschine gemacht hatte. Sich einfach so gefangen nehmen zu lassen, ohne ernsthafte Gegenwehr. Was hatte dem Rebellen erlaubt, ihn in seinen Bann zu schlagen? Er saß da und dachte über die Veränderung nach, der er sich unterwarf. Nicht nur veränderten sich seine Gefühle, sogar seine Muskeln schienen zu schrumpfen. War das alles dem Gas zuzuschreiben, das er eingeatmet hatte?
Saifallah betete lange auf den Knien, die Stirn auf der Erde. In ihm war ein Brennen und Beben. »O Lenker, o Leiter, zeig mir ein Wunder oder hilf mir, diesen Ungläubigen zu töten, damit ich mich danach mit einem Herzen aus Stein dem Feuer der Verfolger stellen kann.«
Schließlich beendete er sein Gebet und wandte sich resolut dem Zimmer zu. Das Mädchen auf der Tapete betrachtete ihn, während er die Schachteln mit den Keksen leerte und an die Wand stellte. Über das Zimmer senkte sich eine bedrohliche Finsternis. Saifallah schien wie unter Hypnose. Mit starrem Blick sammelte er die Puppen ein, wobei er seine Finger mit einem Handtuch umwickelte, sorgsam darauf bedacht, sie nicht direkt zu berühren und ihnen nicht in ihre blauen, strahlenden Augen zu schauen. So trennte er den ersten Kopf ab und warf ihn in die nächstbeste Schachtel. Ein zweiter folgte, dann ein dritter. Die Abschlachtung der Puppenschar wollte kein Ende nehmen. Schließlich waren drei Schachteln randvoll mit Puppenköpfen und wurden geschlossen, doch die eingesperrten blauen Augen schienen den Karton zu durchbohren, um den Abschluss der Schlächterei zu verfolgen. Am Ende machte Saifallah sich daran, die kopflosen Leiber zusammenzulesen. In einer Ecke des Zimmers häufte er sie auf und breitete einen roten Teppich darüber. Daraufhin begann er mit sichtlichem Widerwillen, die Stoffpuppen zu zerfetzen, eine nach der anderen. Er riss die Baumwollfüllung heraus, deren weißer Staub durch den Raum schwebte. Die leeren Bälge mit den geschrumpften Gesichtern warf er in den Abfalleimer.
Das Tapetenmädchen erzitterte, als er danach ihm seine Aufmerksamkeit zuwandte. Er holte ein Messer und machte sich daran, die Porträts von der Wand zu kratzen. Er schabte mit Leibeskräften drauflos und hinterließ tiefe Wunden an den fröhlichen Bildern. Jedoch gelang es ihm nur, den untersten Teil der Bilder zu entfernen. Wo sein Messer nicht hochreichte, beobachteten die Mädchenaugen mit Entsetzen die Verstümmelungen, die in Bodennähe geschahen. Doch wie er auch kratzte und schabte, die Silhouetten der Mädchen blieben auf der Tapete vollständig sichtbar, sie schienen dahinzufliegen, verletzt zwar, aber noch immer strahlend vor Freude und Freiheit.
Raphael bekämpfte seine Faszination, indem er Saifallah innerlich verspottete, diesen Rebellen, der völlig vertieft war in den Kampf mit den kraftlosen Puppen, als seien sie ein feindliches Heer.
Saifallah spürte Raphaels Blick. Plötzlich hielt er inne und drehte sich unwirsch um: »Mach dich bereit, mit ihnen in die Hölle zu fahren!«
»Du kämpfst gegen ein Mädchen an der Wand! Mein Gott, du bist wirklich ein Nichts.«
Doch Saifallah zeigte keine Reaktion, und Raphael blieb nichts anderes übrig, als weiter zu lästern. »Du bist mir ein richtiger Teufelskerl. Nur weil du ein Gewehr in der Hand hast, hältst du dich für den Herrn über Leben und Tod.«
Saifallah flüsterte ein kurzes Gebet und verschloss so seine Ohren gegen diese Lästerung.
Vierter Tag
Als heftiger Lärm in die Stille einbrach, stürzte Saifallah aus dem Bad. Im Zimmer überraschten ihn der helle Bildschirm und die dröhnende Stimme des Sprechers. Nachdem er den Raum verlassen hatte, war es Raphael gelungen, mit dem Fuß den Fernseher zu erreichen und anzuschalten.
»Diese Leute sind Feinde Gottes, die Verderbnis auf Erden bringen. Ihre Strafe wird …« Die Stimme des Sprechers brach Unheil verheißend ab. Saifallah sah sich auf dem riesigen Bildschirm den Gesichtern seiner Rebellenkameraden gegenüber. Wie gelähmt stand er da, völlig schockiert, jene zu sehen, mit denen er über ein Jahr zusammengelebt, mit denen er die höllischen Stunden der Besetzung geteilt hatte. Das ganze Land von Ost bis West saß jetzt erstarrt vor dem Fernseher und verfolgte die Nachrichten. Wieder und wieder wurden die Rebellen gezeigt, die sich ergeben hatten und nun, nach langen Verhören, ihre Verbrechen gestanden und erklärten, die Höchststrafe zu verdienen. Ihre hohlen Augen blickten in eine andere Welt. Ihnen drohte die Todesstrafe, weshalb sie alles sagten, was sie vor weiteren Verhör- und Foltersitzungen bewahren konnte. Sogar ihr Glaube, auf sie warte das Paradies, war erschüttert. Diese Verheißung war ihr letzter Halt, und deshalb wollten sie möglichst schnell diese Welt verlassen. Schon nach wenigen Stunden der Befragung und der Folter waren sie eingeknickt. Diese zerzausten, gebrochenen Männer wirkten auf die Zuschauer, als hätten sie alle ihre Gewissheiten verloren.
Saifallah schreckte aus seiner Schockstarre auf. Er stürzte auf den Fernseher zu und zertrümmerte den Bildschirm mit dem Schaft seines Gewehrs.
»Das Auge des Satans«, zischte er und stieß Raphael den Gewehrschaft an den Kopf.
Aus der Schläfe des Soldaten quoll Blut. Eine Fluch- und Schimpftirade ergoss sich über Saifallah. »Du Idiot, sie werden dich fangen, während du dich hier wie eine Fledermaus verkriechst und so tust, als ob du dich heldenhaft gerettet hättest.«
Saifallah verkroch sich in die hinterste Zimmerecke. Vor seinem inneren Auge standen die Bilder der vernichteten Kameraden. Über die beiden Männer legte sich ein Unheil verheißendes Schweigen. Die Zeit kroch dahin. Saifallah saß apathisch da, atmete kaum und starrte ins Leere. Hatte er das Bewusstsein verloren? Wusste er überhaupt noch, wo er war und wie es um ihn stand?
Als er wieder zu sich kam, war das Blut an Raphaels Schläfe geronnen und schwarz geworden. Mechanisch bewegte Saifallah sich in die Küche und machte sich daran, Hafergrütze zu kochen. Der Tod seiner Kameraden ließ nur einen einzigen Gedanken zu: Sie alle waren schon ins Paradies eingegangen. Er rührte und schlang gehetzt das Essen hinunter. Die Szene am Fernseher konnte nur ein Albtraum gewesen sein, der schon wieder aus seinem Bewusstsein getilgt war.
»Hör mal, so kommen wir nicht weiter. Diese gegenseitige Quälerei nützt keinem von uns. Wir müssen einen Ausweg aus dieser Situation finden. Im Augenblick sind wir blockiert. Ich schlage dir einen Deal vor. Dazu musst du aber einsehen, dass du genauso ein Gefangener bist wie ich.«
Ein Zucken an Saifallahs Mundwinkeln zeigte Raphael, dass er einen empfindlichen Nerv getroffen hatte.
»Glaub mir«, fuhr Raphael fort, »wir können hier rauskommen, und danach geht jeder seines Weges. Du musst nicht unbedingt das gleiche triste Schicksal erleben wie deine Kameraden. Niemand muss erfahren, was du für eine Rolle bei der ganzen Geschichte gespielt hast, nicht einmal, dass du dabei warst. Ich verspreche dir, dass ich vergesse, dich je getroffen zu haben.«
Saifallahs lautes Lachen ließ Raphael hochfahren. »Du lachst ja wie eine Frau«, rief er verwundert. Sein Blick ging über die schlanke, ranke Gestalt, die da vor ihm stand, mit ihrer schmalen Taille über dem wohlgerundeten Gesäß. Und in diesem Augenblick veränderte sich etwas in der Energie um die beiden herum, kaum wahrnehmbar, aber bedeutsam.
Saifallah lief rot an. Er wich vor Raphaels zudringlichem Blick zurück.
»Lass dir Zeit, aber denk darüber nach. Ich kann deine Sicherheit garantieren.«
Plötzlich stürzte Saifallah auf Raphael zu, packte ihn an der Kehle und begann, ihn zu würgen. »Du gottlose Kreatur«, zischte er, »für euch zählt nur das vergängliche Leben auf dieser Erde. Mehr habt ihr nicht, denn sobald ihr sterbt, stürzt ihr in die Tiefen der Hölle, als Strafe für all den Frevel, den ihr mit eurer Anbetung des Lebens getrieben habt.«
Raphael war schockiert von der Erregung, die er empfand, als Saifallahs Hand ihn fasste. Trotz des Schmerzes spürte er einen wohligen Schauer, der sich durch sein Rückenmark zog.
Aber auch Saifallah schreckte zurück. Wie getroffen von der Berührung dieses Körpers, ließ er den kräftigen, muskulösen Hals los. Die Situation schien ihm peinlich, und er zog sich zurück. Er machte sich Vorwürfe, diesen Mann, den Feind, entblößt und sich damit selbst bloßgestellt zu haben, aber es gab keinen Weg mehr, das rückgängig zu machen.
»Einer wie du wird einem wie mir nie etwas garantieren. Wir Dschihadisten haben unsere Häuser und unsere Familien verlassen und uns gelobt, dass wir uns erst im Paradies wiedersehen werden. Für uns gibt es auf eurer vergänglichen Welt kein Leben.«
Raphael spürte den Wunsch, diesen Schwachkopf auszulachen, der offenbar beschlossen hatte, wie in einer Endlosschleife die immer gleiche Leier vom Paradies von sich zu geben, das für ihn und seine Kameraden reserviert sei. Das spöttische Lächeln auf seinem Gesicht provozierte Saifallah.
»Bisher habe ich mich im Kampf nicht ausgezeichnet«, brüllte er. »Aber du bist mir wie durch ein Wunder geschickt. Ich kann dich als Geisel verwenden, um die Freilassung meiner Kameraden zu erwirken, oder, wenn das schiefgeht …« Er verstummte, als müsse er in seiner Verwirrung erst noch herausfinden, was er mit seiner Geisel alles anstellen könnte.
»Einen wie dich umzubringen, garantiert einem den Palast im Paradies.«
»Okay, bringen wir die Sache zu Ende. Jag mir eine Kugel durch den Kopf, dann hast du deinen Logenplatz im Paradies. Auf dieser Welt nütze ich dir nichts. Niemand wird deine Freunde gegen mich eintauschen. Bald wirst du allein deinen Verfolgern gegenüberstehen, und wie du im Fernsehen gesehen hast, wird man dich lange bestialisch quälen.«
Raphaels Worte stachelten Saifallah erst recht an. »Wer auf dem Wege Gottes kämpft, ist nie allein. Gott ist bei mir. Was dich angeht, so bin ich nicht so dämlich aufzuhören, dich zu quälen. Jedenfalls nicht so einfach. Aber eins ist sicher: Für dich gibt es keinerlei Hoffnung, ins Paradies zu gelangen, weder in eines im Diesseits noch in eines im Jenseits.«
»Soso, nun spielst du auch noch den Paradieswächter. Und einen ganz schön egoistischen dazu. Verrat mir doch, wer die Glücklichen auf deiner Liste sind, die es verdienen, ins Paradies einzugehen!« Raphael fand mehr und mehr Vergnügen an diesem Disput mit Saifallah. Zudem versuchte er alles, um den jungen Mann davon abzubringen, ihn zu töten. »Pass mal auf, junger Mann, vielleicht verdiene ich ja das Paradies mehr als irgendeiner von euch. Nimm mal zur Kenntnis, dass ich Muslim bin, dass ich das Bekenntnis gesprochen habe, dass ich erklärt habe: Es gibt keine Gottheit außer Gott, und Muhammad ist der Gesandte Gottes. Im Gegensatz zu dir und deiner Terrorgruppe aber bin ich nicht heimlich in den Heiligen Bezirk geschlichen, sondern ich habe dafür eine Erlaubnis gehabt.«
»Dass du Arabisch kannst und dass du das Glaubensbekenntnis gesprochen hast, macht aus dir noch keinen Muslim. Meine Vorfahren, die Ichwan, haben den Gründer dieses Landes unterstützt, dann aber nicht gezögert, ihn zu bekämpfen, als er diplomatische Beziehungen mit dem Westen aufnahm und euch gottlose Westler in unser Land ließ.« Saifallah fiel nun selbst auf, dass er hier mechanisch Mudschans Reden wiederkäute, die sich in sein Hirn eingegraben hatten.
»Was weiß schon ein Jüngelchen wie du von internationaler Politik? Euer Herrscher hat einen Staat aufgebaut, kein Stammeslager in der Wüste. Euer Führer, dieser Mudschan, dagegen hat unwissende Kinder wie dich in irgendeinem Lager einer Gehirnwäsche unterzogen. Und was ist eigentlich so schändlich daran, mit anderen Staaten Beziehungen zu pflegen? Soweit ich weiß, gibt es einen Ausspruch des Propheten, der lautet: ›Suchet das Wissen, und wäre es in China!‹ Der Prophet hat nicht gesagt: ›Meidet die Chinesen und tötet sie.‹«
Saifallah konnte nichts entgegnen und wollte nichts mehr hören. Diese Logik stellte alles infrage, was er in den vergangenen Monaten gelebt hatte. Doch das Gespräch hatte zwischen den beiden einen menschlichen Raum geschaffen, hatte sozusagen aus zwei Todesinstrumenten Menschen gemacht, die sich gegenübersaßen, zwei Menschen mit ihren je eigenen persönlichen Schwächen und Begrenztheiten.
»Du glaubst wohl, du wärst die Instanz, die Rechtgläubigkeitsurkunden vergibt, die festlegt, wer gläubig und wer ungläubig ist?« Als Saifallah nicht reagierte, wagte sich Raphael noch einen Schritt weiter. »Hör zu, Junge«, sagte er, »ich habe einen Teil meines Lebens in Nordafrika gearbeitet. Dort habe ich Arabisch gelernt und die Grundlagen des Islams kennengelernt. Das Wichtigste, was ich dabei erfahren habe, war, dass der Glaube im Herzen lebt und dass einzig Gott weiß, wie es darum bestellt ist. Wie kannst du also glauben, du wüsstest, wie es in meinem Herzen aussieht? Wie kannst du mich richten und ein Todesurteil über mich fällen?«
Saifallahs Verunsicherung wurde immer sichtbarer, er ging zum trotzigen Gegenangriff über. »Du bist ein halsstarriger Satan, das ist sicher!« Es klang etwas gequält und verriet eine Schwäche, was Raphael sofort ausnützte.
»Kannst du mir erklären, warum du den Fernseher zertrümmert hast? Gestern musstest du doch noch dringendst erfahren, was mit deinen Kameraden da draußen war.«
Sie sahen sich an, beide steckten in der Sackgasse. Etwas war in ihnen gerissen, und der Riss zeigte Wirkung. Jeder versuchte, die Abwehr des anderen zu durchbrechen, der eine mit dem Ziel zu entkommen, der andere mit dem Ziel, den Märtyrertod zu sterben und damit einen Platz im Paradies zu erwerben.
»Das Fernsehen ist der Agent des teuflischen Westens. Mit ihm erobert ihr die Welt und trichtert unseren Völkern eure Botschaften ein. Ihr macht uns süchtig nach euren Verlockungen, mit nackten Frauen, teuflischer Musik und Versprechungen eines Paradieses auf Erden. Ihr dressiert die Menschen damit und lockt sie in das Heer, das für den Unglauben kämpft. Die Arglosen, die mit schwachem Herzen und schwachem Glauben, geraten leicht in eure Schlingen. Darum haben wir, die wahren Gläubigen, die Pflicht, gegen euren Betrug zu kämpfen. Was auf dem Bildschirm gezeigt wird, ist nichts als eine Illusion, die ihr fabriziert, um uns einzulullen.«
»Meinst du wirklich, du habest das Paradies verdient? Du verkriechst dich hier und tust nichts anderes, als Drohungen gegen mich auszustoßen, statt den Kampf fortzusetzen und mit deinen Kameraden unterzugehen.«
Es war riskant, Saifallah auf diese Weise zu provozieren, aber zu Raphaels Überraschung sank der Junge verzweifelt und erschöpft zu Boden. In völlig verändertem Ton entfuhr es ihm: »Du klingst wie eine besorgte Mutter.«
Raphael setzte sofort nach: »Stimmt, niemand kann seiner Mutter entkommen. Wenn sie kein Vertrauen in uns hat, sind wir fürs ganze Leben gezeichnet, ein bloßer Schatten unserer selbst.«
Die leise Veränderung bei Saifallah ging weiter. Raphael spürte es. Die Brutalität wich einer spöttischen Gleichgültigkeit.
»Meine Mutter hat nie mit Schatten zusammenleben können, schwache Menschen waren ihr unerträglich.« Die Bitterkeit in Saifallahs Worten entging Raphael nicht.
»Konnte sie nicht?«
Die Antwort kam kaum hörbar. »Meine Mutter war unglaublich stark. Sie war unzerstörbar, unverwüstlich. Ihre Kinder mussten aus Stahl sein, so wollte sie es.«
Der Spott, mit dem er die eigene Mutter bedachte, erschreckte Saifallah, doch er konnte sich nicht bremsen. »Jetzt ist diese arme Frau ihre größte Sorge los: Mit diesem Nichtsnutz, den sie als Zwilling ihres Lieblingssohns aufzog, ist es bald aus.« Seine Augen funkelten irre, als blickten sie direkt hinunter in das Grab seiner Mutter. »Ist es ein Fluch, wenn man aus einem stählernen Leib geboren wird, als Schatten eines stählernen Zwillings?«
Raphael reagierte nicht. Er wollte nicht das Selbstgespräch unterbrechen, die unerwartete Selbstenthüllung Saifallahs.





























