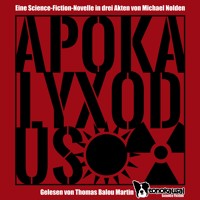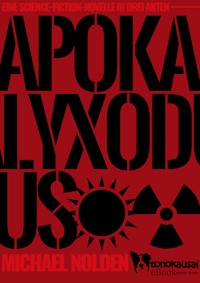Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SAVANT - Flucht aus Niger
- Sprache: Deutsch
Nathalie Pagnol, ihre Kinder Pascale, Claude und César, die Pflegeaffen, Ix, Vau und Zet sowie der UN-Mitarbeiter Eddie Trick und sein langjähriger Freund Bertrand Forbach befinden sich weiter auf der Flucht. Am zweiten Tag der Reise ziehen sie heimlich unter der Führung befreundeter Tuareg durch das Aïr-Gebirge, als die kleine Karawane, noch in der Nacht, aus dem Hinterhalt angegriffen wird. Über ihr Ziel lassen die Fremden keinen Zweifel. Ihr Auftrag lautet, einen der Jungen zu entführen. Aber keiner der Flüchtigen ist bereit aufzugeben...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SAVANT - Flucht aus Niger 2
TAG 2 [von 3]
von
Michael Nolden
Roman
Inhaltsverzeichnis
Titelbild
Titel
Danksagung
Kapitel 1: Dienstag, 9. Juni 2009, 0:00 Uhr
Kapitel 2: Sturz in die Finsternis
Kapitel 3: Im letzten Moment
Kapitel 4: Wieder auf dem Weg
Kapitel 5: Trügerische Sicherheit
Kapitel 6: Überhasteter Aufbruch
Kapitel 7: Libysche Soldaten
Kapitel 8: Eddie, der tragische Held
Kapitel 9: Samirs furchtloser Plan
Kapitel 10: Nathalies Scham
Kapitel 11: Bereit für den Gegenschlag
Rechtliche Hinweise
Impressum neobooks
Danksagung
Für meine Frau.
Kapitel 1: Dienstag, 9. Juni 2009 – 0:00 Uhr
[Eddie Trick]
Holy Shit! Der Schrei geht mir durch Mark und Bein, verdammt viel Bein, bis runter in den kleinsten Zeh. Ich bin sofort hellwach, von diesem Schrei – einer dieser Schreie, die man schon hört, bevor sie losgehen, weil das Atemholen davor das Inferno ankündigt. Ich greife nach vorne ins Nichts. Dass ich auf einem Kamel sitze, habe ich total ausgeblendet. Mit Schwung stoße ich gegen den Kamelhals, dann knallt mein Kopf karachomäßig gegen den Boden. Die Sterne, die ich sehe, funkeln mit denen am Nachthimmel um die Wette.
Die weiße Frau! – Whatever happened to Fay Wray? Jetzt weiß ich's. – Ihre Schreie gellen in kurzen, abgehackten Stößen aus ihrem weit geöffneten Mund. Vor ihr auf dem Kamelsitz windet sich der Junge voller Panik in ihrem Griff. Verschreckt krallt sich der Pavian in die Ohren des Wüstenschiffs. Das Reittier grunzt über die tierisch schlechte Behandlung in den nächsten Schrei hinein. Das ist nichts, das man hören möchte, wenn man heimlich in der Nacht unterwegs ist und unentdeckt bleiben will!
Gleich zwei Männer rennen zu ihr hin. Samir hat zu Beginn der Schreie die Zügel fahren lassen und zum Sprint angesetzt. Der Hausa, dieser Antoine, benachteiligt durch das sprunghafte Absitzen von seinem Kamel, setzt unserem persönlichen Aladin flink nach, überholt ihn noch. Er streckt die Hände nach der Frau aus. Sie gleitet sichtlich erschüttert in seine beschützende Umarmung. Kopf und Oberkörper zucken von einem Weinkrampf gepackt.
Samir, ein wenig von dem Hausa vorgeführt, will dem blinden Jungen helfen. Das Kind schreckt vor der Berührung des Targi zurück. Aufgeregtes Schnattern des Pavians hat ihn rechtzeitig gewarnt. Der Affe schnappt mit seinen stattlichen Reißzähnen nach Samir. Von hier aus sehe ich, wie der verschleierte Wüstenkrieger die Finger so eben noch zurückreißt. Klackend schlagen die Zahnreihen des Affen aufeinander. Geifer fliegt, ein feiner Sprühregen, von einem Affenmännchen, das sich gebieterisch und siegesgewiß auf dem Dromedar schüttelt. Samir droht ihm mit der Faust.
Die Frau drückt sich schluchzend an ihren Freund. Wie es scheint, sind die Kinder für den Moment vergessen.
Bertrand tritt fast lautlos neben mich. Er spricht meine Gedanken aus. »Das hätte ich nicht von der Frau gedacht. Sie war so – voller Selbstbeherrschung.«
Ich sehe ihn fragend an.
»Ganz gleich ob Mann oder Frau«, erklärt Bertrand, »hier draußen, in der Wüste, eine Weiße?« Das letzte Wort lässt ihn stocken, als habe er ursprünglich ein anderes verwenden wollen. Etwas wie Europäerin. Oder Idiotin. Weltverbesserin, denke ich.
Der Targi hat seine Hilfsversuche aufgegeben. An dem Pavian, der seinem Schützling auf den Schoß geklettert ist, ist kein Vorbeikommen. Samir geht an uns vorüber.
»Das Kind will deine Hilfe nicht«, stelle ich leise fest.
»Das Kind ist seltsam«, murmelt er. »Alle drei Kinder sind seltsam. Kinder bewacht von Affen? Auch seltsam.«
Ich nicke dazu. Mir ist bekannt, dass Tiere nicht selten helfen. In der Therapie. Blindenhunde. Mit Delfinen schwimmen, klar. Populäre Projekte mit Affen, davon habe ich ebenfalls gehört. Alles anerkannte Geschichten. Aber hier draußen? Da widerspreche ich nicht. Das ist in der Tat völlig seltsam. Weil so was nämlich teuer ist.
Die Frau trocknet ihre Wangen und stößt Antoine von sich. Die altbekannte Härte und diese Unnahbarkeit kämpft sich in ihre Miene zurück.
Der Hausa trollt sich. Keine Bemerkung zu ihrem Verhalten. Wow! Die kennen sich aber, so wie der das wegsteckt. Das Schauspiel wird allseits offensichtlich als beendet erachtet. Antoine, wieder bei seinem Kamel, tätschelt dem Tier beruhigend den langen Hals. Oben sitzt der ernste Junge, mit dem Affen, der mich an einen Schimpansen erinnert. Kleiner ist er. Und schlanker. Offenbar verstört, so hektisch, wie er auf dem Sattel um den Jungen turnt. Das Kind bleibt ruhig. Erst Antoine hält den zappeligen Primaten auf, streichelt ihm über die Unterarme, die Hände. Die sanften Gesten zeigen schnell Wirkung. Der Junge fängt den Affen ein, hält ihn fest.
Der vorn an der Spitze der kleinen Kolonne verbliebene Targi klatscht zweimal kurz in die Hände. Samir ist bei meinem Kamel stehengeblieben. »Aufsitzen, Mr. UNO!«
Ich beeile mich, sein Tonfall erzwingt es, doch dann verharre ich vor diesem taschenförmigen Fellknäuel mit dem – jawohl! – hässlichen Kopf und dem schief sitzenden Gebiss, so vorgewölbt, als sei es im Mittelalter mit der groben Kelle geschnitzt worden; es steht auf diesen merkwürdigen und dazu völlig unpassend dünnen Beinen, und ich weiß nicht, wie ich Samirs Aufforderung nachkommen soll, ohne mir das Genick zu brechen. Mein Nacken und mein Hinterkopf schmerzen immer noch.
Mittels leichter Klapse am Hals des Dromedars und tappender, ungeduldiger Tritte an den Vorderhuf des Tieres, bringt Samir es dazu, in den Knien einzuknicken, damit ich langes Elend mich hinauf in den Sattel quälen kann. Der Targi lächelt mitleidig über meine Ungelenkigkeit. »Mr. UNO, Mr. UNO«, flüstert er bedauernd. Keine Ahnung, was er mir sagen will. Hinter uns in der Reihe sitzt die weiße Frau längst auf ihrem Dromedar. Anscheinend ohne die Komödie mit dem knienden Kamel.
Unsere Gruppe wandert weiter durch die Dunkelheit. Der Schlaf holt mich, greift als beschissener, schauderhafter Nachtmahr nach mir. Soll es mich doch fressen ...
[Nathalie Pagnol]
Affengruppen sind häufig patriarchalisch organisiert. Ein großes und starkes Männchen steht der Horde vor. Mit seiner Erfahrung reagiert es umsichtig auf Gefahren und lenkt die Gruppe zu seinem und zum Wohle aller. So hat es die Natur vorgesehen. Der Anubispavian lebt in gemischten Gruppen. Das bedeutet, dass mehrere Männchen in einer Horde zusammenleben und nicht ein Männchen einem Harem aus Weibchen vorsteht. Aktive Kämpfe, von Zeit zu Zeit, oder auch bei Neuzugängen von außen, regeln die Rangfolge immer wieder neu. Allgemein gilt, dass das vorherrschende Männchen sich behauptet und die übrigen männlichen Tiere auf ihren Platz verwiesen hat. Ein solches Alphatier ist versiert im Kampf. Ist es älter, auf der Höhe seiner Kraft, genügt meist schon eine Drohgebärde, um potentielle und noch unsichere Herausforderer abzuhalten.
In jener Nacht, die mir deutlich vor Augen erscheint, besaß die Horde ein führendes Pavianmännchen, wie ich es noch nie zuvor und nie wieder danach gesehen habe. Sitzend mochte es einem normal gewachsenen Menschen zur Hüfte reichen. In den Schultern so muskulös wie ein menschlicher Athlet, verbreitete es durch seine imposante Erscheinung Angst unter den Männern, Frauen und Kindern des Dorfes, die ebenso wie wir aus ihren Hütten sahen und mit verzerrten Gesichtern ins Dunkel ihrer Behausungen zurückwichen, sobald sie Einzelheiten des Ereignisses erkannten.
Das Männchen starrte in unsere Richtung. Antoine reagierte, indem er das Messer höher hielt, ein sinnloser, ja, leerer Ausdruck von Hilflosigkeit. Der Pavian vergaß den für ihn harmlosen Mann in der Hütte und fixierte stattdessen ein anderes Ziel.
Die Geschwindigkeit, mit der die Affen den Gefangenen umschwirrten, auf ihm herumkletterten, ihn malträtierten, bissen und rissen, hatte etwas von einem Bienenschwarm.
Die schwarzen Knopfaugen des Anubispavians lagen unter einem schmalen Überaugenknochen. Sehr langsam bleckte der Affe die Zähne, gewaltige Hauer, natürliche Krummdolche, inmitten einem in einer theatralischen Pose geöffneten Maul. Speichelfäden zogen sich zwischen den Zahnreihen in die Länge, bis sie spritzend zerplatzten. Sein Blick war auf die Jungen hinter mir gerichtet. Ich drehte mich zu meinen Söhnen um. Seite an Seite standen sie nahe des Bettes und weitaus weniger ängstlich, als ich angenommen hätte. Unsere drei Affen, eng an sie gedrängt, zitterten unmerklich und mussten doch unter einer enormen Anspannung bei all den Ausdünstungen in der Luft stehen.
Es gab und gibt keinen fassbaren Beweis für meine Vermutung, wie ich sie jetzt nenne. In diesem Moment erkannte ich eine Verbindung meiner Jungen mit ihren ständigen Begleitern, dem von mir zusammengewürfelten Primatentrio. Und ich erkannte, dass sie ihm, dem Alphamännchen draußen, befahlen, dieses grausige Werk zu verrichten.
Einem Impuls folgend wedelte ich mit der flachen Hand vor ihren Augen herum. Die Kinder bemerkten mich nicht. Ich machte Antoine auf sie aufmerksam. Der schüttelte nur ratlos den Kopf, ehe ihn der nächste grauenhafte Laut zusammenzucken ließ. Ich stellte mich vor meine Söhne, kniete mich schließlich hin, umarmte sie alle drei auf einmal, verdeckte mit meinem Körper ihre Sicht auf das Massaker. Die Geräusche waren unbeschreiblich geworden. Ich kenne nichts Vergleichbares, noch will ich jemals wieder etwas wie in jener Nacht hören. In meiner Panik versuchte ich den Kindern die Ohren zuzuhalten. Jede neue Wunde am Körper des Mannes steigerte die Schreie in eine unerträgliche Sirene. Bald lag keine Pause mehr in seinem Schreien. Auf dem Gipfel der Marter, als ich wünschte, es würde endlich aufhören, vernahm ich eine Unterbrechung im Wüten der Paviane. Ich konnte nicht anders – meine Augen suchten die Szene auf dem Dorfplatz, wo das gewaltige Männchen einen Satz in den Pulk seiner Artgenossen tat. Bitte, dachte ich, rief nach diesem Gott, bitte, mach ein Ende. Aber nicht Gott ging dem Mann an die Kehle und zerfetzte sie. Es war ein rasch ausgeführter Biss, klammerartig, wie es Raubtiere machen, damit die Beute in jedem Fall stirbt, indem die Reißzähne die Luftzufuhr unterbrechen. Je mehr Ruhe in die Horde einkehrte, desto vernehmbarer war das Schnaufen des Alphatiers. Maul, Nase, Kinn und Mähne glänzten vom Blut des getöteten Menschen. Ich wollte die Jungen in einen Winkel der Hütte drängen. Von dort aus hätten sie das Gemetzel nicht sehen können. Doch es gelang mir nicht, sie auch nur einen Millimeter zu bewegen.
[Eddie Trick]
Wer soll bei dem schiffsähnlichen Geschaukel schlafen? Die Nacht lädt zum Schlaf geradezu ein. Es ist friedlich. Ein Hollywood-Regisseur könnte das Himmelszelt über mir inszeniert haben, prächtig strahlend, diamantenhaft funkelnd über einem Drittewelt-La-La-Land. Als kleiner Bub besaß ich ein Kaleidoskop, das diesen Ausblick vorweg nahm. Der hier ist zweifelsohne schöner. Genießen kann ich ihn nicht. Diesen Totentanz auf einem Kamelrücken!
»Psst!« Bertrand hebt die linke Hand.
Samir, nur wenige Schritte vor uns, dreht sich herum, sieht zuerst den Franzosen an, dann mich, der – wie er höchstwahrscheinlich denken wird – erneut verdammt quengelig aus der dreckigen Wäsche schaut.
Bertrand fuchtelt herum; das sehe ich aus dem Augenwinkel. »Psst!« Das Zischen klingt dringlicher. Nein, ich will mich nicht damit befassen.
»Verflucht!« Der Grandseigneur verliert die Beherrschung. »Bist du taub?! Willst du mich verärgern?!«, hallt der gepresste Ruf über die Karawane für Arme hinweg.
Ob ich ihn ver-ärgern will, fragt er mich. Frenchy, der Benimmspaßvogel!
Die Targi nehmen den Franzmann ernst und bremsen den bockigen Amerikadeutschen – mich – auf seinem Dromedar aus. Samir verhehlt seinen Unmut über Bertrands Ausbruch nicht. Sein Kamel muss es ausbaden und fängt sich einen ungeduldigen Hieb mit einer Reitgerte ein.
»Bin ich der einzige, der das hört?« Bertrand reißt die Arme hoch, in unbestimmte Richtungen, gen Himmel, hinaus aus unserem kleinen Tal, in dem wir seit einer Weile unterwegs sind.
Ich horche widerwillig. »Da ist nichts.«
»Habe ich als einziger hier Ohren?!«, zetert der Franzose nun ungehemmt los. Ein vielfaches Echo knallt auf uns runter. »Samir!« Die zweite Silbe schwillt hysterisch an. »Hörst du nichts?«
Mittlerweile reckt jeder unserer Reisegesellschaft das Kinn lauschend in die Höhe. Der blinde Junge hingegen nicht. Er schwenkt den gesenkten Kopf herum und erinnert mich an eine altmodische Radarschüssel auf der Suche nach Resonanz. Ich höre immer noch nichts, aber ich will mich versöhnlich geben. »Nein. Da ist nichts, Bertrand. Was soll denn zu hören sein?«
Wütend starrt mich mein französischer Freund an. »Ein Geräusch! Ein fremdes Geräusch. Wie von – Trommeln.«
»Trommeln?« Bei dem trommelt's woanders, schießt es mir durch den Kopf. Die Schlussfolgerung erspare ich ihm. Aus Respekt. Das Alter darf von Zeit zu Zeit ausrasten oder Mist plappern.
»Trommeln?« Samir ist frecher und grinst Bertrand dreist mitten ins Gesicht.
Ol' Blue Eyes setzt einige Schimpfwörter ab, ohne dass ich sie genauer verstehen kann. Alles hört sich besser auf Französisch an, es mag also angehen, dass er sich ein wenig abreagiert. Samir zieht Bertrands Kamel am Zügel weiter.
»Halt! Sofort anhalten!«, ruft die weiße Frau. »Wartet!« Der Blinde ergreift ihre Hand. »Mein Junge hört es – hat es – aber wusste nicht, was es ist –« Er flüstert ihr ein paar Worte zu. »Es ist – muss ein –«
Kein Trommeln! Im nächsten Augenblick wissen wir alle, um welches Geräusch es sich handelt: Das Rotorengeräusch eines Hubschraubers. Die drei Targi gehen mehrere Schritte und postieren sich außerhalb der Gruppe, so dass sie die Eckpunkte eines fast gleichseitigen Dreiecks bilden. Sie sehen in die Höhe. Kurz darauf zeigt einer in die Richtung, die ich für Westen halte.
[Nathalie Pagnol]
Wir haben uns, die Kinder, Antoine, sein Schwager Guillaume und ich, mehr schlecht als recht unter den Felsvorsprung gekauert. Er ist nicht sehr tief; ein notdürftiges Versteck. Wir hocken nebeneinander. Leider kann ich so nicht zu allen Jungen den gleichen Kontakt halten. Ich muss mich strecken, sonst erreiche ich Césars Haarschopf nicht. Mein Streicheln soll ihn beruhigen; es wird ein nervöses Zupfen daraus. Zwei der Targi sind mit reiterlosen Kameln weitergezogen, das Tal entlang im Bogen nach Osten, weg von dem konsequent nahenden Geräusch. Nur Samir ist bei uns geblieben. Ich mache mir keine Illusionen darüber, wer so spät in der Nacht die Mittel hat, einen Hubschrauber in die Wüste zu entsenden – auf der Suche nach – ich will mich – uns, die Kinder und mich, nicht in den Mittelpunkt der Welt stellen. Es kann durchaus eine Militärpatrouille sein.
»César?« Mein Sohn sieht mich an. Er ist viel nervöser als die anderen. Ix bemuttert ihn sehr, ein deutliches Merkmal dafür, dass mit dem Jungen etwas nicht in Ordnung ist. »Keine Angst«, flüstere ich. »Wir überstehen das. Unsere Freunde helfen uns. Sag es auch Claude.«
César nickt müde. Seine Gestik ist nicht mehr so geschwind wie noch am Tage. Claude verfolgt die Zeichen seines Bruders, in Ermangelung von ausreichender Beleuchtung nur über den Handrücken gestrichen. Seine versteinerten Züge versprechen mir eine stoische, hoffentlich ungespielte Tapferkeit. Claude drückt sich enger an die Felswand in seinem Rücken.
Das Rotorengeräusch erzeugt einen hohlen Widerhall im Tal. Nur Pascale scheint immer noch genau zu wissen, woher der Originalton uns erreicht. Er hat den Zeigefinger ausgestreckt und folgt mit ihm dem Knattern wie eine Kompassnadel einer magnetischen Feldstärke. Wenn das Geräusch für ihn hörbar näher ist, hebt er die andere Hand.
Samir rutscht an dem Franzosen und dem jugendlichen Kerl vorbei auf uns zu. Vor Antoine und mir richtet er sich in der Hocke auf. »Von oben nicht, fast nicht einsehbar. Das Tal. Wir müssen still sein.« Er blickt ins Leere, offensichtlich auf der Suche nach einem Wort. »Kann alles ein Zufall sein.«
Dieser hagere Gilbert-Becaud-Verschnitt legt den Kopf schräg. Er versucht, mit dem Amerikaner eine gedämpfte Unterhaltung zu führen.
»Lassen Sie uns teilhaben. Forbach, so war doch der Name?« Der Angesprochene kriecht näher. Sein Geruch weht ihm säuerlich voraus. Ich nehme an, ich rieche inzwischen kaum besser. César zieht die Nase kraus.
»Ich fürchte«, sagt Forbach, »dieser Hubschrauber hat ein Ziel.« Er lässt die Worte ausklingen und wartet.
»Was soll der Blödsinn?«, entfährt es diesem Trick, »schenk den Leuten reinen Wein ein! Wir haben keine Zeit für deinen Hinhaltequatsch!« Forbach klopft dem hinterdrein gerobbten Trick beschwichtigend auf die Schulter. »Ja, ja. Eine – befreundete Organisation, die in Tieren unterwegs ist, verwendet einen Hubschrauber. Um Großwild aufzuspüren.«
»Großwild?«, fragt Samir.
»Große Tiere«, führt der junge Mann aus. »Elefanten. So was.«
»Hier gibt es keine großen Tiere. Zu trocken.« Der Targi schaut nach oben. »Elefanten?!« Samir prustet leise.
Pascale winkt mit der linken Hand heftig vor meiner Nase herum. Ich greife nach seinen Fingern und halte sie fest. »Ja, Pascale, wir haben begriffen.«
Der Rotorenlärm hat an Stärke zugenommen. Wir pressen uns mit aller Kraft unter das natürlich Vordach des Felsens.
»Können uns nicht sehen.« Es liegt Zuversicht in der Stimme des Targi.
»Wenn es der Hubschrauber der Jagdgesellschaft ist, dann kann man uns von da oben entdecken«, meint der Franzose. »Nachtsichtgeräte. Wärmebildkameras. Gut zahlende Kunden, bestes Equipment. Glaubt mir, die können uns sehen!«
Samir zieht den Schleier vollends vom Gesicht. Hektisch schaut er sich um. Hier ist kein Ausweg. Steine zu allen Seiten, kein Schlupfwinkel, der uns allen Platz böte, nichts. Schließlich zeigt er auf einen kaum sichtbaren Spalt, dem ich keine Bedeutung beigemessen habe. Das Versteck liegt auf dem Weg, den wir eben heraufgeritten sind. »Ein Riss. Im Boden. Groß genug für die Frau und die Kinder.«
Pascale reißt sich von meiner Hand los. Sein Zeigefinger hat nun einen ganz bestimmten Punkt am nachtschwarzen Himmel anvisiert.
»Wieso die Kinder?«, höre ich den jungen Mann von der UNEP fragen.
Auf meinen fragenden Blick hin senkt Antoine das Kinn zur Bestätigung um Millimeter. Er packt sich Claude und César unter die Arme und rennt das Tal hinunter. Ix, der Schwarze Kapuzineraffe, und Vau, der Bonobo, laufen hinterher und haben die drei Menschen bald problemlos eingeholt. Ich nehme Pascale auf den Arm, meine Muskeln zittern unter seinem Gewicht. Zet hastet seitlich von mir auf den Unterschlupf zu. Atemlos passe ich mich seiner Geschwindigkeit an.
[Eddie Trick]
Lawrence von Arabien. Der Wind und der Löwe. Karthoum. Marschier oder stirb. Sahara. Zuletzt Hidalgo. Habe ich verschlungen und konnte nicht anders, als ich zum ersten Mal eine Sanddüne unter den Füßen hatte, einen Purzelbaum auf ihr zu schlagen, hangabwärts, während eines Urlaubs, überholt nur von einem übermütigen Sandboarder. Und hätte nie gedacht, selbst einmal im Zentrum eines Wüstenabenteuers zu stehen. Ansehen werde ich mir die Filme nie mehr. Nicht, weil ich glaube, hier zu – sterben. Sondern, weil – was soll das denn noch toppen?!
»Verteilen!« Unser Tuareg-Babysitter scheucht Bertrand und mich auf die gegenüberliegende Seite des Tales.
»Ja, ich laufe ja schon!« Jetzt bin ich die lahme Krücke. Bertrand hat einen meterweiten Vorsprung. Zu meinem Glück ist er nicht von der nachtragenden Sorte, packt mich am Arm und zieht, bis ich gleichauf mit ihm renne. Ich fühle mich wie Miss Prissy und er ist ein überforderter Foghorn Leghorn. Der andere Hausa – Guillaume? – schiebt mich an, drückt gegen meinen Rücken und macht echt Tempo. Halten mich alle für einen Tattergreis? Ich unterdrücke ein »Kacke«, hauche ein »Danke« an jedermann, der es haben will und hören kann. Ich hechte voraus über den Schotter in Deckung. Über uns wird der Rotorenlärm unerträglich, ein schwebendes, unabwendbares Unheil. Aus winzigen Verletzungen in meiner Haut quillt überall Blut. Es färbt die zerfetzte Kleidung in diesem Licht schwarz. Sand gerät in die Wunden und brennt wie Feuer.
»Komm«, zischt Bertrand gerade laut genug über die Lärmkulisse hinweg.
Ich krieche vorwärts. Die letzten zwei Meter zieht mich der Franzose in eine Höhlung, so niedrig, dass ich den Kopf im Sitzen einziehen muss.
Guillaume und Samir nehmen die restliche Fläche in diesem stickigen Hohlraum in Beschlag; ein Bild, als wollten zwei Schlangenmenschen in einer viel zu kleinen Zauberkiste ein gemeinsames Knäuel bilden. Wie mag es erst den anderen in dem Bodenriss ergehen? Und erst das Geräusch! Der Hubschrauber kreist da oben wie ein Geier aus Metall. »Wenn der Hubschrauber von der Armee ist? Bertrand? Kann doch sein? Wenn du dich täuschst?«
»Die Armee braucht jedes Teil. Die kann es sich nicht erlauben, einen Hubschrauber allein in eine entlegene Gegend zu entsenden! Ein paar tausend Mann sollen das Land beschützen. Die haben noch weniger Material zur Verfügung. Eddie, die trauen sich gar nicht hierher!«
»Und wenn du dich trotzdem täuschst? Wenn der Armeehubschrauber – gemietet worden ist? Samt Personal?«
Ol' Blue Eyes starrt geradeaus.
Ich kann es ihm ansehen, dass er daran gar nicht gedacht hat. Aber es liegt nahe. Jemand wie Maged Leroux, der so mit seiner Macht prahlt, würde ohne mit der Wimper zu zucken, nigrisches Militär bestechen. Er hätte die Mittel für ein fettes Bakschisch. Ich bin nicht wild darauf, Militärs in einem von Gott verlassenen Landstrich zu begegnen. Der Willkür irgendwelcher Soldaten ausgesetzt zu sein. Ausgeraubt. Gefoltert. Spaßeshalber. Zwerg Napoleon würde sie dafür bezahlen. Und dann? Verscharrt. Vergewaltigt – ich hätte Lawrence von Arabien nicht so oft anschauen dürfen. Der verstörte Blick von Peter O'Toole ist unvergesslich. Eingebrannt ins Gedächtnis.
Bertrand schüttelt schließlich den Kopf. »Nein, nein, wenn – wenn das Fluggerät zerstört wird, könnte es nicht ersetzt werden. Jemand käme in gewaltige Erklärungsnot. Nein, für kein Geld der Welt«, ruft er mir jetzt zu.
Staub wirbelt durch die schmale Öffnung in unseren Schlupfwinkel. Ich huste. Es fühlt sich an, als schnüre sich meine Luftröhre zu. »Dreck! Bertrand? Was soll denn das mit den Nachtsichtgeräten? Die sind doch dämlich da! Alles, was Ohren hat, ist doch längst untergetaucht.«
Bertrand beugt sich vor. Körnchen tanzen zwischen unseren Gesichtern. »Ja, und es läuft nicht weg«, sagt er laut, »es versteckt sich, das Wild. Aus Angst. Genau wie wir.«
Samir klopft auf meinen Unterarm, weist dann den ansteigenden Hang entlang in die Höhe. Der Rotor wird leiser. Dem abnehmenden Krach folgt das Gefühl der Enge. Die Teilchen in der Luft setzen sich, verdichten sich, sie legen sich auf die Zunge, die Schleimhaut der Nase, überall hin, ich schlucke sie, sauge sie ein, kann mich nicht dagegen wehren. Felskanten schneiden in meinen Rücken, ein Stein presst sich in meinen Nacken. »Ich muss hier raus!« Rasende Atemzüge befördern Schmutz in meine Nase, in die Lunge, alles, bloß keinen Sauerstoff. »Lasst mich raus!« Ich reagiere nur noch auf die Enge in der steinernen Kammer, die von den anderen abgestrahlte Hitze, den Schweiß, der alles miteinander verklebt. Ein Stoß befördert Bertrand halb von mir weg, ein Tritt kippt Guillaume zur Seite und verschafft mir einen Ausweg. Da hindurch wühle ich mich an dem Targi vorbei, keuchend, getrieben von einem Puls mit ungefähr einhundertachtzig Umdrehungen und dem Presslufthämmern in meinen Schläfen. Nach zehn Metern oder mehr wälze ich mich schwach über den Boden. Die Schmerzen werden nebensächlich. Luft. Atmen. Luft –
»Eddie? Alles in Ordnung, Eddie?« Bertrand sinkt neben mir auf die Knie.
Ich versuche mit trockenen Lippen gegen die Angst zu pfeifen. Das Ergebnis ist ein monotoner, arg dürftiger Laut. Der höchstens Angst macht. »Jetzt wieder.« Meine Stimme klingt nach Absteige, Vorhof zur Hölle, bedrohter, als wir es tatsächlich waren. »Tut mir leid. Ich bin da drin fast verrückt geworden.«