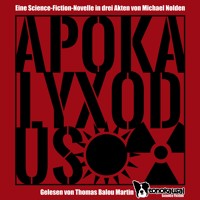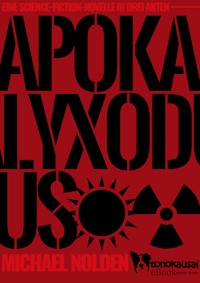Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: SAVANT - Flucht aus Niger
- Sprache: Deutsch
Nathalie Pagnol leitet für ein Schulprojekt der UNFPA (United Nations Population Fund) eine kleine Einrichtung in Agadez, Niger. Während sie die einheimischen Kinder unterrichten hilft, betreut sie gleichzeitig ihre eigenen Adoptivsöhne, von denen nur wenige eingeweihte Personen wissen. Die drei Jungen, allesamt anderer Nationalität, im Alter von 12, 11 und 10 Jahren, sind Autisten und besitzen außerdem eine sogenannte Inselbegabung, eine Fähigkeit, die sie zu etwas ganz Besonderem macht. Für die Pflege, auch um den "Gefühlspanzer" zu durchdringen, den die Jungen instinktiv aufgebaut haben, wurden drei Affen angelernt, ein Anubispavian, ein Bonobo und ein Schwarzer Kapuziner. Jeder Junge hat seinen ganz persönlichen Helfer. Eddie Trick, ein Mitarbeiter des UNEP (United Nations Environment Programme), soll sich in Niger ein Bild von den Auswirkungen des Uranabbaus auf die ansässige Bevölkerung und die Arbeiter machen. Mitten im Gespräch mit seinen ersten Kontaktpartnern bei den Tuareg wird er durch die Sicherheitsleute eines der hauptverantwortlichen Konzerne entführt. Sein ursprünglicher Ansprechpartner dort, Bertrand Forbach, ein langjähriger Bekannter, hatte ihn bereits vor dubiosen Machenschaften in der jüngsten Zeit gewarnt. Gemeinsam gelingt ihnen die Flucht. Auch Nathalie Pagnol und ihre Kinder geraten in Gefahr. Der jüngste ihrer Söhne, César, befindet sich nicht rechtmäßig in Nathalies Obhut. Man hatte dem Vater glauben machen wollen, sein Sohn sei verstorben. Nun hat er die Wahrheit erfahren. In der Befürchtung, Césars Talent werde ohne Rücksicht auf Leib und Leben des Jungen von dessen Vater ausgenutzt werden, tritt Nathalie mit ihrer kleinen Familie und der Hilfe einiger Freunde die Flucht an. Im Aïr-Gebirge treffen sie auf Eddie Trick und Bertrand Forbach ... in spätestens drei Tagen müssen sie das Land verlassen haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SAVANT - Flucht aus Niger
TAG 1 [von 3]
von
Michael Nolden
Roman
Inhaltsverzeichnis
Titelbild
Titel
Danksagung
Vorbemerkung des Autors
Vorbemerkungen von Nathalie Pagnol und Eddie Trick
Kapitel 1: Montag, 8. Juni 2009, 0:00 Uhr
Kapitel 2: Nächtliche Aktivitäten
Kapitel 3: Planänderung im Morgengrauen
Kapitel 4: Freunde und Feinde in Agadez
Kapitel 5: Durch die Wüste
Kapitel 6: Lektionen
Kapitel 7: Erzwungener Aufenthalt
Kapitel 8: It's quite safe
Kapitel 9: Furchtbare Erinnerungen
Kapitel 10: Nathalie trifft Eddie
Rechtliche Hinweise
Impressum neobooks
Danksagung
Für meine Eltern.
Die immer für mich da sind.
Immer an mich glauben.
Vorbemerkung des Autors
Es gibt Geschichten, die wachsen, auch solche, die bereits fertig erscheinen. SAVANT, mit dem Untertitel FLUCHT AUS NIGER, ist und war eine solche Geschichte. Zwar veröffentlicht, habe ich den Roman komplett überarbeitet. Die Neuveröffentlichung im Jahr 2020 erfolgt in drei Teilen, gemäß der drei vorhandenen Akte in der Geschichte oder, anders gesagt, im Takt der drei Tage, während derer die Handlung abläuft. Preislich wird sich im Resultat für den Leser nichts ändern. Ich habe außerdem die Möglichkeit, mit den Titelbildern zu spielen.
Niemand schreibt eine Geschichte, ganz gleich welcher Art, einfach so. Eine Motivation, eine Grundidee, ein Thema usw. gibt es immer. Für SAVANT gab es zwei Auslöser. Einerseits das Buch von NAOKI HIGASHIDA, WARUM ICH EUCH NICHT IN DIE AUGEN SCHAUEN KANN (Ein autistischer Junge erklärt seine Welt), sowie ein Zeitungsartikel mit dem Titel KLEINER AFFE, GROSSES WUNDER. Das Buch vervollständigte meine Recherchen für eine Geschichte, die Menschen mit besonderen Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen sollte. Sehr besonderen Fähigkeiten. Aber das alleine genügte mir nicht. Etwas fehlte. Nur wusste ich nicht genau, was das sein sollte. Besagter Zeitungsartikel über die Hilfsorganisation HELPING HANDS und ihr MONKEY COLLEGE in der Nähe von Boston an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika vervollständigte das Puzzle. Das durch Spenden finanzierte Programm trainiert Schwarze Kapuzineraffen als Helfer für Querschnittsgelähmte über einen Zeitraum von jeweils drei bis vier Jahren.
Eine Verbindung zwischen Mensch und Tier ist eine ohnehin spannende Angelegenheit. Menschen mit einer speziellen Wahrnehmung ihres Umfeldes durch Primaten für menschliche Kontakte zu sensibilisieren, reizte mich, hatten doch bereits auf diesem Gebiet ausgebildete Therapiehunde eine Machbarkeit dieser Idee bewiesen.
Langer Rede, kurzer Sinn, hier liegt nun der Neustart von SAVANT, FLUCHT AUS NIGER, vor. Einen weiteren Grund gibt es nämlich noch für die Überarbeitung. Die Geschichte mag mit drei Teilen zu Ende erzählt sein. Das Leben der hier agierenden Charaktere ist es noch lange nicht.
Michael Nolden, Mai 2020
Vorbemerkungen von Nathalie Pagnol und Eddie Trick
Sie besitzen Verstand; sie sind fähig zu rationalen Gedanken; sie können einfache Probleme lösen, in der gleichen Art, wie wir es tun. Sie sind sich ihrer selbst bewusst; sie haben einen Sinn für Humor. All diese Dinge, von denen wir glaubten, sie machten uns einzigartig – sie sind fähig zu Gefühlen, Freude, Trauer, Furcht, Verzweiflung.
Dr. Nathalie Pagnol Über ihre drei Affen Zet, Vau und Ix. Interview, Campus Radio, Harvard University, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika. Oktober 2011
Ja, scheiß die Wand an! Da komme ich mit dem Leben davon und soll mir jetzt hier einen einschenken lassen?! Wissen Sie eigentlich, was ich in den drei Tagen alles durchmachen musste?
Eddie Trick Bandaufzeichnung, aus ungenannter Quelle. UNEP, Büro der Vereinten Nationen, Nairobi, Kenia. August 2009
Kapitel 1: Montag, 8. Juni 2009 – 0:00 Uhr
[Eddie Trick]
Die Motoren der Propellermaschine jaulen auf. Sobald sich die fliegende Antiquität fängt, drückt mein Magen gegen die Kehle. An Schlaf ist nicht zu denken. Nicht bei den Turbulenzen, nicht bei diesem Lärm. Ein Hotel ist für die nächsten vierundzwanzig Stunden nicht vorgesehen. Am allerwenigsten so was wie ein Bett.
Ein Blick aus dem Fenster. Ist das schrecklich finster draußen! Lichtsmog? Gibt's hier nicht! Am Boden ist's jetzt tintenschwarz. Und der Klang in den Wäldern und Savannen! So fremd und so natürlich. In der Wüste! – Die Stille! Die ich in New York nur im Salzwassertank gefunden habe. Ich bin süchtig nach Afrika. Von der ersten Minute an bin ich's gewesen.
Die beiden Motoren spotzen, so ein unregelmäßiges Husten, wie bei einem Asthmakranken. Immerhin – ich hätte bei den Geräuschen erwartet, ein Feuer aus den Propellern schlagen zu sehen. Die anderen Passagiere, mehrheitlich Schwarze, reagieren gar nicht. Dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Das ist ein verdammt gutes Gefühl. Wenn auch ein beschissen kurzes.
Das Aufheulen, nicht zu verwechseln mit diesem mittelalterlichen Fauchen beim Start, vertreibt das Grübeln. Die Landeklappen fahren aus. Näher am Fenster, mit der Nase gegen das Glas gedrückt, sehe ich voraus eine schlecht erleuchtete Landebahn. Lichter blinken hintereinander auf, überspringen große Lücken. Viele Lampen sind ganz einfach kaputt. Weiter hinten glänzt ein orangefarbener Schein. Kein früher Sonnenaufgang, wie ein Greenhorn hätte annehmen können. Das müssen die wenigen Laternen in Maradi sein, eine der größeren Städte in Niger, die sich beleuchtete Straßen leistet. Beleuchtet wie im 19. Jahrhundert. Egal, ich werde sie ohnehin kaum genauer kennen lernen.
Wir setzen endlich auf! Ich hasse das Fliegen. Wie die Pest. Jedenfalls da, wohin sie all die Dinger verschachern, die woanders keine Flugerlaubnis mehr erhalten. Nie wieder, sag ich! Sag ich jedes Mal. Denn wie's scheint, gibt's hier nur diese verdammten, rostenden Grashüpfer.
Beruhig dich, Eddie! – Einmal schön gemütlich auf einem Kamel durch die Wüste – Eddie Halef Omar Ben ... immer langsamer rollt das Flugzeug auf seinen Abstellplatz. Der Pilot jagt noch mal Saft auf die Motoren. Ein todgeweihter Hirsch kann sich nicht furchtbarer anhören. Nach einem letzten Aufbrummen schaltet der Pilot die Maschine ab. Eine Flugbegleiterin öffnet die Außentür. Schwülheiße Luft jagt mit einem Satz in die Kabine, dringt kochend in die Lungen und raubt mir kurz den Atem. Es ist der Beginn der Regenzeit. Ich kann mich kaum an diese feuchtschwangere Luft und diesen brennenden Geschmack auf der Zunge gewöhnen.
Als ich die Leiter am Ausstieg des Flugzeugs hinunter geklettert bin, haben die übrigen Passagiere bereits zwanzig Meter Vorsprung auf dem Weg zur Abfertigungshalle. Ich folge ihnen äußerst träge. Zwei Wasserflaschen glucksen in meiner Umhängetasche. Ich trage immer zwei Stück mit mir herum. Zur Sicherheit.
Hell ist anders, wo mich die Einreiseformalitäten erwarten. Ein halbes Dutzend Soldaten hält sich in Sichtweite bereit. Da ist eine Unruhe in meinem Bauch, wie nach einem Luftloch und mit prickelnder Galle auf dem Gaumen. Ich reihe mich in die Warteschlange ein.
Ein paar abgefertigten, offensichtlich nigrischen Staatsbürgern folgend, legt ein Asiate seine Papiere ordentlich vor den Schalterbeamten hin. Der sitzt an einem vorsintflutlichen Schreibtisch. Der Modernität wurde mit einer kanzelartigen Abschirmung aus Plastik Genüge getan. Es sieht aus, als habe jemand einen Schrottplatz geplündert. Aus einem im Halbdunkel gelegenen Kämmerchen tritt ein Polizist hinzu und wirft sich hinter dem Schalterbeamten in Positur. Der Gesetzeshüter ist wie aus dem Ei gepellt. Es wäre kein Problem, den Mann gleich auf der 5th Avenue einzusetzen. Ihn wage ich noch anzusehen. An den Soldaten, traditionell im Camouflagestoff aufmarschiert, die polierten russischen Sturmgewehre locker vor der Brust getragen, schaue ich bewusst vorbei. Denn die machen mir eine Scheißangst.
[Nathalie Pagnol]
Ein neues Geräusch weckt mich! Dieses sachte Hämmern, ganz kurz nur, dem Anschlag auf einer Tastatur nicht unähnlich, genügte, damit ich aus dem Schlaf gerissen wurde. Und, als sei jemand ertappt worden und habe es bemerkt – sogleich erstarb es, so dass ich mich fragen muss, ob ich nicht etwas aus meinen Träumen mit in die wirkliche Welt gebracht habe. Das ist Afrika.
Ich sollte schlafen. Ich kann aber nicht. Im Schlaf jagen mich meine Träume. Ich sehe, wie sie mir meine Jungen wegnehmen. Pascale, Claude und César. Die übermächtige Angst angesichts des Verlusts der Kinder trifft mich jedes Mal mit der Wucht eines Sandsturms. Dann wache ich auf. Immer um diese Zeit. 0:30 Uhr. Immer. Ich stehe auf und achte wie stets auf die mir bekannten Laute. Gleich hinter mir im Hof höre ich das unergründliche Rauschen in den wenigen Ästen der unverwüstlichen Akazie. Der Wecker tickt vor sich hin. An der Decke flattert der Ventilator leise. Die trockenen Lehmwände melden sich wie in jeder Nacht mit diesem spröde klingenden Knacken, wenn die Kälte draußen daran nagt.
Ich gehe auf nackten Füßen durch den kleinen Schlafraum zur Tür. Mein Nachthemd schleift über den Boden. Leise drehe ich den Türknauf. Mondschein fällt durch eine milchige, stark zerkratzte Plastikplatte über einer Deckenöffnung. Fünf Türen sind im spärlichen Licht draußen im Flur zu erkennen. Drei liegen auf der linken Seite des schmalen Ganges, eine rechts, eine weitere geradeaus, hin zu einer Rampe. Diese führt zum Hauptgebäude.
Wir befinden uns nicht in einem richtigen Keller. Die Jungen und ich haben Fenster zum abgetrennten Hof hinter dem Anbau, der in einer Senke seitlich des wesentlich älteren Haupttraktes errichtet wurde. Leise gehe ich an den drei Räumen auf der linken Seite vorüber. Ihre Türen sind nur angelehnt. Durch einen breiten Spalt kann ich ins Innere spähen.
Pascale schnarcht im ersten Zimmer. Ich sehe seinen Kopf im Mondlicht. Zet hat mich gehört. Von seiner Liegestatt gleich neben dem Bett des Jungen schaut er über den Rand der Bettdecke zu mir hin. Ich kann mich blind auf ihn verlassen. Witternd hebt Zet den massigen Schädel. Im Zwielicht wirken die Bewegungen seiner Lider wie ein Zwinkern. Sein Gesicht taucht nach einem kaum hörbaren Schnaufen wieder hinter dem Bettgestell ab.
Eine Tür weiter, hinter der sich das Zimmer von Claude befindet, verbreitert sich der Türspalt bei meinem Näherkommen. Halb tritt Vau aus dem Schatten hervor, in den Knien sanft schaukelnd, eine Hand am Türknauf. Er legt den Kopf schräg. Vau ist der Clown unter den Dreien, die ich für meine Jungen ausgesucht habe. An der Seite von Claude ist er der richtige. Würde es Vau nicht geben, würde der Junge wahrscheinlich in Schwermut versinken. Auch Vau zieht sich wieder ins Zimmer zurück, nachdem er mich erkannt und festgestellt hat, dass nichts Außergewöhnliches den Tagesablauf stören wird.
Bei der dritten Tür versuche ich es auf Zehenspitzen, wohl wissend, dass es mir nicht gelingen wird, die Wachsamkeit des dritten Primaten zu überlisten. Und wahrhaftig schaut mir der kleine Kopf von Ix aus seinem Körbchen neben dem Bett von César entgegen. Das Schleifen des Nachthemds auf dem Boden, für mich kaum wahrnehmbar, ist bereits zu laut gewesen. Ix streckt mir die Zunge heraus.
»Au!«, jammere ich in der Sekunde darauf. Ein paar dornenbewehrte Samen haben sich in meine Fußsohlen gebohrt. »Au!«, entfährt es mir nun lauter.
»Cram Cram«, sagt eine jugendliche Stimme aus dem ersten Zimmer. Pascale ist wach. Sein empfindliches Gehör steht dem der Affen oft in nichts nach, übertrifft es manchmal sogar.
Die Grenze zur Sahelzone markiert ein Quälgeist, im Volksmund Cram Cram genannt, ein klettenähnliches Gewächs, dessen Samenkapseln mit dem Sand und Wind wandern, vom Tier im Fell, vom Menschen in der Kleidung über weite Strecken transportiert werden. Kleine Wunden können binnen kurzem zu einem eiternden Ärgernis werden. So wie der Sand in jede Ritze dringt, so findet Cram Cram seinen Weg in die Behausungen der Menschen.
»Cram Cram«, sage ich mit einem gedämpften Lächeln.
»Cram Cram«, wiederholt Pascale mit müdem Unterton.
»Schlaf, mein Schatz«, sage ich in die Dunkelheit, mehr gehaucht, als gesprochen, im Wissen, dass mein Sohn mich trotzdem hören wird.
[Eddie Trick]
Ich komme mir vor dem Schalter mit meinem weißen Arsch so völlig fehl am Platz vor, da steigt draußen vor der Halle eine alte Limousine in die Eisen, die Bremsen quietschen erbärmlich laut alles wach, was in einem Radius von einem Kilometer noch nicht schläft, so scheint es. Neben all den Beulen, den rostigen Löchern, den zigfachen Lackierungen muss auch mal ein deutscher Stern vorne auf der Haube geprangt haben. Sicher kann ich mir bei dem Ungetüm nicht sein. Ein Fahrer springt raus. Die Tür lässt er in seiner Hast offen stehen. Der Mann ist schwarz, wahrscheinlich, wie die anderen hier, ein einheimischer Hausa. Der Kerl schert sich einen Dreck um die Autoritäten mit den Knarren und rempelt sich an dem Operettenbullen vorbei zum Schalterbeamten. Ohne Punkt und Komma prasselt ein Wortschwall auf den Mann ein, so dass mir der Schweiß aus buchstäblich allen Poren ausbricht. Plötzlich stehe ich im Mittelpunkt eines Interesses, nach dem ich als Weißer in einem der schwärzesten Teile Afrikas nie verlangen würde. Am Ende seiner atemlosen Tirade gestikuliert der Fahrer in meine Richtung. Vermutlich soll er mich abholen. Er hätte sich diplomatischer ausdrücken können. Den Soldaten geht sein Geschwätz offensichtlich auf den Sack. Zwei von ihnen zielen schon auf ihn. Der Schalterbeamte winkt mich mürrisch nach vorne, an zwei anderen wartenden Reisenden vorbei. Verstecken kann ich mich weder mit meiner Hautfarbe, noch mit meiner Größe von 1,98 Meter. Sollte einer von den übrigen Anwesenden furzen, käme es bei mir oben gar nicht an.
Auf Französisch sagt der Mann zu mir: »Geben Sie mir Ihre Papiere!«
Ich gehorche, mache es respektvoll wie der Asiate, lege meinen Reisepass und meine UN-Papiere auf die Holzplatte. Eine Beamtenhand holt mit einem Stempel so weit aus, als wolle sie dem Ausweis einen linken Haken verpassen. Ich denke, er hätte dem Hausa lieber eine gescheuert und die völlig verschmierte Seite in meinem Pass muss es nun ausbaden. Die Dokumente, die mich als Angestellten der Vereinten Nationen legitimieren, will er gar nicht sehen. Für ihn ist die Sache erledigt.
»Kommen Sie!«, befiehlt mir der Fahrer.
Ich gehorche wieder, was sonst? Am Wagen angekommen, blafft der Mann etwas Unverständliches. Ich improvisiere, indem ich mir mit meinen Sachen im Fond der Limousine einen Platz suche, irgendwo zwischen flach gesessenen Zigarettenschachteln, leeren Plastikflaschen und zerknüllten Getränkedosen, augenscheinlich allesamt von Ausländern auf der rissigen Lederrückbank entsorgt.
»Hat Bertrand Forbach Sie geschickt?«, frage ich elektrisiert vom Eindruck der durchdrehenden Vorderreifen.
»Ich soll einen langen UNO-Mann holen!«, ruft mir der Fahrer munter zu. Erst als der Flughafen im Rückspiegel nicht mehr zu sehen ist, gewinnt er die Kontrolle über das schleudernde Fahrzeug vollends zurück.
In den Sitz zurückgelehnt, blicke ich hinaus in das nächtliche Maradi. Es geht langsam auf 1:00 Uhr zu. Ich bin über menschenleere Landstriche geflogen, und hier leben gut eine Viertelmillion Leute in einer Stadt zusammen. Die Sanddünen werden irgendwann an Maradi knabbern. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Trotzdem wollen die hier leben, Geld verdienen. Die Zeiten der großen Salzkarawanen durch die Ténéré, die gewaltige Wüste im Osten von Niger, sind lange vorüber. Wirtschaftlich ist längst der Bergbau die Haupteinnahmequelle des Landes. Darum bin ich nach Niger gekommen.
Der Job hat mich nicht gerade gelockt. Weil er Gefahr geradezu schreit. Gefahr! Tod! Nicht gehen! – Scheiße! Vor drei Jahren, also im Sommer 2006, hatte mein Amtsvorgänger Jason Rickles einen Versuch unternommen, sich mit Konzernhilfe in Arlit, nahe des Tagebaugebiets, ein eigenes Bild von der Lage zu machen. Auf Anfragen der UNEP, des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, meiner Behörde, waren – nennen wir es – verhaltene Reaktionen erfolgt, zudem hatte man versucht, Rickles hinzuhalten, sich dann aber nach Monaten bereit erklärt, einen Besuch von ihm nach besten Kräften zu unterstützen. – Und wie sie das taten! Die Einreise nach Niger führte Rickles zu Beginn des Jahres 2007 mitten hinein in einen Aufstand der Tuareg. Obwohl man es seitens der Begleiter Rickles' hätte besser wissen müssen, – denn einer sorgfältigen Analyse der Lage bedurfte es kaum, ein verfickter Schwachmatikus hätte die Zeichen erkannt – brach eine kleine Gruppe zur Besichtigung des Umlandes von Arlit auf. War es ein Test von Landminen gewesen, wie sie in den folgenden Monaten im dichter besiedelten Westen und Süden des Landes zum Einsatz kommen sollten? Oder ein verschissener Zufall? Das Resultat bleibt so oder so. Jason Rickles und zwei seiner Begleiter, ein Hausa und ein Franzose, verteilten ihre Eingeweide und den ganzen blutigen Rest auf der Wüstenstraße. Muss eine deftige Explosion gewesen sein! Ihr Wagen brannte völlig aus.
Wochen vergingen. Endlich fand sich ein an der Grenze zur Idiotie enthusiastischer Eddie Trick, – nämlich ich – aus Deutschland in die Vereinigten Staaten eingewandert, der bei den Vereinten Nationen in New York gearbeitet hatte und sich von seiner neuen Arbeitsstelle in Nairobi Abenteuer und einen Karrieresprung erhoffte. – Aber keinen verdammten Freiflug in die Hölle!
»Mein Name ist Boukari«, erklärt der Fahrer laut gegen den Motorenlärm. Sein Französisch klingt wie über ein Reibeisen gezogen. »Ich arbeite für Bertrand Forbach, wenn er in Maradi ist.« Boukari steuert die Limousine in Schlenkern durch einen mit vielen Schlaglöchern demolierten Straßenabschnitt. »Bin der beste Fahrer in Maradi. Sie können rauchen, wenn Sie wollen.«
Ich schubse eine der Zigarettenschachteln von meinem Oberschenkel weg. Mein Vertrauen in den Mann hält sich in Grenzen. Ich nicke dennoch dem dunklen Augenpaar im Rückspiegel zu.
Seitwärts wirbelt roter Sand vom brüchigen Asphalt hoch. Ein staubiger Geschmack belegt die Zunge. Minuten nach unserem Wortwechsel erreichen wir den Norden der Stadt. Nach der turbulenten Fahrt tritt Boukari in Schüben auf die Bremse und bringt den Wagen sanft, beinahe zärtlich vor einem weiß getünchten, zweistöckigen Gebäude zum Stehen.
Bertrand Forbach sprach in seiner Nachricht von einem Hotel für Ausländer, in dem er auf mich warten würde. Eher handelt es sich um eine Art Bar mit ein paar Zimmern in den Obergeschossen.
Boukari wendet sich zu mir um. »Wir sind da!« Seinem ausladenden Gestus entsprechend wird der Satz als regelrechte Verkündigung vorgebracht. »Da drin ist Bertrand Forbach.« Bilde ich es mir ein, oder ist der Name des Franzosen nicht mehr von derselben freudigen Erregung begleitet? Die Innenbeleuchtung der Limousine lässt Boukaris Augen trüb erscheinen. Der Mann ist einfach scheißmüde. »Er wartet«, sagt Boukari nicht ohne milden Nachdruck.
Ich reiche ihm fünf amerikanische Dollar nach vorne. Er streicht den Schein mit einem unterdrückten Lächeln ein. Wahrscheinlich glaubt er, mich übers Ohr gehauen zu haben, weil er in keiner Weise protestiert und die Angelegenheit über die Bühne bringen will, bevor ich es mir anders überlege. Landläufig betrachtet hat er soeben einen Durchschnittswochenlohn verdient. Ich klopfe ihm ohne jede Überheblichkeit auf die Schulter. »Danke«, sage ich, und meine es auch so.
Anschließend schultere ich meine Umhängetasche und steige aus. Der gesunde Menschenverstand – und die reichlichen, gut gemeinten Ratschläge von Kollegen – rät einem Weißen, sich nachts in einer schwarzafrikanischen Stadt nicht ohne Not auf die Piste zu wagen. Deshalb schaue ich den Rücklichtern des Wagens nur einen Lidschlag lang hinterher. Ich betrete das Gebäude. Ein alkoholisierter Hauch von Kolonialzeit schlägt mir entgegen. Ein Stimmengewirr aus mindestens vier verschiedenen Sprachklängen beherrscht den Raum. Englisch und Französisch erkenne ich sofort. Hausa, eine der wichtigen afrikanischen Sprachen, gelingt mir herauszuhören. Bei den Asiaten bin ich unschlüssig. Ich habe kein Ohr dafür. Es könnte japanisch, chinesisch oder koreanisch sein. Vielleicht alle drei. Keinen von denen hier anzutreffen, würde mich wundern. Die führenden Manager Asiens greifen immer weiter in die Ferne aus und wollen ein Stück vom Urankuchen Nigers abhaben. Erneuerbare Energien?! Das Zauberwort der Weltverbesserer rinnt hier durch die Finger und fällt auf unfruchtbaren Boden.
»Eddie! Eddie Trick!« Bertrand wühlt sich durch die qualmende, fluchend großspurige und saufende Meute, die in dieser Kaschemme Abermillionen hin und her schaufelt.
»Bertrand«, sage ich. »Bertrand Forbach!« Ich werde in einer Umarmung gefangen, danach auf beide Wangen geküsst. Ich beuge mich vor, ansonsten müsste sich der Franzose dazu auf die Zehenspitzen stellen. Er hat sich nicht verändert. Grau melierte Haare hatte er schon damals bei unserer ersten Begegnung in New York. Seine aristokratische Erscheinung, ein in Ehren gealterter George-Hamilton-Dracula aus dem Languedoc, die hagere Gestalt, die hart gemeißelten Gesichtszüge und eine mondäne Hauttönung sorgen dafür, dass der Spezialist für Public Relations unter Dutzenden anderer Menschen gleich ins Auge fällt. Selbst in diesem Haufen. Vor Jahren tingelte er als Lobbyist zwischen Paris, New York, Peking, Berlin, Tokio und Washington D.C. um die Häuser. Afrika bekommt ihm offensichtlich.
»Du bist ganz schön vorlaut geworden«, sagt er.
»Oui, Monsieur Forbach!« Ich grinse.
»Setz dich, setz dich. Mein Gott, Eddie, ist das schön dich zu sehen. Zuletzt - wie lange ist das her? Vier Jahre? Mein Gott! Setz dich doch. Trink was. Hier, das ist gut bei der Hitze. Keine Bange, kein Wasser. Nur gekühlt, kein Eis.«
Meine Nervosität zwingt mich dazu, mir den Whisky in den Rachen zu schütten. Ich habe Bertrand bei einem inoffiziellen Empfang meines ersten Arbeitsgebers in den Staaten, der UNDP, des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen kennengelernt. Damals war ich ein Greenhorn und habe ihm seine herzliche Masche noch abgekauft.
»Ich sollte gar nicht hier sein, Eddie. Was für ein Glücksfall!«
»Dass du hier bist?«
Er schmunzelt. »Gleich zur Sache?«
»Wir haben über die Einzelheiten telefoniert. Lange telefoniert. Und jetzt bist du hier. Als Feuerwehrmann?«
Bertrand winkt unbestimmt nach einem Kellner. Ein neues Glas, wieder zu zwei Fingern breit mit einer bernsteinfarbenen Flüssigkeit gefüllt, landet so schnell neben seiner auf dem Tisch liegenden Hand, als gelte es, einen Geschwindigkeitsrekord in Arschkriecherei aufzustellen. »Eigentlich sollte Maged Leroux, der führende Manager dieser Niederlassung ...«
»Von ARTAUD«, unterbreche ich.
»Inkompetenz ist mir peinlich. Das weißt du, Eddie. Das bringt mich zum Fremdschämen. Maged Leroux, ein gebürtiger Ägypter, hat sich bei ARTAUD hervorgetan, aber ...«
Ich will Bertrand nicht in Verlegenheit bringen. Und sollte ich gerade auf eines seiner Spielchen hereinfallen – scheiß drauf! »Bertrand, ich werde lediglich auf der Basis dessen, was ich vorfinde, eine Begutachtung durchführen. Personelle Probleme haben mich dabei noch nie interessiert. Ich bin fair«, betone ich.
»Das weiß ich.« Ein theatralischer Seufzer leitet den Schlussakkord ein. »Es geht einzig und allein um personelle Probleme. Es hat Vorfälle gegeben. Vorfälle, die es notwendig machen, im Sinne der Konzernpolitik, Maged Leroux auszutauschen. Paris hat mich zum Aufräumen geschickt.« Der Franzose gibt vor, nach den passenden nächsten Worten zu suchen. »Es fehlt nicht mehr viel, um die Tuareg verdammt wütend zu machen.«
»Du brauchst keinen Buhmann in den Ring zu schicken! Ich weiß, dass die Tuareg an den Gewinnen beteiligt werden wollen. Ihr speist sie mit einem Taschengeld ab.« Ich rücke meine Aufgaben im Geist zurecht. »Das ist eure Angelegenheit. Bertrand, es wird auf jeden Fall eine offizielle Untersuchung geben, egal, wie eure interne Situation aussieht. Leroux ist der UNEP völlig schnuppe.«