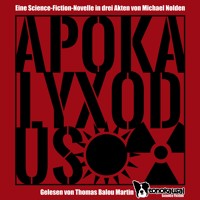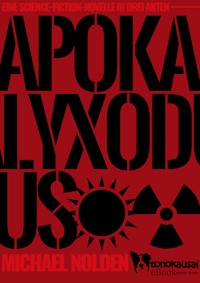Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: SAVANT - Flucht aus Niger
- Sprache: Deutsch
Am dritten Tag der Flucht: Nathalie Pagnols jüngster Sohn César wird entführt. Maged Leroux hat von den Fähigkeiten des Kindes erfahren und will diese für seine Zwecke nutzen. Mit der Hilfe neu gewonnener Freunde wie Eddie Trick, Bertrand Forbach, dem Targi Samir will Nathalie jede Anstrengung unternehmen, ihren Sohn zu retten. Gleichzeitig muss sie seine Brüder weiterhin beschützen. Da naht Unterstützung von unerwarteter Seite. Eine Horde Paviane schließt sich der Gruppe an...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SAVANT - Flucht aus Niger 3
TAG 3 [von 3]
von
Michael Nolden
Roman
Inhaltsverzeichnis
Titelbild
Titel
Kapitel 1: Mittwoch, 10 Juni 2009, 0:00 Uhr
Kapitel 2: Nathalies Erinnerungen
Kapitel 3: Sind das die Guten?
Kapitel 4: Willkommen in Arlit!
Kapitel 5: Schmerzen
Kapitel 6: Ortswechsel
Kapitel 7: Im Sturm
Kapitel 8: Die Rettung eines Freundes
Kapitel 9: Keiner bleibt zurück!
Kapitel 10: Attacke!
Kapitel 11: Eine kleine Geisel
Kapitel 12: Wo ist Leroux?
Kapitel 13: Im Gefecht
Kapitel 14: Die Verbindung
Kapitel 15: Zet, Vau und Ix greifen ein
Kapitel 16: Rache! Oder nicht?
Kapitel 17: Mitternacht
Kapitel 18: Epilog
Rechtliche Hinweise
Impressum neobooks
Kapitel 1: Mittwoch, 10. Juni 2009 – 0:00 Uhr
[Eddie Trick]
Rumpelnd, auf der Ladefläche eines Lastwagens, verlassen wir Timia. Ich weiß noch nicht, ob ich froh darüber sein soll, von der kleinen Insel glückseliger Zivilisation herunterzukommen, ganz gleich, was sie uns für Scherereien bereitet hat. Die Wüste lacht uns in der Dunkelheit aus. Selbst schuld, wenn ihr freiwillig in meine Arme zurückkehrt!
Andererseits? Besser weg hier. Wenn ich an die Paviane denke! Das ist doch mal ein Auftritt gewesen! So reif für Las Vegas, wie ich's für die Insel bin! Sie kamen, geiferten herum, wie als kleine King Kongs verkleidete Dschinnies im Dienste kleiner Jungens und brachten einen Haufen erwachsener Männer hinter Schleiern dazu sich einzupinkeln. Ich jedenfalls hätt's getan, wären sie noch weiter über die Dächer gekraxelt und hätten uns eingekreist. Aber jetzt sind sie weg. Keiner hat versucht, mir zu erklären, warum sie plötzlich aufgetaucht sind, noch warum sie wie die Staubgeister wieder verschwunden sind.
Die Targi schauen zu den Dächern und Seitengassen, sie führen Gespräche in ihrer eigenen Sprache, unverständlich für mich, und ich denke, auch für Pascale, der den Kopf in ihren Richtungen schwenkt, so oft er sie reden hört. Französisch reden die Targi untereinander kaum.
Nathalie sieht mich unschlüssig an. Und ich erwidere das zwischenmenschliche Looky-Looky, mehr hilflos und von den stechenden Schmerzen in meinen Fingerstümpfen gepeinigt, so dass ich glaube, mein Blick fällt einigermaßen daneben aus. Wie von einem langen Irren. Nicht wie von einem langen Mr.-UNO-Kollegen, der sie noch alle beisammen hat.
Begleitet von einem aufmunternden Lächeln setzt sich Nathalie neben mich. Achtlos legt sie die beiden Gewehre vor sich auf den Boden.
»Wie geht's?«, lautet meine sehr einfallsreiche Frage, obwohl mir ganz andere Fragen auf der Zunge brennen.
Sie schüttelt die langen weißen Haare aus dem Gesicht. In eher gequält klingender Tonlage antwortet sie: »Es geht.«
Selbst schuld, denke ich. Sei direkter. »Darf ich erfahren, was eben vorgefallen ist?«
»Eine Erklärung? Die hätte ich selber gerne. Es war nicht die erste Begegnung dieser Art. Begriffen, was da los war, habe ich trotzdem nichts.« Nathalie legt los mit einer Begebenheit aus der jüngeren Vergangenheit. Ein Kind war gestorben, und die Affen belagerten daraufhin das Dorf seines Stammes. Die nächtlichen Ereignisse von damals sind verdammt gruselig. Schauerlicher als eben dieser primatöse Line Dance. Ich will sie nicht erlebt haben. Daneben nimmt sich die nächste geschilderte Episode in einer Höhle wie ein harmloser Epilog aus. Und jetzt zuletzt der nächtliche Überfall sei die Spitze einer Entwicklung, die sie, Nathalie, nicht überschauen könne. Kämen die Tiere, weil sie gerufen würden oder suchten sie aus einer Art merkwürdigem Instinkt heraus die Nähe der Jungen?
»Mann! Ich meine – Wow! Nathalie, ich verstehe nur Bahnhof! Sonst nichts. Aber, wie auch immer, wir können alle von Glück reden, dass die Männer besonnen genug waren und keiner auf die Affen geschossen hat.«
Sie legt eine Hand auf meinen Unterarm und schiebt die andere unter meine unverletzten Finger meiner rechten Hand. »Es ist«, beginnt sie zaghaft. »Ich habe noch keinem Fremden außerhalb der Schule davon erzählt.« Nathalie schaut auf.
»Na, ja«, sage ich ein wenig beleidigt.
»Außenstehenden. Einem Außenstehenden«, korrigiert Nathalie.
Auf dem schaukelnden Lastwagen, von jeder Bodenwelle durchgeschüttelt, nun am Rande von Timia angelangt, kümmert sich keiner der Targi um unser Gespräch. Im spärlichen Licht erkenne ich den seitlich geneigten Kopf von Pascale. Seiner Mutter bleibt die neugierige Haltung ihres Sohnes nicht verborgen. Sie scheint in einer unheimlichen Melancholie versunken, als sie fortfährt: »Pascale kam zu mir, er kam zu mir, fand mich, da war er fünf Jahre alt. Ich selbst war zu dem Zeitpunkt noch nicht lange in Niger. Ich arbeitete bereits für die UN, aber wir hatten noch keinen Standort für unser Projekt gefunden. Man könnte sagen, ich lungerte zu der Zeit in Niamey herum. Die Stadt, sie war fremdartig. Und doch allem so ähnlich, was ich schon von der Welt gesehen hatte. Nigers Hauptstadt imitierte eine westliche Zivilisation, mit seinen Häusern, der herkömmlichen, einfallslosen Architektur und tupfte es mit Sand und Palmen, manchmal dichtem Straßenverkehr, dem nötigen Gestank und Krach. Dann gab es da das, was Niger ebenfalls ausmacht. Bunte ...«
Kapitel 2: Nathalies Erinnerungen
[Nathalie Pagnol]
»... Gewänder der Frauen. Frauen, die Körbe mit Einkäufen, mit Waren auf den Köpfen tragen. Gleichzeitig fahren Regierungslimousinen oder Konzernfahrzeuge an ihnen vorbei. Hier flattern die Kleider im Wind, dort geht ein in Europa herangezüchteter Wirtschaftsstudent in gestärktem Anzug und Aktentasche an einem vorüber. Wir sollten Kontakte knüpfen, das Land dadurch kennenlernen. Ich traf einen Mann vom Außenministerium.« Ich zögere. »Benoît Moussa«, sage ich, bevor die Pause zu lange dauert, »sehr europäisch eingestellt, im besten Sinne, wie ein englischer Butler, der eine französische Adelige zur Mutter hatte, nett, zuvorkommend ...«
Eddie blinzelt. »Moussa?«, fragt er. »Ich kenne den Namen! Ich habe ihn von ...«
Ich sehe ihn aufmerksam an. Ist das der Moment? An dem der Damm bricht? Oder eine Mauer auf der alten in die Höhe wächst? Es gab diesen Moment mit Antoine. Und ein paar ganz wenigen auf diesem Planeten. »Von wem?«
Da ist das schelmische, unverschämte Lächeln wieder. »Bertrand. Von meinem Freund Bertrand«, antwortet Eddie. »Er hat mir den Namen genannt. Ich solle ihn für den Notfall behalten. Er hat ihn mir ...« Seine Miene versteinert mitten im Satz. »Vorgestern genannt«, sagt er. Noch einmal das Lächeln. Aufgesetzter. Künstlich unverfroren. »Als ich noch alle Finger hatte.« Eddie strafft den Oberkörper, reckt das Kinn vor. »Gut«, meint er daraufhin, »ich kenne nur den Namen.« Eddie wirft einen Seitenblick über die Heckseite des Lastwagens auf die nachfolgende Kolonne.
Im zweiten Fahrzeug sitzen Samir und Bertrand Forbach im Führerhaus. Ihre Gesichter liegen im Schatten. Die fast verdeckte Beleuchtung des Armaturenbretts legt einen rötlichen Glanz auf ihre Kinnpartie.
»Bertrand kennt Moussa sicher persönlich. Kontakte sind das Alpha und Omega für ihn. Obwohl ich bisher keinen konkreten Nutzen bemerkt habe«, spricht Eddie weiter. »Wie man sieht.« Sein Kopf deutet mit einem Nicken auf die Ladefläche. »Wir wären sonst nicht hier.« Eddie wartet.
Ich bin wieder an der Reihe. »Benoît Moussa sollte Nigers Verbindungsmann zur UNPF sein. Ich verstand mich gut mit ihm. Wir trafen uns privat. Ich erzählte ihm von meiner Arbeit. Von meinem beruflichen Interesse an Autisten.«
Eddie mustert mich, äußert sich jedoch nicht.
»Nach ein paar Tagen rief er mich an. Es gehe um einen Jungen in seinem Heimatdorf, meinte er. Er wolle ihn mir zeigen. Es sei dringend. Am besten machten wir uns gleich auf den Weg.« Ich schildere meinem – ich denke – unfreiwilligem jungen Begleiter die lange Fahrt mit einem alten Geländewagen, den Benoît für viel zu viel Geld gemietet hatte. »Geld, das er eigentlich nicht besaß. Bei Einbruch der Dunkelheit erreichten wir das Dorf, nach einer Reise ins Landesinnere. Den ganzen Tag waren wir unterwegs gewesen. Benoît wurde sofort empfangen. Zwei aufgeregte Frauen zogen ihn zu einer Ansammlung von Hütten und einer Reihe von Grünpflanzen dahinter. Nichts Besonderes, keine richtige Oase. Nur Wasserlöcher. Selbst gegraben, mit schmutzigem Wasser, eine lehmige, schlechte Brühe. Bis auf eines. Die Frauen weinten. Vor dem letzten Wasserloch hatten ein gutes Dutzend Frauen Aufstellung genommen. Wie eine Phalanx, in Doppelreihe. Ein Mann schrie sie lautstark an. Der Hausa tigerte vor den Frauen auf und ab, drohte ihnen mit der Faust und stieß manchmal auch gegen eine von ihnen. Aber jede, die er schubste, tat sogleich einen Schritt nach vorn und demonstrierte Stärke. Ihre verkniffenen Mienen zeugten von großer Angst. Lange hätten sie das Spiel nicht mehr mitgemacht. Bei unserer Ankunft drehte sich der Mann um. Benoîts bedeutungsvoller Auftritt ließ ihn zurückweichen. Ein Mann in Anzug und Schlips in dieser Gegend? Offizielle sind in Niger, das kann ich bestätigen, selten ein gutes Omen. Die Frauen schienen aufzuatmen. Sie traten beiseite. Jetzt erst sahen wir noch zwei Frauen am Boden knien und jeweils mit einem Arm in die Grube hinuntergreifen. Sie rührten sich nicht von der Stelle. Sie hielten einen Jungen fest, zogen, schafften es nur nicht, ihn hochzuziehen. Von dem Jungen kam kein Laut. Er hing wie eine Puppe in ihren Fingern. Benoît half ihnen. Er packte das Kind an den Schultern und hievte es nach oben. Ich werde – ich werde niemals dieses Häufchen Elend vergessen. Benoît wechselte einige Worte mit den jetzt völlig hysterischen Frauen. Wie es sich herausstellte, hatte der Mann, der Vater ...«
[Eddie Trick]
»... versucht, den teilnahmslosen Jungen zu ertränken. Ersäufen!«, sagt Nathalie in tiefe Bitterkeit versunken.
Für den Vater sei das Kind ein nutzloser Nachkomme gewesen. Ein überflüssiger Esser, also eine Gefahr für das Leben in einem ärmlichen Dorf. Ein Sohn, der niemals heiraten, die Familie vergrößern oder für den Unterhalt der Familie sorgen würde. Ein körperliches Verderbnis, ein lebendig gewordener Makel. Der Vater sei deshalb angefeindet worden. Wie könne ein Mann ein solches Kind in die Welt setzen? Was hatte er angestellt? Wer hatte ihn verhext? Oder die Mutter? Dann hatte sich seine Absicht im Dorf verbreitet. Ein Ende mit Schrecken! Besser als ein Schrecken ohne Ende! Er hatte den Jungen aus der Hütte gezerrt, Frauen der Familie, die Mutter, niedergeschlagen! Aber es hatte sich etwas Unerhörtes ereignet! Andere Frauen widerstanden ihm. Die Tanten, die Mutter, eine Großmutter kam hinzu, von blauen Flecken gezeichnet. Und sie wehrten sich! Als Benoît Moussa die Nachricht um den Zustand des Kindes zuteil geworden war, über eine Stafette von Händlern aus der Gegend, die eine Strecke bis nach Niamey bereisten, hatte er rasch einen simplen Plan bei der Hand. Mich zu rufen. Hinfahren. Das Schlimmste verhüten. Der Vater floh. Beschämt, erniedrigt von Frauen! Kaum zu glauben! Moussa suchte das Gespräch mit dem Rest der Familie.
»Ich kümmerte mich um den Jungen. Was nicht leicht war, denn jede Fürsorge wurde mit Angst beantwortet. Er schrie nicht. Das kam später. Er wimmerte. In einer endlosen furchtbar traurigen Melodie. Sie wurde erst unterbrochen, wenn eine Entkräftung einsetzte. Atemlosigkeit. Durst. Seine Verletzlichkeit rührte mich. Seine Blindheit zu erkennen, dazu brauchte es nicht viel, keinesfalls einen Experten.« Nathalie denkt nach. Sie blickt in weite Ferne, weit, weit zurück. »Benoît bot mir an, den Jungen der Familie abzukaufen. Für einen Monatslohn.«
Meine Augen weiten sich vor Bestürzung.
»Ein nigrischer Monatslohn.« Ein Nicken unterstreicht ihre Feststellung. »Im Vergleich zum Rest der Welt, besonders Europa oder die Staaten, ist das ein Geschenk. Sie schenkten mir praktisch den Jungen für das berühmte Butterbrot.« Ihre Stimme erstickt. Sie hustet.
Eine Staubwolke hüllt uns ein. Wir passieren eine trockene Senke, fahren rund zwanzig Meter weiter eine Anhöhe hinauf, der eine stetige Berg- und Talfahrt folgt. Ein Gefühl wie auf einem Schiff macht sich in meinem Bauch breit.
»Zuerst«, erzählt Nathalie weiter, »fand ich keinen Zugang zu ihm. Über gar nichts. Ich fürchtete, ihn zu verlieren. Er aß so gut wie nichts. Trank kaum. Nach einigen Monaten, ich hatte ihn offiziell adoptiert, fiel mir ein Bericht in die Hände. Ich erhalte immer noch Nachrichten von früheren Kommilitonen. Darin hieß es, man trainiere Affen zur Pflege von Behinderten und Autisten. Von Hunden zu diesen Zwecken wusste ich. Blindenhunde, klar! Aber Affen?«
Sie redet schneller. Sie informierte sich über das Programm und seine Möglichkeiten. Gleichzeitig konzentrierte sie mehr Zeit auf den Jungen. Ein halbes Jahr darauf zeigten sich kleine Erfolge. Auf die Ängste folgte eine wachsende Liebe, ihre, später die von Pascale, der sogar den neuen Namen zu schätzen lernte und den alten offensichtlich vergaß – der ohnehin nur als Beschimpfung verwendet worden war. »Ungefähr zu der Zeit begannen mich die Hausa Geisterfrau zu nennen. Die auf den blinden Jungen, mit der seltsamen Art zu sprechen, aufpasst.«
Ich freue mich über das plötzlich aufblitzende Lächeln.
»Ziemlich genau anderthalb Jahre nach der Adoption traf Zet in Niger ein.«
Der Pavian hebt den Kopf. Die sofortige Reaktion ist bemerkenswert. Nathalie tätschelt beruhigend meine Hand.
»Er hat das beste Gehör aller drei Affen. Mit ihm fing das Training erst richtig an. Für die Schule blieb da gar keine Zeit mehr. Antoine hat mir viele meiner hauptsächlichen – die beruflichen Pflichten abgenommen. Meine anderen Kollegen ...« Neuerlich taucht sie in Schwermut ab. »Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Ob es ihnen gut geht? Ob sie noch leben?« Danach fällt Nathalie in ein unangenehmes Schweigen.
»Das war erst einer«, erinnere ich sie. »Pascale.«
Ein grüblerischer Ausdruck legt sich über ihr Gesicht. »Ja, Pascale«, meint sie nach einer kleinen Weile. »Sieben Jahre hat es gedauert, bis der Junge diesen Entwicklungsstand erreicht hat und er ein Potential entwickelte, wie ich es niemals ...« Mitten im Satz wendet sie den Kopf und sagt etwas, das ich nicht sogleich begreife. »Pascale, du musst auch ...«
[Nathalie Pagnol]
»... schlafen! Glaubst du, ich merke nicht, dass du lauschst? Das ist keine Bitte. Kein guter Rat. Zet und du, Claude, Vau und Ix, ihr alle müsst schlafen. Versucht noch zu schlafen.« Wie vermutlich viele Mütter sitze ich dem Drang der Wiederholung auf, in der Hoffnung, damit sorgenvoller zu wirken und eindringlicher für das kindliche Gemüt zu sein.
Eddie schickt verwunderte Blicke zwischen uns hin und her.
Antoine macht mit der Handfläche eine kreisende Handbewegung auf Claudes Kopf, unser Zeichen für Schlaf. Die Jungen gehorchen und ziehen sich in die Schatten der seitlichen Befestigungen zurück. Antoine umhüllt sie mit Decken gegen die nächtliche Kälte. Ihre Nasen schauen vorwitzig heraus. Zet und Vau sind unter den Decken anfangs noch unruhig, bis auch sie ihren Schlafplatz finden und in engem Körperkontakt zu ihren Schützlingen ruhen.
»Es funktioniert nur, wenn der Affe einen Freund in seinem jeweiligen Menschen sieht. Zet wurde hier angeliefert, begleitet von seiner Trainerin. Afrika machte ihn zeitweilig – verrückt. Die Gerüche, die Luft, Hitze, Kälte, Regen. Vielleicht wurden Urerinnerungen geweckt? Keine Ahnung. Zet ist in einem amerikanischen Zoo geboren worden. Erst nach und nach begriff er hier seine Rolle. Es ist eine Sache, den Primaten in einer künstlichen Umgebung zu dressieren und eine andere, ihn in seine Arbeitsumgebung unter realen Bedingungen zu entlassen. Normalerweise finden Annäherungen zwischen Affe und Schützling schon während des Trainings statt. Aus nachvollziehbaren Gründen war mir das nicht möglich. Der Aufenthalt der Trainerin drohte zu lange zu dauern. Zu teuer für mich. Das Geld.« Ich grinse unverschämt. »Ich hatte es meinem Vater für ein Auto abgeschwatzt. Ein Auto besitze ich in Niger bis heute nicht.« Die Berührung, seine Hand in der meinen, spüre ich mit einem Mal wieder, als hielten wir uns erst seit Sekunden. Seine Hand ist trocken, kühl, der Griff ist aufmerksam, nicht zu fest. Ich freue mich darüber, ihm aus meiner Vergangenheit zu erzählen. »Claude. Er kam zu mir, als hinter vorgehaltener Hand über die Frau mit dem seltsamen Jungen getuschelt wurde. Einmal nicht die Geisterfrau. Aber seltsam. Die Frau, die mich in Begleitung weiterer Frauen aufsuchte, war weithin bekannt. Wenn von der Targia gesprochen wurde, konnte nur sie gemeint sein. Saloua war beeindruckend. Sie verschaffte sich ein Bild von unserer Schule. Niemand, am allerwenigsten ich, hätte gedacht, dass sie einen Jungen in meine Obhut geben wollte. Pascale war damals drei Jahre bei mir. Claude, wie ich den neuen Jungen nannte, erinnerte mich in seinem Verhalten an Pascale. Bloß war er nicht blind, sondern taub. Er war nur wenig aufgeschlossener, konnte rudimentär lesen und benutzte eine Zeichensprache, die nicht mit den gängigen Ausdruckformen übereinstimmte. Ich beherrschte selber die echte Gebärdensprache nicht, lernte sie gemeinsam mit Claude, in dem Maße, wie er gleichzeitig, wenn auch langsamer, seine Fähigkeiten im Lesen perfektionierte. Pascale und Zet wurden mit in diese Abläufe integriert. Mit dem Lernprozess entwickelte sich eine Verbindung, die ich so nicht vorhergesehen hatte.«
Eddie legt schmunzelnd den Kopf schräg, als ich meine Rede unterbreche. »Ja?«, fragt er.
»Ich doziere schon«, antworte ich.
»Na, ja«, erwidert er lächelnd.
»Nein, nein, das darf nicht sein!«, sage ich energisch. »Klar, ich will, dass von den Jungen gelernt wird, dass ihr Lernfortschritt auch anderen Kindern hilft, aber – aber, nein, ich darf sie nicht so – so vorführen. Das darf nicht sein!«
»Das wirst du nicht«, sagt Eddie aufmunternd. »Ganz bestimmt nicht.«
»Ein halbes oder ein dreiviertel Jahr verstrich mit Lernarbeit. Jeden Tag, in aller Ruhe und Sorgfalt, und eines wurde nur allzu deutlich. Ein Affe genügte nicht. Zet war für Pascale da, wusste aber manchmal nicht genau, wie er sich verhalten sollte, wenn Claude Nähe suchte. Die Lösung lag auf der Hand. Ein weiterer Affe. Allerdings hatte ich kein Geld. Sollte ich meinen Vater um Geld für noch einen Wagen anpumpen? Bestimmt nicht. Mein Vater ist immer noch ein mit allen Wassern gewaschener Geschäftsmann, ein Idiot ist er nicht! Saloua ließ mir in unregelmäßigen Abständen durch einen Targi etwas Geld zukommen. Kleine Beträge, ausreichend für etwas Kleidung, zusätzliche Nahrung, ein bisschen Spielzeug. Besser als nichts, aber auf die Dauer kaum ausreichend.« Ich stocke. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weitererzählen soll. »Ich habe Gelder für die Schule veruntreut«, erkläre ich nach einer Weile kleinlaut.
Eddie reagiert mit einem leichten Achselzucken. »Na, und? Die UN jagt so viel Geld durch den Schornstein ...«
»Das macht es nicht besser! Diebstahl ...«
[Eddie Trick]
»... sollte nicht die Grundlage sein für ...«
Ich mag's nicht, überflüssiger Selbstkasteiung zuzusehen. »Für was? Für Hilfe? In Afrika überleben viele, weil sie sich zum Leben nehmen, was sie gerade brauchen.« Es ist eine bittere Erkenntnis, die da, ohne großartig nachzudenken, aus meiner vorlauten Klappe kommt.
»Ist gut«, sagt sie. »Ist schon gut.«
Übermüdet wie ich bin, um gut 2:00 Uhr nachts, trotz des Gesöffs von Samir, posaune ich meine gesammelten Weisheiten aus. »Wenn weniger verschwendet würde, wenn es bei dir gelandet wäre, dann ...«
»Ist schon gut«, sagt Nathalie erneut und drückt meine Hand. »Lieb von dir.«
Die Lichtkegel der Fahrzeuge entreißen der Landschaft ringsum Einzelheiten. Scheibchenweise tauchen sie aus dem Dunkel auf. Viel gibt es nicht zu sehen. Das da draußen, so karg, trist und rot unter den Scheinwerfern, könnte ebenso gut die Marsoberfläche sein. Nur Krater von Meteoriteneinschlägen fehlen. Nathalie gibt meine Hand frei, und ich falle in eine Art emotionalen Schockzustand.
»Darf ich weitererzählen?«, fragt sie beinahe schüchtern.
»Ja. Natürlich, natürlich.«
»Claude war anders. Ernster, nicht so verspielt. Pascale war zu Anfang ähnlich. Als sich die Sperre löste, wurde er fröhlicher. Claude nicht. Er war ernst und blieb ernst. Ich nahm an, er käme nach seiner Mutter.«
»Saloua?«
Die Geisterfrau schweigt einen Augenblick. »Ja.« Sie ringt sich ein spöttisches Grinsen ab, ganz und gar nicht Mutter-like. »Genetisch motivierter Firlefanz. Er konnte einfach nur ernst geraten sein, weil er in eine stumme Welt geboren wurde.« Sie nickt sich eine eigene Bestätigung zu. »Er war ein sehr aufmerksamer Junge. Aus heutiger Sicht war Pascale genau richtig für ihn. Jemand, der diesen Weg bereits gegangen war und eine gewisse Sicherheit bot. Aber! Der Affe! Über Umwege fand ich einen neuen Helfer. Keinen Pavian diesmal. Es wäre mir recht gewesen, aber ein Experte riet mir davon ab. Ich entschied mich für einen Bonobo. Ein für Zet artfremder Primat. Arteigene Rivalitäten entfielen so, und ich glaubte, Vau, wie ich ihn nannte, werde sich Zet ganz selbstverständlich unterordnen. Nun hatte ich Erfahrungen gesammelt. Affe pflegt, hilft Mensch. Doch – Affen pflegen, helfen in der Gruppe. Das war Neuland. Und das ist es noch. Es gibt weltweit nichts ...«
[Nathalie Pagnol]
»... Vergleichbares. Es dauerte einige Monate. Es kehrte Ordnung in mein kleines System ein. Ich weiß, Kinder und Ordnung passen schlecht zueinander. Im Regelfall. Pascale und Claude, die beiden Affen, sie benötigen besondere Regeln, eine rigorose Ordnung, einen organisierten Tagesablauf. Das gibt ihnen, neben der Ordnung in Räumen, im eigenen Zuhause, Sicherheit.« Ich rufe mir die damaligen Ereignisse ins Gedächtnis. »Antoine merkte es eher als ich. Wie sehr mich meine – Arbeit auffraß. Es war eben nicht nur Familienleben. Die Nächte wurden immer kürzer. Es gab Tage, an denen ich überhaupt nicht ins Bett fand. Irgendwann kam der Zusammenbruch. In dieser Phase, in der ich mich am Boden glaubte, meldete sich Benoît Moussa bei mir. Meine Panik! Du kannst sie dir nicht vorstellen! Ich – er stand im Eingang der Schule, und ich dachte nur an die Adoption. War sie unrechtmäßig? Wollten die Behörden mir den Jungen wegnehmen? Hatte der Vater interveniert? Die Mutter? Doch nichts dergleichen!« Die Erinnerungen sind so übermächtig, dass es mich fröstelt. Für mich ist keine Decke mehr da. In der Hoffnung, so Wärme zu finden, lege ich die Arme um mich. »In unseren Büroräumen gab sich mein nigrischer Freund ganz entspannt. Von dem, was ich befürchtete, keine Spur. Im Gegenteil. Benoît brannte die Zeit unter den Nägeln. Also kam er Minuten nach seiner Ankunft zum Anliegen seines Besuchs. Ein Junge brauche meine Hilfe.«
Eddie runzelt die Stirn. »Ein Junge? Benoît Moussa hat dir gleich zwei Jungen vermittelt?«
»Vermittelt? Nicht wie es von anderen Ländern her gebräuchlich ist. Ich wollte ihm sagen, ich habe keinen Platz. Keine Luft mehr für ein weiteres Kind. Aber ich sagte natürlich, er solle mir mehr erzählen. Ein paar Tage darauf trafen wir uns in Niamey. Ein einfaches Haus erwartete uns von außen. Von innen war es pompös ausgestattet. Bedienstete, ausschließlich Frauen, ältere Frauen und eine Dame des Hauses, die in meinem Alter war, kann sein auch eine Handvoll Jahre älter. Sie ließ Benoît reden. Er stellte sie als ...«
»Ja?« Höflich wartet Eddie ein paar Atemzüge ab, bevor er nachfragt. »Ist alles in Ordnung?«
Ich wackele nervös mit dem Kopf. Ein Nicken ist es nicht wirklich. »Die Frau hatte einen Sohn. Noch eine Schande. Auf die eine oder andere Art sind sie immer eine Schande, eine Bürde, eine Last. Sie hielt sich im Hintergrund. Schlank und zierlich, recht groß. In ihrem Seidenkleid wirkte sie auf mich wie eine Statue, ganz glatt und unecht. Daneben kam ich mir grob, wie unbehauen vor. Benoît erklärte, sie sei die Dame des Hauses. Sie habe einen Sohn, der eine besondere Belastung für sie sei, da er sie vor ihrem Mann in arge Schwierigkeiten bringe. Benoît sprach wie ein Museumsführer. Sie liebe ihren Sohn und wolle ihn in guter Obhut wissen. Dazu gelte es, das Kind vor der Raserei ihres Mannes in Sicherheit zu bringen. Ich hörte bloß zu. Es stehe Geld zur Verfügung, eine großzügige Summe, eine Einmalzahlung von zehntausend Dollar. Für hiesige Verhältnisse ein unglaubliches Vermögen. Man muss hier nicht weit fahren, um deshalb die Gurgel durchgeschnitten zu bekommen.«
Eddie sieht mich lange an. »Darf ich raten, wie der Junge hieß?«
[Eddie Trick]
»Ayman?« Gespannt warte ich auf ihre Reaktion. Als nichts geschieht, Nathalie sich in ihrer Rolle als reglose Figur zu gefallen beginnt, unbehauen oder nicht, halte ich absichtlich meine verletzte Hand in die Höhe. Die braunen Flecken, das Blut, das durch die Bandagen gesickert ist, sind mein Pfand für mehr Informationen. Ein zittriges Lächeln ist die erste Antwort, und ich schäme mich für dieses Bauernspielchen.
»César«, lautet die zweite Antwort, mit extra fester Stimme gegeben.
»César«, sage ich tonlos. »César ist Ayman. Dann ist César ...« In rodinscher Haltungsqual verfalle ich in grüblerisches Schweigen. Natürlich ist da eine Ahnung. Bertrand, mit seiner überquellenden Lust an pikanten Details, hätte die Pointe längst erraten. Nathalie soll den Satz vollenden.
»Der Sohn von Maged Leroux.« Nathalies Stimme ist ein Hauch. Getragen von Angst. »Du hast gesehen, welche Macht er besitzt ...«
»Macht?«
»Ja, Macht. Er schert sich nicht um Gesetze!«
»Ich habe genug von diesem Kontinent gesehen, um das zu wissen. Ich habe Maged Leroux persönlich erlebt, um das zu wissen. Leroux schert sich um Leroux. Sonst nichts.« Das ist null, nada, nothing von beruhigend, soll es aber auch nicht sein. Ich will nur diese Jammerei brechen. Das häuft sich schon reichlich auf der anderen Seite der afrikanischen Waagschalen. Und macht's denen mit Macht leicht. Jammerer wehren sich nicht.
»Damals«, nuschelt Nathalie gegen den Fahrtwind, »wusste ich nichts von einem Maged Leroux. Ich kannte kein Bild, hatte niemals den Namen gehört. Die Frau machte auf mich den Eindruck einer typischen Reichen ohne eigenes Vermögen. Gemäß des Glaubens oder einer Interpretation desselben, einer der vielen Auslegungen, derer man irgendwann müde wird nachzufragen, befahl sie solange im Haus, wie der Mann nicht da war. Unbewegt hörte sie den Ausführungen von Benoît zu, auf Französisch, wie er mich und meine Fertigkeiten empfahl, mein Einfühlungsvermögen bei Kindern mit einer unüblichen Entwicklung, wie Menschen ihres Schlages es als solche empfinden. Während des Monologes hatte ich den Jungen nicht zu Gesicht bekommen. Wenig später wurde der Kleine in einem Rollstuhl sitzend hereingeschoben. Inmitten des Protzes, des goldenen Prunks, der Möbel aus rötlichem Holz, der Wandbehänge, dieses orientalischen Ambientes sah der Junge völlig fehl am Platz aus. Er sah aus – ja, sah aus, als ob er sich in sich selbst verkriechen wollte, um noch winziger und unsichtbarer zu werden.«
Jeder verlorene Satz ließ die Krümmung ihres Rückens schwinden. Von Wort zu Wort saß sie aufrechter da. Die Erinnerungen waren Ballast, den sie ungeteilt in sich hineingefressen hatte. Vielleicht hatte sie die Jungen deswegen so gut verstehen können? Als kindliche Spiegelbilder.
»Benoît hatte der Frau von meinen Bemühungen berichtet. Ohne Namen zu nennen. Genauso wenig erfuhr ich ihren Namen an diesem Tag. Es gehe einzig um das Wohl des Kindes, konstatierte Benoît, ganz ausgebildeter Diplomat. Sie hörte zu, ich hörte zu. Ich nickte immerhin. Sie war und blieb eine Eisheilige. Ich wollte eine Reaktion sehen, doch es hatte den Anschein, als habe die Mutter schon mit César abgeschlossen. Sie sah stur geradeaus, hin zu Benoît, der meisterlich die Geschichte weiterspann. Man werde dem Vater berichten, das Kind sei verstorben. Er versicherte mir, der Vater habe zu Lebzeiten des Kindes kein rechtes Interesse gezeigt, also warum, so die kluge Schlussfolgerung, sollte er sich im Todesfall kümmern? Ich stand versteinert da. Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. In Gegenwart des Jungen! Diesen Menschen standen alle Mittel zur Förderung ...«
[Nathalie Pagnol]
»... des Jungen zur Verfügung! Aber Benoît ging noch weiter. Eine offizielle Adoption werde demnach nicht erfolgen. Er versprach mir stattdessen, dass niemals jemand nach dem Kind suchen werde. Der Vater werde den Tod des Jungen nicht bedauern, noch werde er ihn vermissen.« Ich wende mich Eddie zu. »Unter diesem Bombardement der Herzlosigkeit rührte sich – César – gar nicht. Ich kniete mich vor ihn hin und versuchte in seine Augen zu sehen. Als ich nach seiner Hand griff, damit ein erster Kontakt entstand, zuckte er zusammen und jammerte mit Worten, die wie Worte klangen und ich doch keiner Sprache zuordnen konnte. Mir schwante, dass der Junge überhaupt nicht richtig sprechen gelernt hatte. Man war mit ihm wie mit einem Gefangenen verfahren, hatte ihn in ein graues Hemd, eine graue Hose und kleine schwarze Schuhe gesteckt. Alles war viel zu groß für ihn und schlotterte an ihm herum. Ich versuchte ihn anzusprechen, er rümpfte bloß die Nase. Ich fragte Benoît nach dem Jungen, Einzelheiten, Gesundheitszustand, Alter, Geburtstag. Das meiste blieb unbeantwortet. Benoît holte sich die Informationen in einem leisen Gespräch von der Mutter. Ich kann nicht sagen, dass ich ihre Stimme gehört hätte. Ich betrachtete sie von unten herauf. Der Gegensatz zwischen uns war dramatisch. Pechschwarzes Haar. Weißes Haar. Dort die – Rabenmutter. Hier die – Geisterfrau. Ich verzichtete auf jede weitere Frage. Ich nähme das Kind in meine Obhut, erklärte ich Benoît. Unter der Voraussetzung, es käme nie wieder zu einem Kontakt. Niemals! Meine Worte drangen zu der Frau durch, deren Augen feucht zu schimmern begannen. Bevor die Tränen offensichtlich wurden, drehte sie sich um und marschierte aus dem Raum. Benoît schaute ihr sprachlos hinterher. Das war eine bedrückende Szene für ihn wie für mich.« Wie bedrückend es war, merke ich heute noch. Mein Atem stockt. »Die Angestellten brachten Kleiderbündel, alles schmucklos, farblos, mit einer Kordel zusammengebunden, häuften sie in Benoîts Arme und auf den Schoß des Jungen. Mir gaben sie noch ein Paar verstellbarer Krücken in die Hand. So beladen geleiteten sie uns zum Hintereingang, durch den wir auch das Haus betreten hatten. Jemand hatte einen alten Schulbus oder etwas ähnliches organisiert. Die Fenster waren mit Vorhängen verdeckt. Wir bugsierten uns durch die Hecktür hinein und wurden zur Stadt hinausgefahren. Der Fahrer sah nur ab und an im Rückspiegel nach hinten. Benoît mahnte mich zur Ruhe. An einer Hütte am Stadtrand von Niamey setzte man uns ab. Benoît rief mit einem Mobiltelefon einen anderen Wagen herbei, diesmal sogar ein offizielles Ministeriumsfahrzeug. Ein Anzeichen für mich, dass er mittlerweile in der Hierarchie nach oben gefallen war. Der Fahrer des Wagens machte sich zu Fuß auf den Rückweg. Oder rief sich ein Taxi. Ich weiß es nicht mehr. Mir brannten unbeantwortete Fragen auf der Zunge. Natürlich war ich neugierig! Wer war die Mutter? Wer der Vater? Welche Nationalität besaßen sie? Sie stammten nicht aus Niger. So viel reimte ich mir zusammen. Ich traktierte Benoît mit meinen Fragen. Und der arme Kerl wurde zusehends nervöser. Obwohl wir uns kontinuierlich von Niamey entfernten. In die vermeintliche Sicherheit. Er klappte die Sonnenblenden herunter. Tastete das Fach für die Sonnenbrillen ab. Fingerte um den Sitz herum. Er suchte – ja, was? Wanzen? Damals hielt ich es für eine lächerliche Vorstellung. Heute klingt es nicht mehr so abwegig. Ägypter. Kurze und knappe Antwort. Das gab Benoît von sich, als habe es sich um ein Versehen und keine Antwort gehandelt. Anschließend gab er sich redseliger. Eine gute halbe Stunde lang habe ich ihm Informationen entlockt. Wie lange die Familie in Niger lebte. Und warum. Was der Vater in Niger tat. Arbeitete. Denn die Frau tat es ganz offensichtlich nicht. Wer der Vater – war.«
»Maged ...«
[Eddie Trick]
»... Leroux«, sage ich leise.