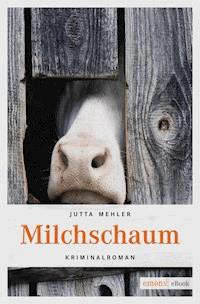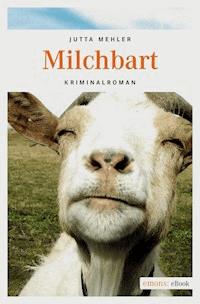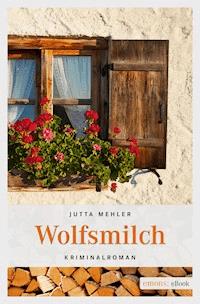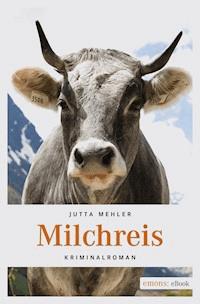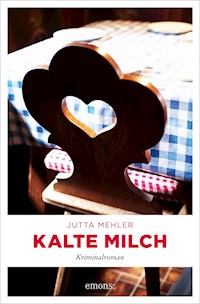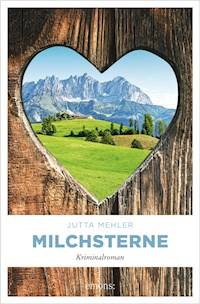Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nordöstlich der Donau, unter den Vorbergen des Bayerischen Waldes, liegt das Ein-paar-Hundert-Seelen-Nest Klausenstetten. Das Dorfleben ist geprägt von Frömmigkeit und Glauben, am meisten jedoch von Aberglauben. Die Dörfler wohnen, arbeiten und feiern hier seit Jahrzehnten in zänkisch-kontroverser Eintracht; sie sind stur, engstirnig und traditionsbesessen. Paula ist anders. Paula denkt selbständig, ist klug, empfindsam und realistisch - aber sie fühlt auch empathisch, hört und sieht, was anderen verborgen bleibt. Paula beschäftigt sich mit der uralten Kräuterkunde, mit Numerologie und befragt die Tarot-Karten. Doch wenn Entscheidungen zu treffen sind, fragt sie ihren Verstand. Paula ist unvereinbar mit der heimischen Wesensart, und doch ist sie unentbehrlich für das Dorf. Eine Frau zwischen Aberglaube und Autonomie - spannende Zeitgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieser Roman basiert auf tatsächlichen Ereignissen. Die Figur der Paula und ihre Geschichte sind in weiten Teilen authentisch. Paulas Familie und einige Schauplätze sind ebenfalls teilweise authentisch, wenn auch weitgehend verändert. Alle anderen Personen und diverse Nebenschauplätze sind frei erfunden; sollten sich hier Ähnlichkeiten mit wirklichen Menschen oder wirklichen Geschehnissen ergeben haben, wären diese zufällig und keinesfalls beabsichtigt.
© 2014 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Ulrike Strunden eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-560-0 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Paula
Teil I
1.
»13. Mai 1963, 16.00 Uhr. Großeinsatz derFFW. Brand bei Schredereder, Hofstelle.«
So lapidar wird die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Klausenstetten die Ereignisse dieses Nachmittags einschließlich ihrer Konsequenzen wiedergeben.
PAULA HAT SICH IM GEÄST des ausladenden Ahornbaumes verknotet.
»Sau-ei – Ach – Roh-ei – Adel!« Die Kommandos des Löschmeisters sind nur noch Fetzen, als sie bei Paulas Ohren ankommen. »Wasser-arsch!«
Wie eine Weberspinne ihr Gespinst an Stängeln und Ästchen verknüpft, genau so hat sich Paula ins Astwerk des alten Ahorns gehakt. Paulas Finger krallen sich in rissige Rinde, Paulas Zehen biegen sich um Zweige. Sie hockt im Verborgenen und starrt in die rauchige Helle hinter den gezackten Blättern.
Ein neuer Schwall zerfledderter Kommandos erreicht den Ahornbaum. Auf dem Weg durch Paulas Hirnwindungen finden die Fragmente zu ihrem wahren Wortlaut zurück. Sie beladen sich mit Bildern und Szenen, stöbern kürzlich Erlauschtes und längst Erfahrenes auf.
Zwanzig Minuten, rechnet sich Paula vor, vom ersten Sirenenheuler bis zum »Wasser marsch«. Das hams noch bei keiner Übung hingekriegt. Aber den hams halt auch direkt vor der Haustür, den Brand beim Schredereder.
Keine fünfzig Schritte vom Feuerwehrhaus entfernt, direkt neben dem Schlossbach, lodern die Flammen aus dem spitzwinkligen Hausgiebel vom Schredereder-Hof. Kein Wunder, dass der Löschmeister schon »Saugleitung zum Bach!« und »Rohr eins auf Heustadel!« kommandieren konnte, als sich Paula im alten Ahorn noch gar nicht richtig verhakt hatte.
So weit kann ich die Augäpfel überhaupt nicht rausbatzen, dass ich in die Senken reinsehn tät, wo der Hof brennt, dämmert es Paula nach minutenlangem Glotzen.
Sie gibt es auf, das Stieren, weil ohnehin die Augen schon brennen, und klettert im Baum eine Etage tiefer, dorthin, wo die Äste so dick sind wie prall gefüllte Feuerwehrschläuche. Paula kringelt sich in eine Gabelung, schließt die Augen, horcht auf das Knistern und Knirschen und stellt sich das Debakel bildlich vor, weil ihr die Realität verwehrt bleibt.
Die Kommandos vom Löschmeister sind jetzt in einem allgemeinen Tumult untergegangen, was heißt, dass schon das halbe Dorf um den Brand wuselt. »Alle müssen zu Hilf kommen«, so hat es Paulas Großvater – seit gut fünfundzwanzig Jahren Kommandant der freiwilligen Feuerwehr von Klausenstetten – von Anfang an reglementiert. »Das Vieh muss eingfangen werden und weggetrieben vom Feuer und vom Rauch. Jeder muss ein paar Stückl einstellen in seinen Stall. Ein paar Frauen müssen sich um die Kinder kümmern, um die Kinder von den Unglücklichen, die es troffen hat, das Schadenfeuer.«
Die Dorfkinder dagegen, die gern zum Gaffen kommen möchten, die verscheucht der Kommandant gnadenlos. »Auf einen ganzen Kilometer im Umkreis geht mir keiner herdanen, der wo nix Taugliches ausrichten kann auf einer Brandstell.«
Zu den solchermaßen Verbannten gehört auch Paula, obwohl sie in diesem Frühjahr ’63 schon zehn Jahre alt geworden ist und obwohl Großvater Simmet in seiner ganzen Sippe noch nie einen verständigeren, interessierteren und scharfsinnigeren Zuhörer hatte als die steckenhaxige Enkelin Paula.
Diese Enkelin ist soeben vom Ahorn heruntergekraxelt und drischt nun mit ihren Steckenhaxen auf den Rainfarn ein, empört und erbost, weil ihr das Horchen und Spekulieren keine Antwort drauf gibt, ob vor ein paar Augenblicken der Firstbalken brennend heruntergekracht ist oder ob die Klausenstettener da unten bloß irgendwelche Holztrümmer vom Brandherd wegschaffen und auf einen Haufen zusammenwerfen oder wie sonst dieses laute Knarzen und Krachen und Splittern zu erklären ist.
Da bin ich dann auf einmal wieder das lästige Kind, das aus dem Weg muss, wurmt es Paula, aber wenns ums Steinerausklauben geht ausm Acker und ums Rübenhacken, ums Krauteintreten und ums Eichelnsammeln für die Sau, ums Erdäpfelabwurzeln und ums Runkelnabkrauten, in Paulas Gemüt schwappt es bedenklich, als die tägliche Plackerei so geballt über sie hereinbricht, da bin ich dann schon recht, da kann ich mich hinbuckeln.
In diesen Momenten des Grolls auf den Kommandantengroßvater gönnt ihm Paula das hässliche Loch, das ihm die Großmutter mit dem Bügeleisen in die Paradeuniform gebrannt hat. Absichtlich hat sie es hineingebrannt. Sie war nämlich fuchsteufelswild, die Simmet Amalie.
»Das hats gewiss nicht braucht, dass der Max, Feuerwehrkommandant hin oder her, beim Gründungsfest vergangenen Sonntag bloß Augen ghabt hat für die aufgmascherlte Schredereder Lene, die hochnoble Fahnenmutter, die gschaftelhuberische!«, hatte Amalie gefaucht und das Bügeleisen auf der Herdplatte heiß und heißer werden lassen, bis es rot glühte.
Wo immer er beim Gründungsfest auch seine Augen hatte, der Kommandant der FFW Klausenstetten, dort, wo sie nach Amalies Ansicht hingehörten, waren sie nicht. Pfui, Max Simmet, Amalie hat sich doch extra ein Kleid schneidern lassen für das Fest! Siebzig Jahre Feuerwehr Klausenstetten, das war der Amalie eine Bahn von der dunkelgrünen Duchesse aus dem neuen Angebot der Schneiderin wert und zwei Meter von den beigen Biesen.
Seit Paulas Taufe hatte sich Amalie kein teures Stöffchen mehr geleistet, aber diesmal sparte sie nicht. Jede Klausenstettenerin war ihr neidig um das Gewand, jeder Klausenstettener warf ihr einen staunenden Blick zu, nur der Max, der Holzkopf, der schaute seine Amal überhaupt nicht an.
»In einem rupfenen Erdäpfelsack wenn ich daherkommen wär«, maulte Amalie, gleich nachdem das Gründungsfestbier ausgetrunken war, »dann hätt er das auch nicht gspannt.«
In ihrer Wut stellte die Amal tags darauf das rot glühende Bügeleisen auf den rechten Ärmel von Maxens Paradeuniform – absichtlich. Sie ließ es da stehen – ebenfalls absichtlich – und ging hinaus, um die Hühner von der Gred zu scheuchen. Als sie zurückkam, schwebte ein dunkles Wölkchen über dem Bügeleisen. Damit verrauchte ihre Wut. Amalie wurde angst und bang.
»Die schöne Uniform«, flüsterte sie erschrocken, »ruiniert, verschandelt, verhunzt.« Sie wollte das Brandloch wieder weghaben, aber von selbst würde es wohl nicht verschwinden.
Was, wenn ich, überlegte Amalie, das Jackett heimlich dem Schneider bring, der könnte doch einen Flicken einsetzen, mit ganz kleinen Stichen, so klein, dass sie kein Mensch sehen kann.
Könnte er, Amalie, nur nicht heimlich. Selbst wenn er wollte. Denn in Klausenstetten und seinen Nachbargemeinden haben die Dachziegel Augen, und jeder Fenstersturz hat Ohren.
Amalie seufzte. So hart es war, sie musste zu dem Brandloch stehen. Doch nie und nimmer konnte sie zugeben, dass alles Absicht gewesen war, pure Rache und Revanche. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als ihrem Ehemann scheinheilig und tränenreich von Unglück und Missgeschick zu berichten, den Rücken krumm zu machen und sich dreimal an den hängenden Busen zu klopfen. »So ein Malheur! Mea culpa, mea maxima culpa!«
Max verzieh ihr zähneknirschend und brachte die Uniform selbst zum Schneider zur Reparatur. Amalie atmete auf: »Deo Gratias.«
Oh ja, das Messlatein, das kann sie, die Amalie, von klein auf kann sie das.
Weder Großvater Max noch Paulas Mutter Erna kamen auf den Gedanken, Amalie der Arglist zu verdächtigen. Paula schon, Paula wusste, wie das Brandloch zustande gekommen war. Sie hatte das Bügeleisen auf dem Herd glühen sehen und das schlechte Gewissen in Amalies Augen. Und wenn sie Amalies Missetat nicht selbst beobachtet hätte, dann wäre nächstens in Paulas Träumen davon die Rede gewesen, oder ihre Gedanken hätten ungefragt darüber geflüstert.
Das passiert Paula häufig. In ihrem Kopf spielen sich Episoden ab. Manchmal geht es dabei um Ereignisse, die in der Vergangenheit geschehen sind, manchmal um Begebenheiten, die sich im Geheimen zutragen. Die Krux bei der Sache ist, dass Paula nicht recht weiß, ob ihre Gedanken die Wahrheit sprechen oder einfach nur Possen treiben.
Natürlich hat Paula nie jemandem von diesen Halluzinationen erzählt. Ihren Schulkameraden nicht, die sich schlappgelacht hätten, und ihren Verwandten schon gar nicht, denn Paula kann sich die Reaktion jedes Einzelnen gut vorstellen.
»Dicite in lumine«, würde Amalie sagen, »die Finsternis ist des Teufels.«
Amalie zitiert gern aus dem Schott und überlässt es ihrem Gegenüber, aus solchen Sprüchen schlau zu werden. Gottes Wort erspart ihr die Mühe, selbst zu denken.
»Hirngespinsten nachhängen und sich vor der Arbeit drücken«, würde Paulas Mutter blaffen, »mach, dass du weiterkommst. Das Regnen fängts an, und die Wäsch hängt noch draußen.«
Der Großvater würde bedächtig den Kopf wiegen und schmunzelnd antworten: »Man möchts nicht glauben, was in einem Mädl-Hirn so vorgeht.«
Hin und wieder argwöhnt Paula, dass sich vielleicht ein Geisterwesen in ihre Gedanken schleicht, um ihr all diese Geschichten zu erzählen. Einen Augenblick lang hatte sie auch überlegt, ob es die Muttergottes sein könnte. Das war, als Amalie von einem Hausierer heilsames Lourdes-Wasser kaufte.
Die Muttergottes hat mit den Kindern in Fatima geredet und in Lourdes mit dem Mädchen Bernadette. Vielleicht spricht sie jetzt zu mir?, dachte Paula damals.
Aber sie verwarf den Gedanken schnell wieder. Die heilige Maria kam nicht in Frage. Denn falls es wirklich eine Geisterscheinung wäre, die Paula sporadisch aufsucht, dann bestimmt keine heilige. Und seltsamerweise weiß dieses Wesen ausgerechnet in Klausenstetten und Umgebung verdammt gut Bescheid.
Paula wünscht sich erbittert, Amalie hätte dem Großvater je ein Loch in beide Ärmel und beide Hosenbeine gebrannt. Aber selbst das wäre nicht Strafe genug für die abgrundtiefe Gemeinheit, sie von der Brandstätte zu verbannen.
Die Schredereder-Kinder, Jele und Ede, kommen Paula in den Sinn, die wohl gerade dabei zusehen, wie das Dach, unter dem sie zeitlebens wohnten, brennend einstürzt.
Zugegeben, gesteht sich Paula ein, der Ede wird momentan begeistert sein, weil es so lustig brennt auf dem Hof. Aber spätestens dann, sagt sie sich, wenn der Brand gelöscht ist und die verkohlten Trümmer herumliegen, wird ihm aufgehen, dass sein Elternhaus weg ist, sein Bett, sein Fußball und vermutlich auch sein Fahrrad. Seinen Schulbüchern wird er kaum nachtrauern, der Ede.
Paula entfährt ein Seufzer, als sie an Jele denkt. Jele, die Zartbesaitete, die schon zittert, wenn eine Gewitterwolke über dem Schlossberg steht, die vor Schreck blass wird, wenn der Wind das Scheunentor zuschlägt, die eigentlich überhaupt keinen Grund braucht, um Angst zu haben. Wer kümmert sich um Jele, während der Hof brennt?
Bitte nicht der Schullehrer Selch, hofft Paula, vor dem und seinem Tatzensteckerl hat die Jele ja noch mehr Schiss als vor dem Feuer.
Gereizt klettert Paula erneut in die oberste Astgabel hinauf. Nach etlichen fruchtlosen Versuchen, etwas von der Brandkatastrophe zu erspähen, rutscht sie jedoch enttäuscht wieder einen guten Meter nach unten und streckt sich auf einem der dicken Äste aus. Sie schaut verdrießlich in den rauchverschmierten Himmel, und dabei kommt ihr wieder Großmutter Amalie mit ihrem Latein in den Sinn. Amalie, die dem Pfarrer während der Messe keine einzige Antwort schuldig bleibt. Amalie, wie sie im Kirchengestühl kniet, Mitte links, Platz zwei. Das ist Amalies angestammter Platz, deutlich gekennzeichnet durch ein weißes Emailschild mit dem schwarzem Aufdruck »Simmet«.
In den Sechzigern wird beim Hochamt in der Dorfkirche noch in lateinischer Sprache gefragt und geantwortet. Und die Simmet Amal, die tönt es sattelfest heraus, das »Et cum spiritu tuo« und das »Qui tollis peccata mundi: miserere nobis«. Ohne einen Hauch von Unsicherheit artikuliert Amalie die lateinischen Worte. Unterdessen sitzt sie auf einer Wolke der Überheblichkeit, denn sie kennt (kein Klausenstettener und schon gar nicht die Schredereder Lene kann ihr hier das Wasser reichen) sogar die deutsche Übersetzung von dem, was sie psalmodiert.
Paula, die wenig redet, dafür aber viel hinhört, gesteht ihrer Großmutter, Amalie Simmet, gern zu, dass sie zehnmal klüger und gebildeter ist als ihre Nachbarin, die Lene Schredereder. Der ungesunde Punkt daran, findet Paula, ist nur, dass es keine besondere Kunst darstellt, klüger zu sein als die Schrederederin. Und deshalb stört es Paula, wenn Amalie die Lene bei jeder Gelegenheit bloßstellt. Und das tut sie. Paula bekommt es mit, wenn sie Abend für Abend hinter ihren Schulbüchern verschanzt am Küchentisch klemmt.
Lenes jüngsten Schnitzer hat Amalie so oft durchgekaut, dass sich die Mäuse auf dem Heuboden aus lauter Überdruss schon die Ohren zuhalten, wenn sie wieder davon anfängt. Die Sache hatte sich just an jenem Sonntag zugetragen, an dem Lene als Fahnenmutter für das siebzigjährige Gründungsfest der FFW Klausenstetten ausersehen wurde. Es war der Sonntag Quinquagesima, so was weiß die Amal, ohne nachdenken zu müssen. An diesem Tag gab Lene vor dem ganzen Gemeinderat, dem Pfarrer, den Aktiven der Feuerwehr und allen anderen, die gerade so dabeistanden, zu, dass sie ihr Leben lang bis auf den heutigen Tag dachte, »Dominus vobiscum«, hieße übersetzt »Herr, wo bist du«. Die Klausenstettener lachten bloß gutmütig: »Mei, die Lene!« Aber die Amal biss sich daran fest: »Da siehst es wieder, wie dumm die Lene is, brunzdumm wie ein Kinigelhas.«
Paula fragte sich, was Amalie als die größere Dummheit ansah, den Übersetzungsfehler oder das Eingeständnis. Wie auch immer, eines war offensichtlich: An Quinquagesima wurmte es die Amal kräftig, weil ihr eigener Mann der Schredereder Lene unerschütterlich die Stange hielt. Nach dem gutmütigen Auflachen setzte nämlich ein Frotzeln und Spötteln ein, und Amal hätte sich gerne ein bisschen in Lenes Blamage gesonnt. Aber was tat Max, der Schuft? Er begann mit einer seiner Kriegslegenden, und bevor es sich Amalie versah, hörten ihm schon alle zu. Lenes ondulierter Hohlkopf war vergessen.
Paula kennt alle Geschichten, die der Großvater zu bieten hat, denn er erzählt und erzählt in seiner Schusterwerkstatt, beim Spannen und Weiten, beim Nähen und Zuschneiden. Und Paula spitzt die Ohren, wenn sie steckenhaxig, pickelnasig und strähnenhaarig in der Ecke hockt, halb versteckt hinter der Stanzmaschine. Strichlippig und schiefzahnig, wäre noch aufzuzählen der Vollständigkeit halber, aber das sind sie alle, die Kinder der Spanagl Erna, geborene Simmet. Die anderen drei, Paulas Schwester und die beiden Brüder, sind außerdem noch großmäulig und faulpelzig, und zuhören wollen sie keinem.
Paula kann sich recht gut vorstellen, wie die Stimme des Großvaters am Sonntag Quinquagesima in das Grölen und Johlen schnitt: »Herr, wo bist du? Das haben wir uns im Krieg wieder und wieder gefragt. Herr, wo bist du? Und bis heut weiß keiner, wo er war, ’42, wie sie gefallen sind nacheinander, der Vater von unserm jungen Kreisbrandrat, bald drauf dein einziger Bruder, Amal, und später noch deine zwei Brüder, Lene. Wo wird er denn gwesen sein, der Herrgott, wie sie den Blumental auf Dachau ham mitsamt seine Kleinen und seiner Frau, die wo noch nicht mal aus dem Wochenbett heraußen war. Und dann, kaum eine Woch später, hams dann den Molcek abgeholt, bloß weil der gsagt hat, jeder Krieg ist ein Unrecht, und wer einen anschafft, das ist ein Unmensch! Wie sie den Molcek wegham, da ham wir gwusst, dass es brenzlig wird für deine Mutter, Lene.«
Mit ihrer Meinung über Adolf Hitler hatte die Schredereder Else, Lenes Mutter, schon Anfang November 1923 in Klausenstetten lauthals die Runde gemacht, damals, als gerade der Putsch in München fehlgeschlagen war und Hitler Fersengeld gegeben hatte. ’23 konnte sie es wagen, weil Hitler in Uffing erwischt und in der Festung Landsberg am Lech eingelocht wurde.
In jener Zeit schien es noch nicht riskant, den späteren Reichsführer als Schicklgruber-Bankert zu betiteln und über seine Herkunft zu lästern. Aber Else Schredereder (von ihr musste Lene das Spatzenhirn haben) war dämlich genug, auch ’33 das Maul nicht zu halten (das war dämlich, oder war es etwa mutig?).
’39 hatte sie immer noch nicht gerafft, dass sie sich um Kopf und Kragen redete. Sie wurde auch ’42 nicht still und behauptete dummdreist und starrsinnig, von ihrer Mutter-gottselig her bis aufs i-Tüpferl genau über Hitlers Abstammung Bescheid zu wissen: »Und was eine Wahrheit is, bleibt eine Wahrheit, und eine Wahrheit kann man nicht abstechen und nicht vergasen.«
2.
ELSES MUTTER-GOTTSELIG GING 1884 – neunzehn Jahre war sie da alt – nach Niederösterreich in Stellung. Der Ort hieß Zwettl und war öde. Die Herrschaft benahm sich hochnäsig, und Elses Mutter-gottselig hatte Heimweh nach Klausenstetten. Sie hatte Heimweh bis zu dem Tag, an dem der Kesselflicker an die Hintertür klopfte. »Der Rastelbinder is kommen«, rief eine der Küchenmägde und führte einen feschen Kerl in die Küche. Noch am selben Abend fing Elses Mutter-gottselig ein Techtelmechtel mit ihm an, und das Heimweh verflog.
Der Kesselflicker war ein Hansdampf in allen Gassen. Er kam im Waldviertel gründlicher herum als der Gänsegeier und konnte Elses Mutter-gottselig stundenlang mit witzigen, spannenden und gruseligen Geschichten unterhalten. Der Rastelbinder kannte die einfältigen Waldviertler von außen und von innen, er kannte sie sozusagen durch und durch. Sogar die Kopf- und Filzläuse, die Flöhe und die Bettwanzen, die den Zwettler Zisterziensermönchen und ihren dörflichen Brüdern und Schwestern im Herrn am nächsten standen, weil sie ein Leben lang in deren löchrigen Gewändern hausten und gewissenhaft jeden Quadratzentimeter schmieriger Haut observierten, bestaunten die Beschlagenheit des Kesselflickers. Dieser Rastelbinder, geschäftig und umtriebig, zog nun Elses Mutter-gottselig zum Nabel jeder Geselligkeit, von der er Wind bekam.
Es war auf einem Maitanz in Döllersheim, als Elses Mutter-gottselig einen Herrn namens Alois Schicklgruber kennenlernte. Sie ließ sich weder jetzt noch später herbei, ihn näher zu charakterisieren, nannte ihn aber zeitlebens nur den »Saubärn«.
»Und der Saubär«, pflegte ihre Tochter, Else, von November ’23 bis November ’42 hinauszuposaunen, »der Saubär, das ist der Vater vom Adolf. Dem Schicklgruber-die-Seine hats der Mutter-gottselig doch selber erzählt, dass er ihr ein Kind gmacht hat, der Saubär. 1888 is das gwesen, und ’89 im April is er dann auf die Welt kommen, der Schicklgruber-Bankert.«
Was Elses Mutter-gottselig nie jemandem – und ihrer Tochter schon gar nicht – erzählte, war, wie sie Anfang ’89 ziemlich überstürzt nach Klausenstetten zurückkehren musste. Sie hätte ihr kleines Geheimnis allerdings ebenso gut vom Schlossberg herunterrufen können, denn ganz Klausenstetten und halb Hohenstetten wusste sowieso Bescheid.
Zum Jahreswechsel in Zwettl hatte sich Elses Mutter-gottselig endgültig damit abfinden müssen, dass sie schwanger war. Der Kesselflicker reagierte flink. Er roch den Braten und machte sich schnellstens aus dem Staub. In Klagenfurt-St.Veit fand er ein neues Wirkungsfeld.
Elses Mutter-gottselig fahndete nicht nach ihm. Sie trauerte ihm nicht einmal hinterher, weil der Rastelbinder viel zu leichtlebig war, um einen Vater abzugeben – sogar einen schlechten: Er war ein Dulliäh von hinten bis vorne. Der Kesselflicker würde niemals ein ordentliches Hauswesen gründen wollen.
Auf ein solches samt bürgerlicher Ehrhaftigkeit war Elses Mutter-gottselig aber aus, und deshalb schwenkte sie in Richtung Heimat, bevor sich das Bäuchlein runden konnte. Sie hatte da schon was im Auge: Ihre Option hieß Anton Vierlbeck.
Der Vierlbeck Anton hatte vor mehr als einem Jahr seine Frau an die Schwindsucht verloren, und seine drei Buben verlotterten seither gröblich in der verwanzten Stube. Viel hatte Vierlbeck einer Frau nicht zu bieten, aber Elses Mutter-gottselig hatte ohnehin nur einen einzigen Wunsch: Legitimation.
Kaum in Klausenstetten, warf sie sich dem Vierlbeck an den Hosenschlitz, aber selbst diese eilige Maßnahme konnte nicht verhindern, dass sie ein Fünfmonatskind zur Welt brachte. Das fiel jedoch nicht besonders auf, denn es gab eine ganze Menge Fünfmonatskinder in Klausenstetten. Ausschlaggebend war, dass Elses Mutter-gottselig »Frau Vierlbeck« hieß, bevor sie die ersten Kindsbewegungen spürte.
Das Sacherl vom Vierlbeck warf kaum mehr ab als eine Handvoll Erdäpfel und ein paar Roggenkörner fürs täglich Brot. Elses Mutter-gottselig, die zweite Vierlbeckin, sah bald mit Schrecken, wie die Schwindsucht auch in ihre Kammer schlich, und entdeckte kein Schlupfloch, um ihr zu entkommen. Und es half ihr überhaupt nichts, dass sie von den recht betuchten Schredereders abstammte. Ihr Bruder, Herbert, hatte den väterlichen Hof ganz allein geerbt und frühzeitig kundgetan, dass er der Vierlbeck-Brut nicht einmal einen gottverdammten Frühapfel in den Rachen schmeißen würde und sonst erst recht nichts.
In ihrer Not fiel Elses Mutter-gottselig nichts Besseres ein, als zu beten (der Pfarrer hatte ihr das bereits bei der Hochzeit angeraten). Sie versuchte es bei Mutter Anna, beim heiligen Jakob und bei allen Seraphim. Als 1906 der Typhus Herbert Schredereder mitsamt Frau und Kindern hinwegraffte, glaubte Elses Mutter-gottselig fest daran, einer der Angerufenen hätte sie erhört und Bruder gegen Schwester, Typhus gegen Schwindsucht eingetauscht.
Sie dankte allen Heiligen und trat ihr Erbe an, denn nach allgemeinem Recht und Gesetz bekam die zweite Vierlbeckin nach dem Tod der ihr vorrangigen Erbberechtigen nun den Schredereder-Hof. Allerdings verlangte das Sippenrecht, dass der, dem der Hof zufiel, auch den zugehörigen Namen annehmen musste. Die Vierlbeckin hängte kurz entschlossen das doppelt ererbte Schredereder an ihren Heiratsnamen. Mit der Zeit ließ sie Letzteren dann wieder weg und beschränkte sich ganz simpel auf Schredereder.
Else und ihr ein Jahr älterer Bruder (weitere Kinder von Elses Muttergottselig waren frühzeitig verstorben) wurden damit ebenfalls zu echten Schredereders, Vierlbeck hin und Kesselflicker her. Else und Ede wuchsen in dem Anwesen auf, das sich ihr Großvater, ihr Urgroßvater und wer weiß wie viele erarbeitet hatten. Else lernte Kühe melken und Reisig bündeln, und sie hörte sich die Geschichten an, die ihre Mutter aus Zwettl erzählte.
Eine davon wärmte Else 1923 wieder auf. Leider hatte der Zahn der Zeit in den ohnehin schon komplizierten Hergang der von Elses Mutter-gottselig überlieferten Hitler-Genealogie ein paar Löcher genagt, die Else allerdings schlankweg ignorierte.
Was normalerweise keine Rolle gespielt hätte, war im Fall Reichsführer in spe imstande, eine braune Schlinge zu knüpfen, die sich zügig um Elses Hals wand. Dabei war ’23 noch gar nicht abzusehen, dass sich die Schlinge einmal kritisch zuziehen könnte.
Else Schredereder fuhr halsstarrig und unverblümt damit fort, Adolf Hitler den Schicklgruber-Bankert zu nennen, als dieser schon Reichskanzler war und Gebieter über Sturm-Abteilung, Schutz-Staffel und Stahlhelm. Elses Mann, Siegfried Ellerschwang, der Else samt dem Schredereder-Hof 1912 geheiratet hatte und der sich seit 1927, als ihm und seiner Frau der Hof offiziell übergeben wurde, der Einfachheit halber Eller Schredereder nannte, versuchte in den folgenden Jahren, und ganz besonders ab ’33, immer wieder, Else zur Vernunft zu bringen: »Sag das nimmer. Sag nimmer Schicklgruber-Bankert zum Reichskanzler, du bringst uns alle ins Unglück damit.«
»Könnt er nicht mal selber abstreiten, der Adolf«, antwortete Else jedes Mal bockig, »weil, was is, das is.«
»Es ist eben grad nicht«, antwortete dann ihr Mann zum hundertsten Mal und käute wieder, was er sich extra die Mühe gemacht hatte zu recherchieren: »Was man ihm auch alles nachsagen kann, dem großgoscherten Reichsführer – einen ganzen Haufen kann man ihm sogar nachsagen mit Fug und Recht –, aber das, was du daherbringst, grad das ist nicht wahr. Pass auf«, zerpflückte Eller Schredereder wieder und wieder akribisch Hitlers Herkunft, »der Alois, der Vater vom Führer – der Saubär, wie ihn deine Mutter geheißen hat –, das war der Schicklgruber-Bankert, den hat die Anna Schicklgruber ledig gehabt, wer dem sein Vater war, das weiß keiner. Aber er, der Alois Schicklgruber, der Saubär, der war mit der Seinigen verheiratet, genauso wie du und ich. Und deswegen ist der Hitler legitim geboren, genauso wie du und ich, hast mich!«
Vielleicht hörte ihm Else nie richtig zu, vielleicht meinte sie auch, dass es egal sei, ob der Vater ein Bankert war oder der Sohn. Sie gab jedenfalls weiterhin ihre eigene Ansicht zum Besten.
»Else, alle miteinander bringst uns noch ins KZ, wennst den Mund nicht hältst«, flehte ihr Mann.
Sie hielt ihn nicht, die Else, den Mund, keine Minute lang, und als ’40 ihr erster Sohn fiel, erst recht nicht mehr. Die Klausenstettener murrten. Eller wusste nicht ein noch aus. Eines Abends besprach er sich lange mit dem Simmet Max. Danach war beiden klar, dass man die Schredereder Else zum Schweigen bringen musste. Sie war nicht nur für sich selbst und ihre Sippe eine Gefahr, sondern für alle Klausenstettener. Vorwiegend für den Max, denn Else nahm auch in seiner Schusterwerkstatt kein Blatt vor den Mund, egal ob der Gauleiter gerade seine Stiefel vom Besohlen abholte oder sonst einer mit dem Parteiabzeichen am Revers die Türklinke in der Hand hielt.
Else war eine Gefahr für das ganze Dorf, weil die Braunen nicht viel Federlesens machen würden, wenn sie darangingen, die Blasphemie ein für alle Mal auszurotten, durch die Else Schredereder den glorreichen Reichsführer schmähte.
Anfang ’42 stürzte sich Max in weitschweifende Überlegungen zum Fall Else Schredereder. Es war inzwischen bekannt, dass der Gauleiter beschlossen hatte, Else Schredereder den Mund auf eine Weise zu stopfen, die ihre Kinder zu Waisen machen würde.
Der Gauleiter hätte gar keine andere Wahl, erklärte Amalie ihrem Mann. Die Hitleranhänger hier in Klausenstetten (es waren nicht viele, aber sie hatten das Sagen) würden den Amtsträger um seinen Posten und wer weiß um was sonst noch bringen, würde er Elses Verunglimpfung des Führers noch länger hinnehmen.
Max musste eine Lösung finden, unbedingt. Als Erstes dachte Max daran, Else Schredereder für verrückt erklären zu lassen, denn dieser Schachzug hätte ihr grenzenlose Redefreiheit verschafft. Aber dadurch würde das kompromittierende Unwort erst recht die Runde machen, es würde vor die Instanzen kommen und in Berichten auftauchen. Und dann?, dachte Max, dann käme Klausenstetten an den Pranger. Es gäbe Verhandlungen und Untersuchungen und Befragungen. Mit welchen Ergebnissen? Nicht auszudenken, was die Braunen alles zutage fördern könnten.
Schon in diesem Stadium seines Gedankenexperiments sah Max eine Menge guter Gründe, den Plan »Freibrief für Else« wieder fallen zu lassen. Aber er zwang sich, einen Schritt weiterzugehen.
Angenommen, sinnierte er, Klausenstetten würde all die hochnotpeinlichen Verhöre durchstehen. Angenommen, man könnte die Braunen austricksen und der Else den Paragraphen verschaffen. Dann könnte sie plappern, was sie wollte, der Einundfünfziger würde sie schützen. Aber wäre Else dann sicher, wäre sie außer Gefahr?
Bei dieser Frage fiel Max siedend heiß Martin Ellerschwang ein, Elses Schwager. Martin litt von Geburt an unter einem Übel, das die Klausenstettener »hinfallende Krankheit« nannten. Immer wenn Martin zuckend zu Boden sackte – und das kam nicht selten vor –, stand ihm der Schaum vor dem Mund, seine Augen verdrehten sich, bis nur noch das Weiße zu sehen war. Er schlug um sich, biss und kratzte und hatte keine Ahnung von dem, was er da tat. Zugegeben, es war gespenstisch. Deshalb reagierte seine Familie schier hoffnungsvoll, als sich Anfang ’40 die Behörden für Martin interessierten. Ein Anschreiben, das den Ellerschwangs zuging, kündigte an, dass Martin zur Untersuchung und Einvernahme in eine Heil- und Pflege-Anstalt gebracht werden würde.
Ohne Untersuchung keine Behandlung, ohne Behandlung keine Heilung, sagten sich Martins betagte Eltern und packten den Koffer für ihren Sohn. Den Brief legten sie bei, als Beweis für Martins Anspruch als Patient. Dieser Brief sah nämlich so respekteinflößend aus. Er trug einen mit einem Hakenkreuz dekorierten Faksimile-Stempel neben der Unterschrift und kam vom Reichsbehinderten-Erfassungsamt.
In Klausenstetten hörte man nie wieder etwas von Martin Ellerschwang. Aber man hörte eine Menge Gerüchte, die sich um ein einziges Wort rankten: »Euthanasie«.
Konnte der Freibrief Else Schredereders Todesurteil bedingen?
Max Simmet wälzte das ganze Dilemma wochenlang über seinen Schusterleisten. Er verschnitt zwei schöne Flicken teures italienisches Leder zu unbrauchbaren Trapezen, nagelte drei Absätze verkehrt herum auf spröde Schuhsohlen, die die Nägel nur ungern wieder hergaben, und hörte Else in seinen Alpträumen »Schicklgruber-Bankert« grölen. Eines Morgens, als er mit drei gezielten Hieben eine schief gelatschte Profilsohle von einem Lederstiefel schlug, streifte ihn der wahnwitzige Gedanke, dass der Schusterhammer genau das Werkzeug war, das Else Schredereder vor dem KZ retten konnte.
Der Hammer muss mit der platten Seite kraftvoll auf Elses Hinterkopf geschwungen werden, dorthin, wo diejenigen Nerven sitzen, die Else das Sprechen ermöglichen, irrlichterte es in Max’ Hirn.
Er schwitzte zwei komplette Nächte durch und phantasierte sich dabei zurecht, man könne ganz exakt mit einem forschen Schlag Elses Sprachzentrum treffen, ohne weiteren Schaden anzurichten als den, dass die auf solche Art geheilte Else bis zum hoffentlich baldigen Untergang des ungesunden braunen Regimes kein einziges Wort mehr herausbrächte.
Nach der dritten Nacht hatte sich Max weit genug in seinen Wahnvorstellungen verfangen, dass er frühmorgens (es war der Martinitag) den Schusterhammer zurechtlegte, seine Hand dem Herrn empfahl und untätig auf die Else wartete, die ihre weißen Stöckelschuhe abholen sollte.
Der Herrgott hatte aber allen Grund, Max’ Hand gründlich zu misstrauen, vor allem deshalb, weil er im Zuge der Evolution das Sprachzentrum in Elses Hirnwindungen links eingebaut hatte, eine gute Handbreit von der Stelle entfernt, die sich Max im Geiste markiert hatte. Max seinerseits ignorierte alle göttlichen Impulse, die ihn sanft zum Umdenken drängten, und versteifte sich auf ein Plätzchen an Elses Hinterkopf, wo der Schlag im wahrsten Sinn des Wortes ins Auge gehen würde. Im vorliegenden Fall sogar in beide.
Da musste Gott hurtig handeln: Als Else an diesem Morgen beim Frühstück herzhaft in ihr Ramabrot biss, zeigte der Herrgott Elses Mann eine Stelle an ihrem Schädel, die – brachial lädiert – temporäres Verstummen ohne weiteren Schaden versprach. Himmlischer Eingebung folgend holte Eller aus und zertrümmerte Elses Unterkiefer linksseitig. Niemand argwöhnte Willkür, weil Feld und Stall sowieso ständig Unglücksfälle gebaren wie lauwarme Tümpel Moskitos.
Von nun an sog Else die eingeweichten Ramabrote durch einen Strohhalm in ihren Schlund. Zwölf Monate lang sprach sie kein Wort, weil sie den Unterkiefer nicht bewegen konnte. Am Neujahrstag ’43 sagte sie zu ihrem Mann »Sauhammel«, und dann schwieg sie weiter, weil sie nachtragend war. Zum Frühjahr ’45 hin taute Else Schredereder allmählich wieder auf. Der Schicklgruber-Bankert spielte zu dieser Zeit keine Rolle mehr, er war auf dem absteigenden Ast.
Paula – sie hockt noch immer in dem Ahornbaum und blinzelt in den Rauch – kommt die Beerdigung der Schredereder Else in den Sinn.
Voriges Jahr, so um die Frühjahrszeit, muss sie gestorben sein, überlegt Paula und sieht Großmutter Amalie schwarz gekleidet im Kirchengestühl knien. Bei Trauerfeiern trägt Amalie ihr schwarzes Kostüm. Bevor sie es anzieht, nimmt sie die Mottenkugeln aus den Jackentaschen.
Paula sieht den Großvater mit einem schwarzen Band am Revers seiner Uniform hinter dem Sarg hergehen, und sie sieht ihre Mutter – Paula schreckt auf.
Die Sonne verschwindet soeben hinter dem Schlossberg, zieht ein paar Rauchschwaden vom Firmament mit hinunter und lässt nur Schatten zurück; sonderbar, dieses Dämmerlicht. Und noch etwas ist sonderbar. Paula horcht und lauscht, sie späht in die Runde, und da fällt es ihr auf: Es ist so verblüffend still ringsum. Überstürzt rutscht Paula an dem rauen Stamm des Ahorns hinunter. »Da wirds mich jetz gleich wieder anzischeln, die Mutter«, murmelt sie leise vor sich hin. »Dass ich die Rinde von dem Brot nicht wert bin, wo ich ess, werd ich zu hören kriegen, und dass ich mich vor der Arbeit drück wie der Pfarrer und der Doktor vor den armen Leuten, die wo ihnen nix einbringen.«
Paula fegt über die Wiese, sprintet am Gemüsegarten vorbei und stoppt abrupt beim Wassergrand neben der Haustür. Über das Plätschern hinweg hört sie die Lene Schredereder ganz elendig greinen: »Jedes Jahr hab ich ihm einen Zehner zum Opfer bracht. Immer an seim Namenstag hab ich das Opfergeld für den heiligen Florian in den Klingelbeutel eingworfen, ich schwörs euch. Und was tut er dafür, der Schutzpatron gegen Feuer und Rauch? Er lasst uns im Stich! Grad wo wir ihn so notwendig brauchen, lasst er uns im Stich. Er hätt doch aufpassen können, dass es keine Funken raushaut aus die elektrischen Kabeln, Feuerfunken, die wo dann ins spreutrockene Balkenholz und ins dürre Stroh springen.«
Lene setzt zu einem lauten Schniefen und Schluchzen an, das sich zermürbend mit dem Wassergrandgurgeln mischt. Und Paula hält es für angeraten, hier draußen zu warten, bis sich Lene beruhigt hat.
Wär der Mutter gwiss nicht recht, wenn ich jetz reinplatzen tät, denkt sie und hockt sich auf den umgedrehten Zuber neben dem Grand.
Im Minutentakt unterbricht die Stimme von Paulas Mutter, Erna Spanagl, Lenes Klagen: »Furchtbar is des, Lene, mei, furchtbar.«
Paula wäscht sich die Hände, schöpft Wasser, trinkt und wartet. Nach einiger Zeit flaut Lenes Weinen zu einem leisen Seufzen ab.
Paula hat den linken Fuß schon in der Flez, da bricht die Schredereder Lene wieder aus wie ein Island-Geysir: »Seit Generationen, zurück und zurück bis auf den Kurfürst Max, immer haben wir aufpasst, dass wir kein andern Selbstlaut in unsern Namen haben als wie ein E. ›Solang kein U, kein I, kein A das Gleichmaß in dem Namen stört, is das Unglück ausgesperrt‹, so is es den Schredereder prophezeit.«
Lene lacht bitter auf: »Gar nix hats uns gholfen, dass wir immer nur Vornamen mit E ausgsucht haben, heut nicht und früher auch nicht. Und interessieren täts mich echt, wer so einen Schmarrn aufbracht hat. Am End der Mühlhiasl, der bucklige Hurenbock, der vermaledeite.«
»Lene, bist nicht gleich still!«, fährt ihr Erna Spanagl in die Rede. »Hast nicht eh schon genug Unheil am Hals? Der Mühlhiasl, der is zum Fürchten, der lauscht noch aus seim Grab raus. Auch hundert Jahr nach seim Tod kann dir der noch ein Übel anwünschen, wennst ihn ergrimmst.« Schrecken zittert in Ernas sonst so resoluter Stimme, und Paula läuft die Gänsehaut auf, draußen in der Flez.
Die düstere Unterrichtsstunde im Fach Heimatkunde wird Paula nicht so schnell vergessen, diese Stunde, in der Lehrer Selch mit gekrümmt erhobenem Zeigefinger nachgesprochen hat, wie der Mühlhiasl das große Abräumen weissagte: »Die Zeit wird kommen, wo die Welt abgeräumt wird, das wird sein: Wenn sich die Bauersleut gewanden wie die Städtischen und die Städtischen wie die Narren; wenn die Bauersleut Hennen und Gänse selber fressen; wenn die Leut in der Luft fliegen können und der eiserne Hund die Donau heraufbellt, dann ist nicht mehr weit hin.«
Lehrer Selch stellte während dieser Schulstunde keinen Augenblick infrage, dass der Mühlhiasl vor etwa zweihundert Jahren wirklich existierte und gab eine ganze Menge beängstigender Mühlhiasl-Zitate zum Besten. Am Ende der Stunde sagte Selch, der Mühlhiasl sei das niederbayerische Pendant zu Nostradamus, allerdings sei der bayerische Seher zweihundertfünfzig Jahre später geboren als der französische Arzt und Visionär. Niemand in der Klasse verstand diesen Satz, auch Paula nicht, aber die ging in der Pause in die Schulbücherei, nahm ein Lexikon und sah unter »Nostradamus« nach.
Im Klausenstetten des 20. Jahrhunderts ist der Mühlhiasl noch immer präsent. Er ist geachtet und gefürchtet, und er wird beharrlich zitiert. Denn der Mühlhiasl ist ein Hiesiger, ein Einheimischer. Er ist sogar ein ganz besonderer Einheimischer, einer, der in die Zukunft sehen konnte.
Nur eine halbe Wegstunde von Klausenstetten entfernt, in der Pfarrei Hunderdorf, ist der Mühlhiasl zur Welt gekommen. Am 16. September 1753 wurde er unter dem Namen Matthäus Lang ins Geburtenregister eingetragen.
Der erwachsene Mühlhiasl hinterließ seine Gene im Zellplasma von acht legitimen Kindern. Eine angemessene Zahl zu seiner Zeit. Den Gerüchten nach war jedoch der Mühlhiasl weit produktiver, als die Behörden ahnten. Er soll halbe Schulklassen mit seinem Y-Chromosom ausgestattet haben. Das konnte zwar nie bewiesen werden, ließ aber in der ganzen Gegend eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der paternalen Abstammung aufkommen.
Ob der Mühlhiasl nun hundert, fünfzig oder bloß zehn Nachkommen hatte, es darf angenommen werden, dass seine Gene weit gestreut und keinesfalls ausgestorben sind. Damit wäre er unsterblich – biologisch gesehen.
Das, so scheint es, reichte dem Mühlhiasl nicht. Falls er nicht nur im Erbgut der Klausenstettener und ihrer Nachbarn erhalten bleiben wollte, sondern auch in ihren Köpfen, ihren Gemütern und ihren Seelen, dann kann er einen vollen Erfolg verbuchen. Seine zahllosen belegten und behaupteten Prophezeiungen lassen sich bis heute nicht ausrotten. So sehr auch Bischof und Pfarrer gegen jeglichen Aberglauben wettern, die Weissagungen des Mühlhiasl halten stand.
Lene Schredereder denkt überhaupt nicht dran, zu einem Ende ihrer Tirade zu kommen. Sie beißt sich an den Schredereder’schen Glücks-E fest, die ganz offensichtlich irgendwann zu Unglücks-E mutierten. Und Lene weiß auch, wann das war, und sie will es der Spanagl Erna – die das genauso gut weiß – vorbeten, jetzt. Und dazu muss die Lene ein wenig ausholen:
»Einen Haufen Grundstücker hams den Schredereder zamgrafft, die E, zwei Granitbrüch und etliche Tagwerk Waldung. Ja, ganz früher, da hats gwirkt, das E, stark hats gwirkt. Ganz früher, da warn die Bälger immer allesamt kräftig und pumperlgesund. Drum ham sich die Altvorderen gschworn, dass sie ihre Kinder nicht anders als Herbert und Eckbert, Helene und Else taufen wolln und – falls ihnen die richtigen Namen zu wenig werden – dann halt Bene und Rese und Mele, ganz egal, Hauptsach bloß E und sonst nix.«
Lene flennt eine Weile leise vor sich hin, bevor sie den Zeitpunkt nennt, an dem das Verhängnis seinen Anfang nahm: »1906, da is angangen! Da hat der Typhus den Herbert, den Bruder von der Großmutter-gottselig, weggeräumt; den Herbert und all die Seinigen, alle, wie sie da warn auf dem Schredereder-Hof. Von der ganzen Schredereder-Sippe is bloß die Großmutter-gottselig übrig blieben. Meine Großmutter, die wo wegen ihrer Heirat eine Vierlbeckin war, die is dann auf den Hof kommen, mit ihre lebendige zwei Kinder, dem Ede und meiner Mutter, der Else; mitsamt der angeheirateten Vierlbeck-Bagage und mit dem alten Vierlbeck, ihrem Mann.«
Lene tut einen tiefen Seufzer. »Von da an, Spanaglin, is dahingangen und dahin. Der Großmutter-gottselig sind alle Kinder, die sie noch kriegt hat, weggstorben. Nur die zwei, wo schon da waren, meine Mutter, die Else, und mein Onkel, der Ede, sind am Leben blieben. Der Brut vom Vierlbeck seiner Ersten hat natürlich nix ankönnen, die hat sich gehalten und hat sich breitgmacht auf dem Hof, bis der Onkel Ede das Gfras zehn Jahr später davongscheucht hat. Aber er is halt auch nicht alt worden, der Ede. Noch keine vierzig war der, wie ihn der Tod derwischt hat, ihn, seine Frau und seine Kinder. Wo sie dann alle tot warn, da is von den Schredereder bloß noch meine Mutter übrig gwesen, die Else Schredereder. Und in der nächsten Generation wars nicht anders. Ich bin als Einzige noch da, meine Brüder hat der Krieg gfressen.«
Paula hört einen Doppelseufzer (Lene und Erna simultan) und dann wieder Lenes Stimme: »Schad-E sind draus worden aus unseren Glücks-E. Ich glaub, der Vierlbeck hats verwunschen, dem Saukopf trau ich alles zu.«
Hat Erna Spanagl an dieser Stelle beipflichtend gemurmelt? Paula ist sich nicht sicher. Lene redet bereits weiter: »Trotz die ganzen Heimsuchungen hat sich nie einer getraut, sich gegen das E zur Wehr zu setzen. Ich schon gar nicht. Grad gscheit bin ich mir vorkommen, wie ich meinen Ältesten René taufen hab lassen. Dabei hat das gar kein Mensch richtig aussprechen können; so französisch, wie es sich gehört, vorn mit Ö und einem ganz langen E hinten raus. Wie ›Irene‹ hat sich der Name immer anghört bei den Dorfleuten, ohne das I vorn, weißt.«
Paula schüttelt den Kopf, wie könnte ihre Mutter das nicht wissen. Erna Spanagl hatte ja selbst immer »Rene« gesagt.
»Und was ham dem René die E einbracht?«, fragt Lene in diesem Moment. »Die Kinderlähmung, Erna, die Kinderlähmung!« Sie schreit das Wort so laut heraus, dass Paula verschreckt aus der Flez hinauswetzt, über die Gred jagt und sich hinter die Hollerstaude duckt.
An René kann sich Paula noch gut erinnern. Denn obwohl er fünf Jahre älter war als sie – drei Jahre älter als Paulas Bruder, Franz, und sieben Jahre älter als Paulas Schwester, Ella –, hat er jeden Frühsommer etliche Wettkämpfe im Kirschkern-Weitspucken mit den Spanagl-Kindern ausgetragen. Darüber hinaus gab sich René nur selten mit anderen Kindern ab. Er musste schon als kleiner Junge auf dem Hof mithelfen, musste, so gut es ging, den Vater ersetzen, den, als René acht war, eine Fichte bei der Holzarbeit erschlagen hatte.
Paula fällt wieder ein, dass sie im Weitspucken gegen René nie die mindeste Chance hatte, sosehr sie sich auch ins Zeug legte. Und das ärgert sie immer noch ein bisschen. Dabei hat sie enorme Vorteile aus dieser Übung gewonnen: Sommer für Sommer nahm ihr Lungenvolumen um gut einen halben Liter zu, was ihr bei anderen Gelegenheiten sehr zustattenkam.
René starb, als Paula den ersten Schultag der zweiten Klasse absaß.
Er hatte sich am letzten Ferienwochenende mit Grippe hingelegt. Weil er nach drei Tagen immer noch nicht aufstehen wollte, ordnete Dr.Hartmann, kein Freund von lästigen Hausbesuchen, Zäpfchen gegen das Fieber und Tierkohle gegen den Durchfall an. René schluckte die Kohle und führte das Zäpfchen ein, und am nächsten Morgen konnte er seine Beine nicht mehr bewegen. Dr.Hartmann musste sich auf den Schredereder-Hof bemühen.
Als der Doktor das Entsetzen einigermaßen abgeschüttelt hatte, das ihn befiel, als sich das Wesen von Renés Krankheit vor seinen Augen enthüllte, hatte das Poliomyelitis-Virus René bereits erwürgt.
Dr.Hartmann füllte sofort die vorgeschriebene Meldung für das Gesundheitsamt aus und dann den Totenschein. Nach diesen administrativen Verpflichtungen hatte er sich wieder weit genug in der Hand, um Lene Schredereder auf seine Weise zu trösten: »Sie sollten dankbar sein, dass es so schnell gegangen ist, und froh, dass Sie nicht für den Rest Ihres Lebens mit einem Kind im Rollstuhl belastet sind.«
Unter den zischelnden Blättern der Hollerstaude denkt Paula daran, wie am Tag von Renés Beerdigung ihre ganze Klasse rötlichen Saft zu schlucken bekam.
3.
LENE SCHREDEREDERS WEINEN weht nur noch gedämpft aus dem Küchenfenster, sodass sich Paula unter der Holunderstaude hervorwagt.
Ob einer im Leben Glück hat oder Pech, geht es Paula durch den Kopf, während sie leise zur Haustür schleicht, das hängt eher nicht von einem E, I oder U im Namen ab.
»Das Schicksal kann keiner austricksen«, sagt Großvater Max oft. Und Paula glaubt, dass er damit richtigliegt.
Trotzdem, meint der Großvater, sollen die Schredereder sicherheitshalber bei den E bleiben, weil das seit Langem so Tradition ist bei ihnen.
»Was verstehn wir schon von den Zusammenhängen und Verknüpfungen zwischen Diesseits und Jenseits«, sagt der Großvater, »und schaden tut ein E ganz gewiss keinem.«
Da hat er wohl auch recht.
»Das E ist den Schredereder dienlich.« Diesen Satz hörte Paula einmal in ihrem Kopf, und er blieb dort hängen. Paulas Gedanken flüsterten darüber hinaus noch dies und das von Buchstaben und Zahlen und der Magie, die ihnen innewohnt. Aber die ganze Sache schien Paula sehr kompliziert, und zügig verdunstete die Botschaft.
Paula durchquert die Flez und legt die Hand auf die Klinke der Stubentür. Sie hört Lene leise schluchzen und beschließt, lieber doch noch ein bisschen zu warten. Hineingehen oder draußen bleiben, beides könnte gleich falsch sein. Das hängt ganz von Erna Spanagls Laune ab. Das Beste ist, abzuwarten, bis sie »Paula« ruft, und dann wieselflink aufzukreuzen.
Müde setzt sich Paula auf die hölzerne Truhe, in der Erna Spanagl Kernseifenstücke, Bürsten und Putztücher aufbewahrt, und malt unsichtbare E auf die Zierleiste am Deckel.
Jahraus, jahrein haben sich die Schredereders an ihre E geklammert wie die Gotländer an ihre Runen. Lieber ließen sie eine »Emele« ins Geburtenregister eintragen oder einen »Henz«, als dem I oder sonst einem Vokal eine Chance zu geben. Aus dem gleichen Grund blühen auch bei Schredereders ausschließlich Verbenen in den Balkonkästen und im Vorgarten.
Das Unglück aber traf sie mit der gleichen statistischen Wahrscheinlichkeit wie die Simmets, die Ellerschwangs und die Semaus vom Schloss. Diese Behauptung lässt sich stichhaltig beweisen, und zwar anhand des Sterberegisters. Darin ist eindeutig belegt, dass das Kindbettfieber, das zwischen 1920 und ’23 in Klausenstetten jede dritte Wöchnerin hinwegraffte, weder Bette Schredereder noch ihre Schwester Gele verschonte. »Zweifellos«, hatte Dr.Hartmann ausgerufen, als Lene die Sache einmal zur Sprache brachte, »all die Frauen sind ja nicht wegen einem E gestorben, sondern wegen den dreckigen Händen der Hebamme. Ignaz Semmelweiß, der die Kontaktinfektion als Ursache des Kindbettfiebers erkannt hatte und vehement für Hygiene beim Kampf gegen die Mikroben eintrat, ist verlacht und verspottet gut fünfzig Jahre zuvor in einem Wiener Irrenhaus gestorben. Wie hätte da ausgerechnet die Vierlbeck-Hebamme wissen sollen, dass sie eigenhändig den Tod von Haus zu Haus trug?«
Natürlich hatte sie keine Ahnung davon, die Vierlbeck-Hebamme, und die Klausenstettener erst recht nicht. Sie vertrauten ihr lange Zeit. Zu Recht, denn sie war eine gute Hebamme, kannte sich mit Heilkräutern besser aus als sonst jemand im ganzen Landstrich. Die Vierlbeck-Hebamme hatte so manchen Blutstrom gestillt, bevor er das Leben aus einer Wöchnerin herausschwemmen konnte.
Aber als das Kindbettfieber eine Klausenstettenerin nach der anderen um die Ecke brachte, brauchte man einen Sündenbock. Buchstaben, aus welchem Teil des Alphabets auch immer, konnten nicht bestraft werden, blieb also nur die Hebamme. Die Klausenstettener taten sich in diesem speziellen Fall mit den Hohenstettenern zusammen, beratschlagten ausgiebig, kamen einvernehmlich zu dem Ergebnis, dass durch Hexenwerk und Teufelskunst der weisen Frau alle Weisheit abhandengekommen war, und jagten sie aus ihrem Bezirk. »Man muss sie«, lautete das Edikt, »nachhaltig daran hindern, eine unserer Pfarreien um die andere auszurotten.«
Einem, der durchblickt und begreift, könnte das Sterberegister von Klausenstetten eine ganze Menge erzählen. Es würde ihm zum Beispiel von E-beschirmten Schredereders berichten, die genauso wie ihre E-losen Artgenossen an der Syphilis eingingen.
Der Teufel weiß, bei welcher Hure sich Ede Schredereder, Elses Bruder – er war damals knapp dreinunddreißig Jahre alt –, im Sommer 1922 die Spirochäten eingefangen hat. Fünf Jahre später jedenfalls starb er als paralytisches Wrack, nicht ohne vorher seine komplette Familie und ein Dutzend junger Mädchen aus dem Umkreis infiziert zu haben.
Kein noch so gut meinendes E konnte die Schredereder-Töchter vor der inzestuösen Geilheit ihres Schanker-verseuchten Vaters retten. Oder fühlten sich die E einfach nicht zuständig für den Ede und die Seinen, weil der Ede ein Bankert war, dem Vierlbeck im Jahre 1889 von Elses Mutter-gottselig untergeschoben? Ede war der Sohn des Kesselflickers. Ede brachte in den Zwanzigern die Syphilis nach Klausenstetten, und es gab kein Mittel dagegen.
Im Amerika rückte man zu dieser Zeit der Mikrobe, die unter dem Mikroskop aussieht wie ein Korkenzieher, mit Fiebermaschinen zu Leibe. Das war sehr gewitzt, denn Spirochaeta verträgt Hitze nicht so gut. Kislig und Simpson befieberten also ihre Syphilitiker so lange mithilfe von Strom aus der Steckdose, bis die Mikrobe einging; zwei, drei Brandwunden war ihnen das allemal wert.