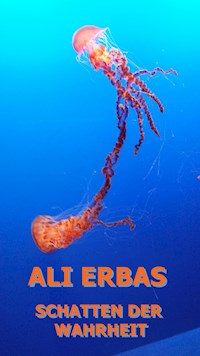
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Münchner Arzt Dr. Kayahan macht die Beobachtung, dass Jahre nach einer Gallenblasenoperation bei zwei seiner Patienten die rechte Niere nicht mehr zu finden ist. Er vermutet zuerst ein noch unbekanntes medizinisches Phänomen und bittet den Chefarzt des renommierten Krankenhauses München Mitte um fachmännischen Rat. Damit hat er sich den falschen Ansprechpartner herausgesucht. Denn seit diesem Zeitpunkt gerät sein Leben aus den gewohnten Bahnen. Anschläge und Übergriffe auf ihn und seinen Besitz bestimmen von nun an seinen Alltag. Er gibt jedoch nicht auf. Er verfolgt jede Spur mit vollem Engagement und setzt all die Puzzleteile zusammen; dabei macht er eine völlig unerwartete Entdeckung…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ali Erbas
Schatten der Wahrheit
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
- PROLOG -
- KAPITEL 1 -
- KAPITEL 2 -
- KAPITEL 3 -
- KAPITEL 4 -
- KAPITEL 5 -
- KAPITEL 6 -
- KAPITEL 7 -
- KAPITEL 8 -
- KAPITEL 9 -
- KAPITEL 10 -
- KAPITEL 11 -
- KAPITEL 12 -
- KAPITEL 13 -
- KAPITEL 14 -
- KAPITEL 15 -
- KAPITEL 16 -
- KAPITEL 17 -
- KAPITEL 18 -
- KAPITEL 19 -
- KAPITEL 20 -
- KAPITEL 21 -
- KAPITEL 22 -
- KAPITEL 23 -
- KAPITEL 24 -
- KAPITEL 25 -
- KAPITEL 26 -
- KAPITEL 27 -
- KAPITEL 28 -
- KAPITEL 29 -
- KAPITEL 30 -
- KAPITEL 31 -
- KAPITEL 32 -
- KAPITEL 33 -
- KAPITEL 34 -
- KAPITEL 35 -
- KAPITEL 36 -
- KAPITEL 37 -
- KAPITEL 38 -
- KAPITEL 39 -
- KAPITEL 40 -
- KAPITEL 41 -
- KAPTEL 42 -
- KAPITEL 43 -
- KAPITEL 44 -
- KAPITEL 45 -
- KAPITEL 46 -
- KAPITEL 47 -
- KAPITEL 48 -
- KAPITEL 49 –
- KAPITEL 50 -
- KAPITEL 51 -
- EPILOG -
Impressum neobooks
- PROLOG -
Donnerstag, 15. November 2001. Bereits seit den frühen Morgenstunden zeigte sich über München ein wolkenloser, blauer Himmel. Die gemächlich im Osten aufgehende Sonne schickte ihre wohltuenden Strahlen auf München und ließ die Temperaturen langsam nach oben klettern.
In einem modernen Krankenhaus mitten in der Stadt wurden bereits am Tag zuvor die für die bevor stehende Operation notwendigen Unterlagen sowohl von dem Patienten als auch von dem Anästhesisten vollständig ausgefüllt und unterschrieben. Sie steckten nun unter dem Kopfkissen des Patienten, der mit glasigen Augen die Decke betrachtete.
Die Spritze, die er von der Stationsschwester bekommen hatte, ermüdete ihn zwar, reichte aber nicht aus, ihn in Schlaf zu versetzen. Er schwebte in einem hypnoseähnlichen Zustand und sein Gehirn arbeitete nur noch auf halber Flamme, so dass er die blechern klingenden Stimmen um ihn herum kaum wahrnahm.
Wie lange lag er bereist in dem Vorraum des Operationssaales Nummer eins? Zehn Minuten? Eine halbe Stunde? Oder mehrere Stunden? Er wusste es nicht. Er hatte kein Zeitgefühl.
„Grüß Gott, mein Name ist Dr. Dieter Schulze. Ich bin Ihr Anästhesiearzt“, sagte eine männliche Stimme, die freundlich klang.
Der Patient wusste nicht, ob es sich bei dieser Stimme um eine reelle Wahrnehmung oder um eine Halluzination handelte. Mühsam drehte er seinen Kopf ein paar Zentimeter in die Richtung, aus der die Stimme kam. Hinter einer Nebelschwade erkannte er ein unbekanntes Gesicht, das einem hochgewachsenen Mann mit einer OP-Haube gehörte.
Der Mann sprach weiter, ohne zu wissen, ob der Patient ihn verstand oder nicht. „Gestern Abend hat ja der Chirurg Sie über die bevorstehende Operation eingehend informiert. Sie wissen, dass Sie einige Steine in der Gallenblase und sozusagen steinreich sind.“
Der Gesichtsausdruck des Patienten blieb unverändert, so dass der Anästhesist über den eigenen Witz alleine lachen musste. „Und nun“, fuhr er fort, „müssen Sie meine Kollegin, die gestern mit Ihnen die Narkose besprochen hat, entschuldigen. Aufgrund einer persönlichen Angelegenheit konnte sie heute leider nicht hier sein. Daher werde ich an ihrer Stelle die Narkose bei Ihnen durchführen. Ich hoffe, Sie sind damit einverstanden.“
Das Ganze klang nach einem Urteil, das bereits schon lange zuvor gefällt war. Der Patient musste sich einfach damit für einverstanden erklären. In seinem Trancezustand blieb ihm keine andere Alternative.
Dr. Schulze nahm die ausgefüllten Unterlagen in die Hand, schob seine Kunststoffbrille auf seinem Nasenrücken zu Recht und überflog die wichtigsten Eintragungen.
Eine Frau etwa Mitte zwanzig mit einem schlanken Gesicht und mit der Tusche perfekt halbbogenförmig nachgezogenen Augenbrauen, ebenfalls in einem grünen OP-Anzug, kam in eiligen Schritten zu ihm und blickte auf den Patienten herab. „Ist das die Gallenblase?“, fragte sie den Anästhesisten.
„Ja, das ist der Patient“, antwortete Dr. Schulze genervt und betonte dabei das Wort der Patient. Er ärgerte sich jedes Mal, wenn das medizinische Personal und vor allem die Anästhesieschwestern von einem Organ oder einer Krankheit sprachen, wenn sie damit einen Patienten meinten. Die Ausdrücke, wie „das ist der Magen“ oder „das ist das Bein“, lösten bei ihm regelmäßig einen Wutanfall aus. Er atmete mit hörbarem Pfeifen einige Male tief ein und aus und schloss für etwa zwei Sekunden die Augen. Dadurch gelang es ihm, doch noch einen Wutanfall zu unterdrücken.
Die Anästhesieschwester nickte mit dem Kopf und entschuldigte sich mit reumütigen Blicken. „Sind Sie schon fertig mit dem Patienten?“, fragte sie dann leise.
Dr. Schulze antwortete nur mit einem Kopfnicken und legte seine Hände auf die vordere Querstange des Bettes. Zusammen schoben sie das Patientenbett in den Zwischenraum. An mehrere Metallständer hingen Infusionsflaschen mit Kochsalzlösung.
Die Anästhesieschwester näherte eine der beiden fahrbaren OP-Liegen ans Patientenbett. Sie legte ihre rechte Hand vorsichtig unter den Nacken des Patienten.
„Würden Sie bitte auf diese Liege rutschen?“, sagte sie nun mit etwas kräftigerer Stimme.
Die Wirkung der Spritze, die der Patient auf der Station bekommen hatte, erreichte inzwischen ihr Maximum, so dass er kaum eine Reaktion zeigte. Er hatte schon die Augen geschlossen und schlief mit leicht offenem Mund.
Die Schwester verdrehte die Augen wie bei einem Kind und beschwerte sich bei Dr. Schulze über die Schwestern auf der Station. Sie warf ihnen Unfähigkeit vor, die Medikamentendosis an das Gewicht des Patienten anzupassen.
Der Anästhesist kicherte leise und gab ihr zu wissen, dass sie zu Übertreibungen neige.
Das Umbetten des Patienten auf die OP-Liege ging ziemlich schnell. Die Anästhesieschwester band ihren Mundschutz am Hinterkopf fest und schob anschließend die Liege in den OP-Saal I. Mit der Blutdruckmanschette staute sie den Arm des Patienten und steckte anschließend eine dicke Nadel in eine prall gefüllte Vene an der Ellenbeuge. Es dauerte nicht einmal eine Minute und die Infusion lief bereits in die Vene.
Drei Plastikelektroden leiteten über dünne Kabel die Herzaktivität an einen EKG-Monitor, auf dem eine hellgrüne Linie mit Zacken von links nach rechts wanderte. Ein rotes Lämpchen piepste im Rhythmus des Herzschlages.
„Sind wir soweit?“, fragte einer der beiden Chirurgen, die mit frisch desinfizierten Händen den Operationssaal betraten.
„Schon längst, Herr Chefarzt“, log Dr. Schulze.
Der Bauch wurde mit einer braunen Flüssigkeit gründlich desinfiziert und anschließend bis auf das Operationsgebiet mit sterilen Tüchern abgedeckt.
Der Chefarzt nahm das Skalpell in die rechte Hand, warf einen Blick auf die Uhr am Monitor und sagte: „Schnitt!“
Die scharfe Klinge wanderte in einem feinen Bogen am rechten Oberbauch des Patienten und hinterließ eine lange vom Mittelbauch bis in die rechte Flanke klaffende Wunde. Blut spritzte. Die Chirurgen unterbanden die Blutungen mit einer elektrischen Sonde, die bei jeder Berührung der Pinzette ein zischendes Geräusch verursachte.
Beide Chirurgen sprachen kaum miteinander und arbeiteten schnell. Die Stille im OP-Raum wurde nur von dem Piepsen des EKG-Monitors und des Beatmungsgerätes unterbrochen. Nach circa 90 Minuten war die Operation vorbei. Die Wunde wurde Schicht für Schicht verschlossen. Der Anästhesist entfernte den Tubus aus dem Rachen des Patienten und klopfte auf sein Gesicht. Sobald er selbständig zu atmen begann, schob ihn die Anästhesieschwester in den Aufwachraum zur weiteren Beobachtung.
Die beiden Chirurgen begaben sich unter Begleitung des Anästhesisten und der Anästhesieschwester umgehend in den Operationssaal II und fingen, nachdem sie erneut frische Anzüge und Handschuhe angezogen hatten, sofort mit der nächsten Operation an.
In diesem Operationsraum herrschte andere Arbeitsatmosphäre. Sowohl die Chirurgen als auch der Anästhesist sprachen unter lauten Gelächtern miteinander und tauschten Witze aus.
„Wie geht es dem Patienten draußen?“, fragte einer der Chirurgen nach etwa einer halben Stunde.
„Mist, ich habe ihn total vergessen“, antwortete die Anästhesieschwester und lief sofort heraus. Kaum war sie draußen, so hörte man ihre durchdringenden Schreie. „Herr Doktor schnell … Schnell … Er atmet nicht mehr!“
Der Anästhesist lief heraus und sah den Patienten, der eben operiert wurde, in einem kreideblassen Zustand. Durch die geschlossenen Augenlider war nur ein schmaler Streifen der weißlichen Skleren sichtbar. Kleine Schweißperlen bedeckten seine Stirn. Er atmete kaum noch. Ein Krampfanfall setzte gerade ein. Der Blutdruck war nicht messbar. Der EKG-Monitor zeigte unregelmäßige Zacken im Sinne von frustranen Herzaktivitäten. Das rote Lämpchen blinkte ohne irgendeinen erkennbaren Rhythmus und setzte immer wieder für längere Intervalle aus.
Der Anästhesist drehte sofort die langsam tropfende Infusion voll auf und ließ die restliche Flüssigkeit in der Plastikflasche schnell durchlaufen. Er legte noch zwei Infusionen dazu. Mit Hilfe der Helferin schob er den Patienten sofort in den OP-Saal I zurück.
Der Patient wurde wieder intubiert und an das Atemgerät angeschlossen. Die Sauerstoffsättigung im Blut zeigte nur noch 57%. Es folgten mehrere Injektionen über die noch in der Vene liegende Nadel.
Einer der Chirurgen kam zu ihnen mit vor der Brust gehaltenen Händen. „Was ist los?“, fragte er gelassen, als würde er sich nach der Wetterlage erkundigen. Die Stimme gehörte dem Chefarzt.
„Dem Patienten geht es miserabel. Die Sauerstoffsättigung fällt rapide ab. Der Blutdruck ist nicht messbar“, antwortete der Anästhesist, der immer noch mit seinen Spritzen herumhantierte.
„Woran liegt es denn?“, fragte diesmal der Chefarzt und blickte auf den Monitor. Die grünen Zacken sahen wüst aus.
„Ich glaube, er hat innere Blutungen. Ich denke, eine der Nähte ist insuffizient oder aufgegangen.“
Der EKG-Monitor spielte verrückt. Das Gepiepst bestand nur noch von rasenden und dann aussetzenden Intervallen ohne jeden Rhythmus. Der Zustand des Patienten verschlechterte sich zunehmend. Jetzt liefen die Infusionen nicht mehr. Die Vene, in der die Nadel steckte, bekam eine bläuliche Verfärbung. Eine dicke Beule trat hervor.
Dr. Schulze hatte keine Zeit, nach einer neuen Vene zu suchen. Der Patient benötigte ein großkalibriges Blutgefäß. Für ihn kam nur noch ein Subclavia-Katheter in Frage, auch wenn es sich hierbei um ein gefährliches Manöver handelte. Er musste es riskieren. Es gab keine Alternative. Über einen solchen Katheter hatte er zumindest die Möglichkeit, jede Menge Flüssigkeit, Kolloidlösungen, Blut und, was noch alles zur Verfügung stand, zu infundieren.
Inzwischen gesellte sich auch der andere Chirurg dazu. „Sieht es schlimm aus?“, fragte er, nur um gesprochen zu haben.
„Er geht uns verloren“, antwortete der Anästhesist hektisch.
„Wir müssen dann den Operationssitus revidieren. Machen wir es schnell“, schrie der Chefarzt und griff nach einem Skalpell.
Der Patient wurde an den Nahtstellen schnell aufgeschnitten, ohne auf die Verhältnisse der Sterilität zu achten. In diesem Fall mussten sie alle Regeln des sterilen Arbeitens missachten.
Eine erschreckende Szene überraschte die Ärzte. Der Anästhesist hatte mit seiner Vermutung völlig Recht. Der gesamte Bauchraum bestand nur noch aus einem See von Blut. Ein paar luftgefüllte Darmschlingen schwammen wie eine Schlange in der Blutlache. Das Blut stieg höher, sobald der Chefarzt seine Hände in die Wunde steckte, um sich an den Organen zu orientieren. Der Oberarzt steckte die Düse des Saugers in die rote Flüssigkeit. Ein schlürfendes Geräusch wirkte gespenstisch und erfüllte den Raum. Unter der zu bewältigenden Blutmenge setzte er immer wieder aus.
Die Chirurgen stopften mehrere grüne Tücher zwischen den Darmschlingen. Das Rot des frischen Blutes vermischte sich mit dem Grün und bildete eine rostbraune Farbe wie auf einem Wandbild aus dem Mittelalter.
Kaum im Betrieb klang das Schlürfen des Saugers wie das Krächzen eines Motorrollers, der einen steilen Hang zu meistern hatte. Es gab ein dumpfes Blubb. Und Stille. Er gab seinen Geist auf.
„So ein Scheißding“, schrie der Oberarzt wutentbrannt und schleuderte den Schlauch auf den Boden. Die Anästhesieschwester rannte in den OP-Saal nebenan und holte einen neuen Sauger. Keine Zeit verlieren. Weiter saugen.
Die hektische Arbeit der Chirurgen wurde regelmäßig von dem verzweifelten Geschrei, wie „Saugen, saugen… Tuch… schnell noch eins… wo bleibt das Tuch, verdammt noch mal?“ begleitet.
Den Chirurgen gelang es nicht, die Blutungsquelle auszumachen. Sie saß irgendwo und wurde von der roten Flüssigkeit bedeckt.
„Absaugen, absaugen… hier“, befahl der Chefarzt dem zweiten Operateur. Der Oberarzt bewegte die Öffnung des Schlauches an die Stelle. Das Schlürfen wurde lauter und machte den Chefarzt noch nervöser.
Die OP-Schwester warf einen Blick auf das Gefäß, in dem das gesaugte Blut gesammelt wurde. Es war voll. In dem Moment schaltete der Sauger automatisch ab.
„Was ist denn nun, verdammt?“, schrie der Oberarzt.
„Das Gefäß ist voll“, antwortete die Schwester.
„Worauf warten Sie denn? Wechseln Sie es aus!“, befahl er.
„Keine Zeit“, mischte sich der Anästhesist ein, „wir verlieren ihn.“
Der Oberarzt schleuderte den Schlauch des Saugers durch den Raum, so dass das ganze Gerät umkippte und langsam wegrollte.
Die Chirurgen steckten nun ihre Hände in die auseinanderklaffende Wunde und drückten blind irgendwelche Strukturen zusammen.
Die Flüssigkeit in den Infusionsflaschen lief mit einer rasanten Geschwindigkeit in den Subclavia-Katheter des Patienten. Die Anästhesieschwester wechselte sie, ohne darauf zu achten, ob sie vollständig leer waren.
Das Piepsen am Monitor war nun unzählbar schnell. Er ähnelte mehr einem Dauerton. Die grünen EKG-Zacken verliefen sehr unregelmäßig und hatten eine Haarnadelform.
Der Anästhesist spritzte immer wieder irgendwelche Medikamente in den Katheter. Die Haut des Patienten schimmerte unter den OP-Lampen wächsern. Die Sauerstoffsättigung zählte wie beim Countdown für den Start einer Rakete abwärts.
„Wir müssen ihn defibrillieren!“, schrie der Anästhesist. „Also los“, befahl er seiner Helferin, die im Nu den Defibrillator heranschaffte.
Alle entfernten sich aus der Nähe der Liege. Dr. Schulze legte die Paddles, nachdem die Schwester sie mit einem Gel befeuchtete, auf den Brustkorb und lud dann die Energie auf.
„Alle weg, weg“, befahl er. „Eins, zwei und Stoß!“
Der Oberkörper des Patienten hob sich nach der Energieentladung einige Zentimeter von der Unterlage ab. Die Kurve am Monitor änderte sich nicht. Der nächste Stoß folgte; diesmal mit höherer Energie. Ebenfalls ohne Erfolg. Dann noch eine und noch eine… Immer wieder höhere Energien wurden abgegeben. Der Oberkörper hob sich bei jedem Stoß von der Unterlage ab.
„Hören Sie auf“, flüsterte der Chefarzt resigniert. Seine Augen blickten ratlos auf den Boden. „Hören Sie auf. Es hat keinen Sinn mehr.“
„Ja, da haben Sie Recht“, antwortete Dr. Schulze ebenfalls resigniert und legte die Paddles auf den Defibrillator.
Aus und Amen. Alle Maßnahmen für die Katz.
Sie hatten den Patienten nicht retten können. So schnell verwandelte sich ein lebendiger Körper in eine Leiche. Ein winzig kleiner Fehler und er verabschiedete sich für immer.
Der blutverschmierte Körper lag nun leblos auf der Liege. Die Haut glänzte eigenartig, flau, unnatürlich.
Die Ärzte schauten mit müden und traurigen Blicken einander. Die Realität kreiste grausam über ihren Köpfen. Es gab kein Zurück mehr. Ihnen blieb nun nur noch ein einziger Schritt:
Die Wunde zuzunähen.
- KAPITEL 1 -
Iskenderun (Türkei), April 1979
„Nein, nein, nein… Ich werde nicht weinen!“, sagte er mit einer nur für ihn hörbaren Stimme, als würde er Selbstgespräche führen. Gelegentlich hielt er aber auch inne, so dass kein Ton aus seinem kleinen Munde herauskam. Seine Zunge bewegte sich jedoch immer wieder, auch wenn er seine Lippen stillhielt.
Aus seinem Gehirn schossen wie wild Befehle zu seinen Tränendrüsen, dass sie ohne Wenn und Aber trocken zu bleiben haben.
Der zwölf Jahre alte Emin-Can Kayahan, hockte in der Ecke des ca. 20 qm großen Zimmers und kämpfte mit sich, um nicht zu weinen. Seine Unterarme umklammerten die angewinkelten Knie und stützten dabei den Kopf mit den kurz geschnittenen Haaren. Die Beine zitterten unter dem Gewicht des Kopfes, als bestünde er aus purem Eisen.
Die durch das Fenster im Raum hinein dringenden Sonnenstrahlen schienen genau auf den Kopf, so dass seine hellen Haare noch heller aussahen.
Er wagte nicht, die Augen zu öffnen. Die Furcht, er könnte doch noch weinen, bereitete ihm großes Unbehagen. Er wollte nicht mal für eine Millisekunde die Umgebung wahrnehmen. Daher schloss er die Augenlider immer fester und immer fester, bis sie schmerzten.
Angst lag bereits von der Geburt an in seiner Natur. Er stritt seine Ängstlichkeit niemals ab und gab es offen zu. In Momenten, in denen er jedes Leid zu überwinden hatte, entwickelte er allerdings ungeheure Kräfte, so dass er nicht nur seine Gefühle, sondern auch seinen Körper völlig in Griff bekommen konnte. Weinen bedeutete für ihn nichts Anderes als Schwäche, Ratlosigkeit, Resignation. Das Geheul und Gekreische seiner Mutter und der beiden Schwestern ärgerten ihn bereits seit Morgenstunden. Er spürte wie ihre Laute in seinem Gehirn hämmerten und in seinem Gehörgang scheuerten, als bestünden sie nicht aus irgendwelchen physikalischen Wellen, sondern aus grobem Sandpapier, das hin und her geschoben wurde.
Dass das Weinen nur ein Begleitphänomen für Trauer oder aber für Freude darstellte, wusste Emin bereits seit der ersten Schulklasse. Damals starben seine Großmutter und die ganze Verwandtschaft weinte tagelang. Was hatte es gebracht? Nichts. Gar nichts. Die Oma kam nicht zurück.
Also, wozu denn weinen, fragte er sich immer wieder, wenn es ehe nichts bringt? Mit Weinen konnte man nichts erreichen. Das galt für seine Mutter, für seine Schwestern und ohne Ausnahme für alle Menschen. Daher fragte er sich, wie es wohl wäre, wenn seine Mutter und seine beiden Schwestern mit dem ganzen Geheul aufhören würden? Gab es eine bessere Lösung? „Nein“, flüsterte er.
Wie sollte er allerdings seine Mutter, die am lautesten weinte und ihre Hände wie ein Trauerweib in regelmäßigen Rhythmen auf das Gesicht schlug, zum Schweigen bringen? Und auch noch seine beiden Schwestern? Durfte er einfach aufstehen und mit einer harschen Stimme allen den Befehl erteilen, nicht mehr zu weinen? „Nein“, flüsterte er ebenfalls mit einer nicht hörbaren Stimme.
Er hob seinen Kopf hoch und wagte nun doch noch einen verstohlenen Blick in Richtung seines Vaters.
Der Vater, einst der stärkste Ringer des Dorfes, der nie einen Kampf verloren hatte und deswegen den Namen Der Sieger bekam, lag bereits seit mehr als drei Stunden im Bett und kämpfte mit dem Tod. Aus seinem weit offenen Mund kamen röchelnde Atemgeräusche, als würde jemand ihm die Kehle zudrücken.
Emin erkannte ein paar von Karies zersetzte Zähne am Oberkiefer. Die halb geschlossenen Augen zeigten einen dezenten Streifen der honiggelben Skleren, die in der Mitte in einen bräunlich-grünen Bogen der Iris übergingen. Die Wangen wiesen tiefe Gruben und ließen die Backenknochen deutlich hervortreten. Der einstig unschlagbare Ringer Hasan Kayahan bestand nun nur noch aus Haut und Knochen.
In dem Moment, als Emin die Augen wieder schließen wollte, wurde sein Vater erneut von einem kräftigen Schüttelfrost erfasst. Das ganze Bett bebte. Sein Körper verkrampfte sich. Der Oberkiefer ging auf und zu und klopfte wie ein Hammer regelmäßig auf die Unterlippe, die sich in den Mund hinein stülpte und blutete.
Die Mutter, die vom ständigen Schreien und Weinen inzwischen heiser war, schlug kräftiger auf ihr Gesicht. Es hat sich von den ganzen Schlägen dunkel rot verfärbt und zeigte stellenweise bläuliche Flecken. „Gott, hilf uns bitte! Gott, bitte… Bitte…!“ krächzte sie immer wieder zwischen ihrem Schluchzen.
Emin blickte vorwurfsvoll auf seine Mutter. „Wie kann man so viel weinen?“, ging ihm durch den Kopf. Prompt kam ihm irgendwoher die Antwort: „Weiber!“
Der Vater zitterte immer noch. Der Anfall hatte jetzt seinen Gipfel erreicht. Emin konnte das Beben des Bettes sogar bis in die Ecke spüren. Der Boden leitete es weiter.
„Ein Erdbeben müsste sich genauso fühlen. Vielleicht etwas stärker“ dachte Emin. Seine Blicke blieben während der gesamten Schüttelattacke auf seinem Vater haften. Mit müden Augen beobachtete er, wie ein neuer Krampf ihn vereinnahmte. Sein Körper bildete einen leichten Bogen wie eine Brücke. Der Kopf und die Füße berührten die mit getrocknetem Heu gefüllte Matratze. Die oberste Decke mit Blumenmuster wanderte mit dem Körper zusammen ebenfalls nach oben und rutschte zur Seite. Sie fiel geräuschlos auf den Boden.
Emin wartete einige Sekunden. Er stand auf und hob sie auf. Er legte sie auf die anderen Decken. Nun konnte er direkt auf das Gesicht seines Vaters schauen. Er sah wie Speichel ihm seitlich am Mund auf das Kissen rann.
Als er sich wieder hinsetzen wollte, begann sein Vater zu husten. Dieses neue Symptom veranlasste ihn, sich umzudrehen. Der Husten nahm an Intensität zu. Emin sah, wie mit jedem Husten Bluttropfen aus seinem Mund herausspritzten. Sie landeten auf der Decke, die er eben aufgehoben hatte, und wurden schnell abgesaugt, so dass sie dann nur noch aus einem roten Fleck bestanden.
Die Mutter hörte nun auf zu weinen. Ihre geröteten Augen ohne jeden Glanz ähnelten einem verwelkten Apfel. Leblos und matt. Mit einer für ihren Körper überraschend flinken Bewegung packte sie ihr Kopftuch, riss es herunter und sprang zu ihrem Mann. Sie presste das mit Pailletten gestickte Tuch sanft auf seinen Mund und fing die herumspritzenden Bluttropfen auf.
Nach einigen Minuten ging der Husten zurück und mit ihm sowohl der Krampf als auch der Schüttelfrost.
Emin, seine Mutter und die beiden Schwestern standen nun nebeneinander und schauten ängstlich auf den Körper, der reglos im Bett lag. Er atmete. Die Spannung auf ihren Gesichtern lockerte sich. Ein röchelndes „mir geht es besser“ brachte sie zu einem schwachen Lächeln.
Der Vater schlug seine Augen auf und betrachtete mit müden Augen seine Familie. Das Lächeln auf den Lippen war kaum wahrnehmbar. Er schlug seine Lider ein paar Male auf, um anzudeuten, dass er sein Bewusstsein wiedererlangt hatte.
Als sich die ganze Familie an diesem Tag erschöpft zum Schlafen legte, war es erst kurz nach 21 Uhr. Die Sonne war bereits seit zwei Stunden verschwunden und spendete ihr Licht nur über den hell scheinenden Mond, der wie ein gelber von einem grauen Nebelkreis umgebener Plastikball am Himmel hing.
Durch die offenen Fenster wehte zwar gelegentlich eine Brise frischer Luft. Diese reichte aber nicht aus, das Zimmer auch nur um ein paar Grad zu kühlen. Alle vier schwitzten, auch ohne Decke.
Seit Jahren zum ersten Mal gingen alle vier so früh ins Bett. Sie fühlten sich erschöpft und ausgelaugt. Die Mutter legte sich, wie nach jedem Anfall nicht neben ihren Mann, sondern neben Emin auf den Boden. Das einzige, allerdings auch schon in die Jahre gekommene Bett belegte Emins Vater alleine. Für die anderen dienten einige flach gepresste Sitzkissen als Unterlage.
Die Mutter, Hülya Kayahan, war zwar erst 46, sah aber aufgrund ihres faltenreichen Gesichtes wesentlich älter aus. Zahlreiche graue Strähnen ließen die langen schwarzen Haare stumpf erscheinen. Ihre letzte Behandlung mit Henna lag bereits Monate zurück.
Emin konnte trotz Müdigkeit nicht einschlafen. Er lag rücklings auf den harten Kissen und gähnte ununterbrochen. Mit jedem Gähnen liefen ihm Tränen seitlich von den Augen in die Schläfen. Er ärgerte sich über die Tropfen, die ihm bis in sein Ohr liefen und einen fürchterlichen Juckreiz verursachten.
Beide Hände unter dem Kopf gelegt, betrachtete er die abgeblätterte Decke. Sie hatte eine seltsame Farbe; eine Mischung aus blau, gelb und orange. An den Stellen, an denen der Anstrich fehlte, sah Emin den grauen Beton. Durch die verschiedenen Farben konnte er immer wieder neue Figuren ausfindig machen.
Dort, wo die Decke an der rechten Wand endete, machte er einen Löwenkopf mit wogender Mähne und spitzen Zähnen aus. Gleich daneben entdeckte er eine grau-schwarze Katze und auf ihrem Rücken eine Henne, die ihre Flügel ausbreitete, als wollte sie versuchen, abzuheben. Seine Augen wanderten nach links und er sah einen Haufen von Punkten; kleine, große, runde, viereckige… er versuchte, sie miteinander zu verbinden und neue Figuren zu konstruieren. Er zog verschiedene virtuelle Linien und Bögen zwischen den einzelnen Punkten. Er musste sich konzentrieren. Denn er wollte unbedingt ein Bild von einem Schiff malen. Ein Schiff mit vielen Segeln, die sich von dem starken Wind aufblasen und es so schnell fahren ließen, dass das Wasser in zwei Fontänen hoch spritzte.
Er merkte nicht, wie seine Augen zunehmend kleiner wurden. Die virtuellen Linien, die er mühsam in alle Himmelsrichtungen gezogen und mit denen er die Punkte verbunden hatte, verschwanden langsam und lösten sich im Nebel auf.
Er schlief ein.
Er wusste nicht mehr, wovon er geträumt hatte. Besser gesagt, ob er überhaupt geträumt hatte, als er durch das laute Schreien seiner älteren Schwester Ikbal aufgeweckt wurde.
„Mutter, Mutter, steh auf! Ich glaube, mein Vater atmet nicht mehr!“ Ihre Stimme klang heiser. Sie zitterte.
Ein undeutliches „Wie? Was“ kam aus dem Munde der Mutter, die gerade von ihrer Jugend träumte; wie sie ihren Mann auf dem Feld in Adana beim Baumwollpflücken traf. Sie war damals erst 17 und hatte keine Ahnung von der Liebe. Sie dachte, sie würde aus allen Wolken fallen, als er sie mit seinen bräunlich-grünen Augen betrachtete. Sie waren so sanft, so menschlich und so warm. Seine Blicke erregten bei ihr ein Schwindelgefühl. Sie kam sich vor wie in einem Boot, das von großen Wellen geschaukelt wurde und jederzeit zu kentern drohte. Ein Mann und ein Blick… und sie wusste auf einmal, was Liebe bedeutete. Sie träumte von der Hochzeit; wie sie auf einem schwarzen, mit vielen farbigen Bändern aus Seide geschmückten Pferd in das Haus ihres Mannes kam. Während des ganzen Ritts lief Hasan neben ihr her und hielt ihre Hand. Er schaute immer wieder zu ihr hoch und lächelte, so dass seine schneeweißen Zähne zum Vorschein kamen. Sie spürte, wie sich die wohltuende Wärme seiner Hand ihr Herz erfrischte. Obwohl die Sonne ihre heißesten Strahlen auf sie herunterschickte, war es ihr nicht heiß. Hasans Nähe übertraf die Wirkung der Sonne.
„Mutter! Mutter! Wach doch auf!“ schrie die Schwester mit zunehmender Panik.
Die Mutter machte ihre Augen auf und betrachtete eine Zeitlang ihre Tochter mit verschlafenen Augen, als wollte sie sie fragen: „Wo bin ich denn?“
„Was sagst du?“, krächzte sie dann mühsam. Ihr trockener Hals hinderte sie beim Sprechen.
„Ich glaube, Vater ist tot“, antwortete die Tochter aufgeregt. „Ich glaube, er atmet nicht mehr.“
Hülya richtete sich sofort auf und ging zu ihrem Mann, der zusammen gekrümmt im Bett lag.
Sein Mund und die Augen waren offen. Die Lippen bläulich verfärbt und trocken. Vertrocknete Blutreste bedeckten die Risse. Die Haut sah blass aus, mehr grau als gelb. Auf dem Kopfkissen lagen büschelweise Haare, als hätte er eben mit einer stärkeren Person gekämpft, die sie ihm ausgerissen hatte.
Ein durchdringendes „Neinnnn…!“ erschreckte Emin. Seine weiten Pupillen verengten sich zu einem winzigen schwarzen Punkt. Er suchte an der Decke krampfhaft nach den Figuren und vor allem nach dem Segelschiff, das er sich ausgemalt hatte, bevor er einschlief. Er konnte nichts entdecken. Der Löwenkopf, die Katze, die Henne… Alle Figuren waren plötzlich weg.
„Neeiiinnnn! Bitte Gott, bitte, bitte, nimm ihn uns nicht weg!“ Die Stimme der Mutter war so laut und durchdringend, dass Emins Körper bebte. Ein schauerartiges Frösteln breitete sich helmförmig über seinen Kopf aus; seine kurzen Nackenhaare stellten sich auf. Er hatte das Gefühl zusammenzuschrumpfen. Er versuchte, seine Fingernägel in das harte Sitzkissen hineinzubohren, um dem Zusammenschrumpfen entgegenzuwirken. Ein Druck auf dem Brustkorb hinderte seine Beweglichkeit. Er konnte kaum atmen. Ihn überfiel ein Erstickungsanfall. Sein Herz flatterte wie ein Vogel, der aus seinem Käfig befreit werden wollte. Tränen liefen ihm die Wangen herunter. Er schüttelte seinen Kopf kräftig nach rechts und links, mit der Hoffnung sein Bewusstsein nicht zu verlieren. Er musste seine Kräfte zusammenraffen und aufstehen. Er hob seinen Kopf und legte ihn sofort wieder zurück, denn stechende Schmerzen breiteten sich vom Nacken in den Hinterkopf aus. Ihm wurde übel. Er spürte, wie die Magensäure langsam hochkam und in der Speiseröhre brannte. Er nahm die Lippen zwischen die Zähne und biss fest darauf. Zusätzlich legte er seine linke Hand auf den Mund und verstärkte den Druck mit der anderen. Er wollte vermeiden, dass diese ekelhaft schmeckende Säure aus seinem Munde herausspritzte.
Schwankend stand er auf und rannte zur Toilette. Er übergab sich. Die brennende Salzsäure spürte er nun noch deutlicher. Ekelhaft!
Er hielt seinen Kopf unter den Wasserhahn, aus dem ein dünnes Rinnsal von lauwarmem Wasser herauskam. Er füllte seinen Mund mit Wasser und gurgelte. Der saure Geschmack haftete an der Mundschleimhaut wie Kleister.
Er kam zurück, blieb an der Tür stehen und betrachtete seine Mutter und die ältere Schwester. Inzwischen gesellte sich auch die jüngere Schwester zu ihnen und weinte mit. Alle drei schlugen im selben Rhythmus ihre Hände aufs Gesicht, dann auf den Brustkorb und bewegten dabei ihre Köpfe samt Oberkörper nach vorne, als befanden sie sich im Bann eines Rituals.
Er betrachtete den zusammen gekrümmten Leichnam im Bett und konnte keine Ähnlichkeit mit seinem Vater, dem einst unschlagbaren Ringer, feststellen. Seine Blicke wanderten von dem Leichnam zu den drei Frauen, die unbeirrt im selben Rhythmus weinten. Dann fixierte er erneut den Leichnam.
Auf einmal wusste er, was er später als Erwachsener werden würde.
- KAPITEL 2 -
München, Mai 1992
Seit vier Tagen regnete es in München andauernd. Der für Mai gewöhnliche Niederschlag überstieg alle bisherigen Messungen sowohl von der Menge als auch von der Dauer her, so dass die trüben Wassermassen mancherorts auf den Straßen knöcheltiefe Pfützen bildeten.
Der Verkehr kam immer wieder zum Erliegen. Die S- und U-Bahnen fuhren nur noch mit Verspätungen. Die allradgetriebenen Geländewagen eroberten die Straßen. Ihre Besitzer kurvten stolz herum und ließen bei jeder Möglichkeit das Wasser in der Pfütze in hohen Bögen herumspritzen.
Am Dienstag hörte der Regen um fünf Uhr in der Früh schlagartig auf und die Wolken zogen innerhalb weniger Minuten weiter, als hätte jemand sie verschreckt. Der Himmel klärte auf und die ersten Sonnenstrahlen erreichten die Stadt mit hohen Temperaturen, so dass innerhalb von zwei Stunden sämtliche Straßen trocken waren. Eine diffuse Dunstwolke stieg von den Straßen empor.
Das Leben auf den Straßen kehrte langsam zum Alltagsrhythmus zurück.
Emin-Can Kayahan, eine Kommilitonin und zwei Kommilitonen standen in ihren schwarzen Anzügen mit Nadelstreifen vor der Tür der Prüfungskommission und warteten auf Einlass. Alle zitterten; nicht vor Kälte, sondern vor Aufregung.
Da sich die Wetterlage rapide änderte und die Sonne mit ihren wohligen Strahlen die depressive Verstimmung der Leute vertrieb, hofften sie natürlich auf die gute Laune der Prüfer. Ungemütliches Wetter bedeutete für sie ungemütliche Prüfer.
Zwölf Semester lang hatten sie fleißig gelernt, mehrere Praktika und Klausuren erfolgreich absolviert und standen sie nun vor der letzten Hürde. Das medizinische Staatsexamen. Wer es schaffte, erhielt die Lizenz, sich als Arzt zu bezeichnen.
Das Wissen des sechs Jahre dauernden Medizinstudiums ruhte in den Köpfen der vier Prüflinge wie in einem Käfig und wartete ungeduldig auf den Moment der Befreiung. Als jedoch der Name des Prüfers in der Inneren Medizin bekannt gegeben wurde, schauderten sie angsterfüllt am ganzen Körper. Eigentlich wäre ihnen jeder Prüfer recht gewesen. Jeder Prüfer? Nein! Bis auf einen: Professor Hans Georg Nelson. Professor Nelson galt bei allen Studenten als Scheusal, als einen Mann ohne Herzen, ein Vampir. Man erzählte, dass alleine bei Erwähnung seines Namens jeder Fluss sofort gefrieren würde.
Nelson stellte, und das gerade in der letzten Prüfung des Studiums, die kniffligsten Fragen und ließ die Prüflinge gerne zappeln. Es bereitete ihm jedes Mal eine Freude zu sehen, unter welcher Last der Prüfling seine Fragen zu beantworten versuchte. Er war päpstlicher als der Papst und akzeptierte absolut keinen Fehler. Für ihn gab es keine so genannten kleinen Fehler. Denn für ihn könnte jeder Fehler in der Medizin gravierende Folgen für den Patienten haben.
Mit 36 Jahren war Tino Werner der Älteste der vier Prüfungskandidaten. Der hervortretende Unterkiefer und die einem Papageienschnabel ähnelnde Nase waren seine markantesten Zeichen. Als er den Namen Nelson hörte, stand er kurz vor einem Kollaps. Er rannte schnell auf die Toilette und übergab sich zweimal. Als er aus der Toilette herauskam, schien er, innerhalb von einigen Minuten um Jahre gealtert zu sein. Die Schweißtropfen auf seiner Stirn sahen wie kleine Perlen aus. Er wischte sie vergeblich mit dem Taschentuch. Sobald er das mit seinen Initialen T. W. bestickte Tuch in seiner Hosentasche verschwinden ließ, schossen neue Schweißtropfen wie Pilze aus dem Boden.
„Ich glaub´, ich muss wieder aufs Klo“, sagte er zu seinen Kollegen, die nachdenklich auf einer Bank saßen und mit nach vorne gebeugten Köpfen den Linoleumboden betrachteten.
„Mensch, hör doch auf mit deinem Schmarr´n“ schimpfte Tanja Hofmeister, die einzige Studentin in der Gruppe, mit ihrem bayerischen Dialekt. „Du machst uns alle nur noch nervöser!“
Tanja war 29 Jahre alt und kam ursprünglich aus dem Allgäu. Sie lebte mit ihrer Familie seit über 10 Jahren in München Schwabing in einem Einfamilienhaus. Eine Schönheit war sie zwar nicht, aber ihre blauen Augen und ihre glatten blonden Haare, die ihr bis zur Hüfte reichten, machten sie attraktiv.
„Ich kann doch nichts dafür“, antwortete Tino leise. Er schob dabei sein Unterkiefer vor und zurück und erzeugte dabei ein unangenehmes Knacksen in den Kiefergelenken.
„Dann geh halt aufs Klo und lass uns in Ruh´“, erwiderte Stefan Mehring, der jüngste und mit 165 cm auch der Kleinste der Gruppe. Da er im Gymnasium zwei Klassen übersprungen hatte, galt er als Genie und trat bereits mit 23 Jahren die ärztliche Prüfung an. Stefan kannte den Ausdruck Prüfungsangst nicht. Für ihn gehörte die Prüfung, egal welcher Art, einfach zur Lebensaufgabe. Er verfügte über ein Gehirn, das einer unerschöpflichen Videokamera ähnelte. Texte, Bilder, Fakten blieben bei ihm mühelos haften und warteten auf ihren Gebrauch.
Obwohl Emin sich in dieses Gespräch nicht einmischen wollte, brachte er ungewollt ein „und bleib bitte auch dort!“ heraus.
Er bereute es allerdings sofort, da er seinen Kommilitonen, gerade an diesem für alle sehr schwierigen und entscheidenden Tag, auf keinen Fall kränken wollte.
Emin bekam sofort die Zustimmung von Tanja, die es mündlich und mit einem deutlichen Kopfnicken bestätigte.
Tino ärgerte sich über die beiden. „Ihr macht euch nur lustig über mich, weil ich von euch allen der Älteste bin“ sagte er wütend und lief Richtung Toilette, ohne auf Antwort zu warten.
Just in dem Moment, in dem Tino aus der Toilette kam, ging die frisch gestrichene Tür des Prüfungsraumes auf und Professor Sebastian Köhler, der Chirurg, trat heraus. Seine Glatze ging stufenlos in sein gründlich rasiertes Gesicht über. Er lächelte und ging auf die künftigen Ärzte zu. Tanja, Stefan und Emin standen sofort auf. „Wo ist denn der vierte Kollege?“ fragte er höflich.
Alle drei drehten, wie einem Kommando folgend, ihre Köpfe in Richtung der Toilette. Tino kam angelaufen. Seine Stirn war erneut von mehreren Schweißtropfen bedeckt. „Ich bitte um Entschuldigung, Herr Professor“, sagte er mit einer röchelnden Stimme und atmete voller Panik wie ein Asthmatiker, der gerade mit einem Asthmaanfall zu kämpfte.
Köhler gab seine Hand zuerst Tanja und begrüßte sie freundlich. „Grüß Gott, mein Name ist Sebastian Köhler und Sie sind, wenn ich mich nicht täusche die Kollegin Frau Tanja Hofmeister."
Tanja nahm seine warme Hand, die auf sie beruhigend wirkte.
Nach der Begrüßung der restlichen Kandidaten, kontrollierte Köhler ihre Personalausweise und bat sie, ihm zu folgen. Der Prüfungsraum war geräumig. Die Sonnenstrahlen reflektierten auf mächtige Ölgemälde mit goldenen Rahmen und ließen die netzartigen Krakelees auf der Oberfläche deutlicher erscheinen. An der Fensterseite stand ein langer Tisch, auf dem, wie in einem Gericht, haufenweise Akten stapelten. Es handelte sich hierbei jedoch nicht um Strafdossiers, sondern um medizinische Unterlagen, wie Patientenberichte, EKGs, Röntgen- und Ultraschallbilder.
Als die Prüflinge die an der rechten Ecke des Tisches regungslos sitzende Gestalt erkannten, stieg ihnen eine Übelkeit auf, als hätten sie am Abend zuvor ein verdorbenes Fischgericht gegessen, das schon längst entsorgt gehörte. Sie folgten der Aufforderung Köhlers und nahmen Platz. Köhler räusperte sich zweimal und begann mit seinem unverändert freundlichen Ton zu sprechen: „Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrte Herren Kollegen, ich darf Ihnen zuerst meine beiden Kollegen vorstellen, die Sie sicherlich aus den Vorlesungen kennen. Wir werden versuchen, mit Ihnen ein möglichst lockeres und kollegiales Gespräch zu führen."
Obwohl Köhlers Stimme ziemlich beruhigend klang, spürte Tino erneut einen Druck in der Blasengegend und begann, im Sitzen abwechselnd einmal mit dem rechten und dann mit dem linken Bein zu wackeln.
„Zu meiner rechten“, fuhr Professor Köhler fort, „sitzt Herr Professor Nelson von der internistischen Klinik. Zu meiner linken sitzt Herr Professor Höfele von der Kinderklinik. Der Gesetzgeber schreibt mir vor, Sie zu fragen, ob Sie sich geistig und körperlich imstande fühlen, an diesem kollegialen Gespräch teilzunehmen.“ Das Nicken der Prüflinge mit dem Kopf reichte Professor Köhler nicht. Daher fragte er jeden Kandidaten einzeln der Reihe.
„Herr Kollege Kayachan“, begann Professor Nelson und drehte einen Bleistift geschickt zwischen den Fingern. Er fixierte Emin mit seinen durchdringenden Blicken, der plötzlich schauderte, als hätte ihn eine Kältewelle überrascht. „Spreche ich Ihren Namen richtig aus?“, fragte er mit einem nichts sagenden Ton.
„Ähm, eigentlich heiße ich Kaya-Han“ antwortete Emin und versuchte dabei die Betonung auf das H zu legen. Seine Stimme klang ängstlich und unsicher. Das brutale Vorgehen Professor Nelsons vor allem in den ärztlichen Prüfungen gehörte bereits in den ersten Semestern zu den wichtigsten Gerüchten der medizinischen Fakultät. Er spürte, wie ein Kloß ihm den Hals zuschnürte.
„Das sage ich doch: Kayachan!“ erwiderte Nelson im selben gleichgültigen Ton. Seine Gesichtsmimik verriet nichts. Dafür fixierten seine aschfahlen Augen den vor ihm sitzenden Studenten, wie bei einem Hypnotiseur, der sein Gegenüber nur innerhalb von einigen wenigen Sekunden zum Schlafen bringen wollte.
„Kaya-Han und nicht Kaya-Chan! H wie Hamburg oder Heinrich“ entgegnete Emin und hüstelte, um seine belegte Kehle frei zu machen. Er deutete mit seinen Lippen ein leichtes Lächeln an und schaute dabei Nelson in die Augen. „Gott, lass bitte, bitte diese Wachsfigur schmelzen“, betete er innerlich. Seine Angst wurde größer, als ihm der Gedanke kam, dass Professor Nelson eventuell sogar Gedanken lesen könnte.
„Also, Kaya-Chan… wie Hamburch", wiederholte Nelson und wirkte genervt.
In Emins Kopf läuteten die Glocken. Nelson machte sich sicherlich über ihn lustig, damit er später seine Krallen umso tiefer in sein Fleisch hineinbohren konnte. Was konnte er von einem dermaßen gefürchteten Prüfer erwarten, als im Nu in Rage zu geraten und einen Wutanfall zu bekommen? Er merkte, wie sein Bein zu zittern begann. Nun begriff er, welche Todesängste Tino vor den Prüfungen auszustehen hatte.
Eine Minute… zwei Minuten… drei… die Zeit verging. Wo blieb der Wutanfall? War es überhaupt möglich, dass Nelson einfach dasaß und Emin in die Augen schaute?
Nanu? Bildete Emin sich nun ein, dass er auf dem Gesicht des Professors den Anflug eines Lächelns entdeckte?
„Kaya-Ch-Ch-Chan“, flüsterte der Prüfer wieder und wieder, als führte er Selbstgespräche. Nun wusste Emin es. Tatsächlich, er lächelte. Professor Nelson lächelte. Welch Wunder?
„Sie sehen, Herr Kollege Nelson, Türkisch ist doch nicht so leicht wie die Innere Medizin“, griff plötzlich Professor Köhler ein und lachte heiter. Daraufhin lachte auch der Kinderarzt Professor Höfele und nickte heftig mit dem Kopf, als sprach er aus Erfahrung. Nelson drehte langsam seinen Kopf zu Höfele. „Und, was meinen Sie Herr Höfele, was leichter ist, Türkisch oder die Kinderheilkunde?“
„Türkisch natürlich“, antwortete Höfele ohne zu zögern, als hätte er bereits mit dieser Frage gerechnet.
„Dann sagen Sie uns bitte, wie der junge Kollege heißt“, forderte ihn Nelson und bedeckte mit der rechten Hand die Augen, als würde Höfeles Antwort ihn jede Sekunde blenden könnte.
Emin musste seinen Namen einige Male wiederholen. Er kam sich wie eine Schallplatte vor, die hing und nur noch den Refrain spielte. Es schien für die Herren Professoren tatsächlich schwierig zu sein, Emins Familiennamen richtig auszusprechen.
Professor Köhler schob den Ärmelbund um einige Zentimeter nach oben, und blickte demonstrativ auf seine wasserdichte Uhr. „Meine Herren, aufgrund der bereits fortgeschrittenen Stunde, darf ich Sie bitten, Ihre Diskussion über Hamburg oder Hamburch auf das Ende dieses Kollegiums aufzuheben“, intervenierte er dann, immer noch auf die Uhr schauend, und unterbrach somit die Diskussion zwischen den Nelson und Höfele. Er hielt kurz inne und fuhr dann fort. „Allerdings möchte ich Sie gerne darauf aufmerksam machen, dass die jungen Kollegen nun deutlich im Nachteil sind. Sie sitzen seit über einer halben Stunde angespannt hier und warten auf das Ende Ihres linguistischen Wettbewerbs. Und dass jeder Stress bzw. jede Anspannung die Konzentrationsfähigkeit unserer jungen Kollegen negativ beeinflusst, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Daher bitte ich Sie, dieses Gespräch dementsprechend zu gestalten.“
Diese Intervention nahm anscheinend Nelson die Luft aus den Segeln und rettete die Prüflinge vor einem möglichen Desaster. Die als kollegiales Gespräch bezeichnete Prüfung verlief in einer völlig entspannten Atmosphäre, so dass sogar der Angsthase Tino die Fragen bedacht und mit Überzeugung beantwortete. Er vergaß den Druck in der Blasengegend.
Nach eineinhalb Stunden war die Prüfung gelaufen. Alle vier Prüflinge schlugen sich tapfer und gaben ihr Bestes. Um sich über das Ergebnis zu beraten, entließen die Professoren die Prüflinge. Tino rannte sofort auf die Toilette, da ihm auf einmal einfiel, dass er bereits vor eineinhalb Stunden einen Druck in der Blasengegend gespürt hatte. Tanja und Emin setzten sich wieder auf die Bank, die ihnen nun zu klein zu sein schien. Stefan ging zum Fenster, machte es auf und genoss die Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht.
Nach etwa fünf Minuten ging die Tür des Prüfungsraumes auf und Professor Köhler erschien in der Türschwelle. Ihm fiel wieder auf, dass der vierte Kandidat fehlte. „Sagen Sie bloß nicht, dass der vierte Kollege wieder auf der Toilette ist“, sagte er schmunzelnd.
Alle Gesichter blickten in Richtung der Toiletten. Emin stand auf und machte zwei Schritte, um nach Tino zu sehen. Die Toilettentür ging dann doch noch auf und Tino kam heraus. Als er sah, dass Köhler und seine Mitstreiter auf ihn warteten, rannte er los. Er blieb kurz vor dem Professor stehen und entschuldigte sich mehrmals bei ihm.
„Wie wäre es, Herr Kollege, wenn Sie zuerst den Reißverschluss Ihrer Hose schließen würden“, sagte Köhler mit gespielter Empörung. „Erstens sind wir nicht im Kurs der praktischen Urologie und zweitens, es passt nicht zum ärztlichen Outfit."
Tino errötete und entschuldigte sich, diesmal viel hektischer, und zog mit zitternder Hand fest an seinem Reißverschluss. Sie gingen hinein und nahmen erneut auf denselben Stühlen Platz. Die Akten auf dem Tisch waren verschwunden und lagen nun neben auf der Fensterbank.
„So, Frau Kollegin Hofmeister“, sprach Köhler zu Tanja gewandt. „Wir waren bis auf einige Sachen, die wir teilweise als Versprecher eingestuft haben, mit Ihren Leistungen vollkommen zufrieden und gratulieren Ihnen mit einer Note 1,4 zu Ihrer bestandenen Prüfung und freuen uns, Sie als frisch gebackene Ärztin begrüßen zu dürfen.“
Tanja errötete kurz und legte voller Freude beide Hände aufs Gesicht. Sie spürte, dass ihre Wangen wesentlich wärmer waren, als die Hände. Professor Köhler wandte sich zu Stefan und wiederholte die gleichen Sätze wie bei Tanja, allerdings mit Enthusiasmus, und verkündete ihm die Note eins. Auch bei Emin und Tino fielen dieselben Sätze, wie von einem Tonbandgerät. Beide bekamen jedoch die Note zwei Komma null, was gerade für Tino eine enorme Leistung bedeutete. Die drei Professoren standen anschließend auf und gratulierten den frisch gebackenen Ärzten mit einem freundlichen Händedruck.
Sobald die vier jungen Ärzte alleine im Flur waren, umarmten sie sich voller Freude und gratulierten einander. Sie verließen das Gebäude nebeneinander in einer Kette mit dem Arm um die Schulter des anderen.
- KAPITEL 3 -
Ingolstadt, Mai 1992
Gleich nach dem Examen begann Emin mit seiner Facharztausbildung im Klinikum Ingolstadt. Obwohl er sich bereits als Student in den Kopf gesetzt hatte, Chirurg zu werden, nahm er eine frei gewordene Stelle in der Inneren Medizin an, zu der er mehr oder weniger Frau Privatdozentin Dr. Barbara Himmel überredet wurde.
PD Dr. Himmel arbeitete als leitende Oberärztin im Klinikum München Nord und betreute zusätzlich die internistische Station 3 B im ersten Stock. Als Emin dort den zweiten Abschnitt seines Praktischen Jahres absolvierte, lernte er die Vierzigjährige kennen und zwischen den beiden begann eine vertrauensvolle Freundschaft. Er arbeitete drei Monate lang als Student im Praktischen Jahr auf Himmels Station und gewann durch seine Art bald die Herzen des Personals. Er erinnerte sich noch sehr gut an das Telefonat mit Dr. Himmel, mit dem sie ihn überreden konnte, doch noch mit der Inneren Medizin in Ingolstadt anzufangen. Er wollte an dem Abend eher ins Bett gehen. Das Telefon läutete ausgerechnet in dem Moment, als er im Bad seine Zähne putzte. Er spülte schnell die Zahnpasta aus dem Mund und rannte zum Telefon. Die Stimme kannte er viel zu gut. „Hallo Barbara, schön Deine Stimme zu hören. Wie geht es dir?“ Er bekam auf seine Frage keine Antwort. Dafür fragte sie ihn, ob sie ihn störte. Er erzählte ihr, dass er gerade ins Bett gehen wollte.
„So früh? Anscheinend hattest du einen anstrengenden Tag“, bemerkte sie halb ernst halb im Spaß.
„Stimmt. Ich musste mein Zeugnis auspacken, es in eine Folie legen und dann in einem Ordner verstauen.“
„Oje, du Ärmster. Das klingt nach Knochenarbeit“, sagte sie mitleidsvoll und wechselte gleich das Thema. „Hast du schon eine Assistentenstelle?“
„Offen gestanden, ich wollte mir etwas Freizeit gönnen.“
Daraufhin erzählte sie ihm mit gekonnter Eloquenz von den Vorteilen der Inneren Medizin und überzeugte ihn innerhalb von nur zwei Minuten, die Stelle bei ihrem Mann anzutreten. Jedes Mal, wenn er daran dachte, musste er grinsen.
Emins 3-Zimmer-Wohnung im Dachgeschoss lag in der Fußgängerzone, direkt im Zentrum von Ingolstadt. Er hatte eine geräumige Terrasse zur Südseite, deren Brüstung er mit verschiedenen Geranien bepflanzt hatte. An den dienstfreien Tagen setzte er sich hin, frühstückte gemütlich oder trank einfach eine Tasse Kaffee und betrachtete die Leute. In den Sommermonaten verwandelte sich die Fußgängerzone bereits in den ersten sonnigen Morgenstunden in eine Urlaubsinsel irgendwo in der Karibik oder in eine Piazza in Italien. Eisdielen, Cafés, kleine Tischen und Stühle im Freien, große Blumentöpfe am Ladeneingang, herum lärmende Kinder. Das Paradies auf Erden.
Wenn er abends aus der Klinik kam und es noch hell war, setzte er sich gerne in die kleine Eisdiele Maurizio, trank dort einen Espresso doppio und aß anschließend einen großen Becher gemischtes Eis mit viel Krokant, den der Besitzer, er hieß tatsächlich Maurizio, extra für ihn zubereitete.
Maurizio war ein kleiner Italiener aus Sizilien und machte das beste Eis in Ingolstadt. Er erzählte allen, dass er sein Eis nach einem speziellen Rezept des Großvaters zubereitete. Seine Familie sei seit Generationen Eishersteller. Oft stand er minutenlang in der Sonne und betrachtete aus der Entfernung die Gesichter seiner Kunden. Er wollte, dass jeder seinen Laden mit einem zufriedenen Gesicht verließ.
„Ich habe heute etwas Besonderes für Sie, Dottore“, sagte Maurizio mit seinem italienischen Akzent. Emin mochte diesen Akzent und hörte Maurizio gerne zu.
Maurizios Gesicht strahlte voller Stolz und Freude. Auf seinen dicken Wangen bildeten sich zwei tiefe Grübchen. Er brachte einen kleinen Teller mit drei dünnen Streifen, die unten gelb und oben rot waren.
„Was ist das?“ fragte er neugierig den Italiener, der grinsend danebenstand und auf Emins Frage wartete.
„Das ist etwas Neues“, verriet Maurizio. „Ich habe es selbst gemacht und Sie, Dottore, sind meine Testperson.“
Emin hätte schwören können, dass er, wie immer, hinzufügte, er habe es nach einem Geheimrezept seines Großvaters zubereitet. Er wartete etwa eine Minute vergeblich. Maurizio sprach nicht weiter. Das Telefon der Eisdiele läutete und Maurizio ging hinein. Nach zwei Minuten kam er zurück und setzte sich zu Emin. „Und, Dottore?“, fragte er erwartungsvoll.
„Sehr gut, köstlich“, antwortete Emin. Er spitzte dabei seine Lippen und küsste den an den Kuppen zusammengefügten Daumen und Zeigefinger.
„Habe ich den Test bestanden?“, fragte Maurizio erneut.
„Sogar mit der besten Note.“ Emin schmatzte diesmal mit den Lippen. „Wollen Sie mir nicht verraten, was das ist?“
„Das ist Zuppa romana und ist eine Spezialität von …“
„Ihrem Großvater“, unterbrach Emin mit einem zufriedenen Lächeln.
„Stimmt, Dottore! Woher wussten Sie es? Mein Großvater war im Dorf in Sicilia, wissen Sie? Er war der erste, der Zuppa romana gemacht hat.“
„Ihr Großvater war sicherlich ein Genie“, schmunzelte Emin und war schließlich doch froh, dass Maurizio ihm die Entstehungsgeschichte der Zuppa romana in allen Details zu erzählen begann.
- KAPITEL 4 -
München, Juni 2002
Emin war 31 Jahre alt, 175 cm groß und wog 69 kg. Obwohl er, bis auf die seltenen Schwimmbadbesuche in den Sommermonaten, so gut wie nie Sport trieb, sah er ziemlich athletisch aus. Die grünen, freundlich strahlenden Augen erbte er eindeutig von seiner Mutter. Die breiten vollen Lippen waren stets gut durchblutet und verliehen ihm eine gewisse Erotik. Bereits in der ersten Stunde des Anatomiekurses, in dem er mit Tanja zusammen an derselben Leiche präparierte, sagte sie ihm, dass sie ihn um seine erotischen Lippen beneidete.
Emins Praxis lag in der Nähe von München Ostbahnhof, an der Kreuzung Pariserstraße und Wörthstraße im zweiten Stock eines Hauses aus dem Jahre 1965. Damals muss es sicherlich ein recht modernes Haus gewesen sein. Denn sämtliche Sanitär- und Elektroanlagen funktionierten immer noch einwandfrei. Bei der Sanierung vor einem Jahr bekamen die Wände neuen Verputz und Anstrich. Die zitronengelbe Farbe verlieh dem Haus ein freundliches und frühlingshaftes Flair. Die kleinen Balkone, auf die nicht einmal zwei Menschen passten, ließ der Hauseigentümer, ein kleiner Bayer, orange anstreichen. Er liebte Italien und dort vor allem die Cinque Terre. Deswegen bemühte er sich stets, in seinem sämtlichen Gehabe italienisch zu wirken. Er besuchte nicht nur eine Sprachschule, um Italienisch zu lernen, sondern auch einen italienischen Kochkurs.
Emin gefiel das Haus. Das Einzige, was ihn störte, waren die Fenster. Obwohl sie aus Doppelscheiben bestanden, isolierten sie bestimmte Laute nicht, wie das Vorbeifahren der Trambahnen, Hupen der Autos oder das Knattern eines vorbeirasenden Mopeds. Da es sich sowohl bei der Pariser- als auch bei der Wörthstraße um belebte Straßen handelte, kam es immer wieder zu Unterbrechungen bei der Untersuchung, vor allem wenn er mit seinem Stethoskop das Herz abhörte und sich auf die anormalen Herzgeräusche konzentrieren musste. An sich verfügte er über ein gutes Gehör und ließ sich bei der Herzauskultation Zeit. Trotzdem brachte ihn der Straßenlärm immer wieder aus dem Konzept, so dass er an einen Umzug in eine ruhigere Gegend wünschte.
„Herr Cevat Korkmaz ist im Zimmer 2, Herr Doktor“ kündigte Selma, die Arzthelferin mit den langen schwarzen Haaren voller Locken.
Cevat Korkmaz war ein relativ kleiner Mann um 45 und hatte einen dünnen Schnurrbart, den er offensichtlich regelmäßig färbte. Denn die Kopfhaare, Augenbrauen, die aus dem Kragenbereich herausquellende Brusthaare, ja sogar seine Wimpern; alle Haare an ihm waren grau.
Emin kam aus dem Zimmer 1 und drückte dem Patienten freundlich die Hand. „Was kann ich für dich tun, Bruder Cevat?“
Ob alt oder jung, ob Mann oder Frau, duzte er grundsätzlich jeden Patienten. Auch sie duzten ihn. Außerdem sprach er die jungen Patienten mit Bruder oder Schwester, und die älteren mit Onkel bzw. Tante an, als wären sie Mitglieder seiner eigenen Familie. Er war für die meisten Patienten der Bruder Emin. Ältere Patienten nannten ihn, je nach ihrem Alter oder wie sie sich ihm gegenüber fühlten mein Sohn oder mein Neffe.
„Seit etwa zwei Tagen habe ich ein komisches Gefühl in meinem Körper, Bruder Emin“, berichtete der Patient mit einer ungewöhnlich tiefen Stimme.
„Was für ein Gefühl ist es denn? Kannst Du es mir etwas näher beschreiben?“, fragte Emin und betrachtete das Gesicht des Patienten, der absolut nicht krank wirkte.
„Ja, klar. Jedes Mal, wenn ich mein Hemd an- oder ausziehe, stehen mir die Haare zu Berge.“
„Passiert es nur bei dem Hemd? Oder auch bei den andren Sachen, wie z. B. Unterwäsche oder Hose?“
„Nein nur bei dem Hemd.“
Für Emin war es klar. Er unterdrückte ein Lachen. „Kann es sein, dass du dieses Hemd erst vor zwei Tagen gekauft hast?“
„Ja, das stimmt. Woher wusstest du das? Das ist ja Zauberei!“, antwortete der Patient überrascht.
„Dieses Hemd besteht zum größten Teil, wenn nicht sogar aus 100% Polyester, mein Bruder. Beim An- und Ausziehen kommt es durch das Reiben zu einer elektrischen Ladung. Und das ist die Ursache für deine neue Beobachtung“, sagte Emin mit ernsthafter Miene. „Daher würde ich dir raten, ab sofort nur noch Sachen zu kaufen, die aus reiner Baumwolle sind.“
Der nächste Patient war Anfang 40, mittelgroß und recht schlank. Seine natürliche braune Hautfarbe erweckte den Eindruck, als hätte er vor kurzem in einem sonnigen Land einen ausgiebigen Strandurlaub gehabt. Sein Gesicht mit den eingesunkenen schwarzen Augen wirkte müde. Die oberen Augenlider bedeckten die halbe Iris, als wäre er kurz vor dem Einschlafen.
„Sei gegrüßt, Bruder“, sagte Emin, wie immer, in freundlichem Ton. Während er dem Patienten die Hand drückte, betrachtete er sein Gesicht genauer. Auch der lasche Händedruck bekräftigte seinen Verdacht, dass dieser neue Patient namens Kemal Aldan an Schwäche litt. Kemal versuchte zwar mit einem Lächeln etwas freundlicher zu wirken. Das gelang ihm aber nicht.
„Wenn die Mädchen mir nicht die falsche Karteikarte gebracht haben, bist du Kemal Aldan und kommst zum ersten Mal zu mir“, fuhr Emin fort und blickte auf die weiße Karteikarte ohne Eintragungen.
„Ja, das stimmt, Herr Doktor, ich bin zum ersten Mal bei dir“, entgegnete der Patient.
„Bitte, nimm Platz und erzähl mir, was dich zu mir führt“, forderte Emin und setzte sich auf seinen schwarzen Ledersessel, der jedes Mal, wenn er sich hinsetzte oder aufstand, etwas quietschte.
„Seit mehreren Monaten fühle ich mich zunehmend schwach und mir ist stets schwindelig“, berichtete der Patient.
„Trat diese Schwäche schlagartig oder langsam auf?“
„Langsam.“
Emin stellte dem Patienten noch eine Reihe von Fragen und erfuhr, dass er ein Medikament namens Bisoprolol 10 mg gegen seinen hohen Blutdruck einnahm. Er erschrak, als er erfuhr, dass der Arzt, der von dem Patienten als Herzspezialist bezeichnet wurde, ihm von diesen Tabletten drei Stück verordnet hatte. Der Patient griff mit seiner rechten Hand in die Innentasche seiner Jacke und zog mehrere Zettel und Visitenkarten heraus, die er mit einem Gummiband zusammengebunden hatte. Er entfernte das Gummiband und durchsuchte alle Zettel einzeln, bis er die Visitenkarte des Arztes fand. Emin betrachtete die Karte genauer und las den Text.
Dr. med. Martin Wassermann
Arzt für Innere Medizin
Kardiologische Diagnostik
Lehelstraße 25
80336 München
Telefon: 089 / 8033680336
Er erhob sich ruckartig, ging zum Patienten und maß bei ihm den Blutdruck zuerst am rechten und dann am linken Arm. An beiden Armen betrug er 90/70 mmHg. Dann legte er den Kopf seines Stethoskops auf die Brust des Patienten und auskultierte das Herz, wobei er gleichzeitig mit dem Zeige-, Mittel und Ringfinger den Puls am Handgelenk von Kemal tastete. Die Herzfrequenz stimmte mit dem Puls überein. Keine Extraschläge. Die Herzfrequenz lag jedoch mit 38 Schlägen pro Minute in einem ziemlich niedrigen Bereich.
Emin nahm auf seinem Sessel wieder Platz. Er rieb einige Male die Schläfen und sprach langsam zum Patienten. „Dein Blutdruck ist mit 90 zu 70 ziemlich niedrig. Im türkischen Sprachgebrauch sagt man 9 zu 7. Deine Herzfrequenz, das ist die Zahl der Schläge deines Herzens in einer Minute, beträgt 38. Das ist sehr, sehr wenig. Deswegen hast du deine Schwäche und deine Schwindelanfälle.“
Nach dieser Erklärung hielt er es nicht aus und rief Dr. Wassermann an. Nach mehrmaligem Klingeln meldete sich eine freundliche Frauenstimme. Er nannte ihr seinen Namen und bat sie, ihn mit Herrn Dr. Wassermann wegen des Patienten Herrn Kemal Aldan zu verbinden.
Dr. Wassermann klang bereits, als er seinen Namen nannte, unfreundlich und arrogant. Emin schilderte ihm den Zustand des Patienten und nannte ihm den Blutdruck sowie die Herzfrequenz. Wassermann rechtfertigte sich damit, dass er dem Patienten gegen den Schwindel immerhin ein starkes Medikament verordnet hatte. Als Emin versuchte ihm zu erklären, dass die Beschwerden des Patienten durch zu hohe Dosierung des blutdrucksenkenden Mittels komme, wurde sein Gesprächspartner ungehalten und forderte Emin auf, sich mit den Therapierichtlinien der Deutschen Blutdruckliga gründlicher zu befassen und sich in Gebiete nicht einzumischen, von denen er keine Ahnung hätte. Emin blieb nichts Anderes übrig, als in den Hörer ein lautes Arschloch zu schreien. Wassermann kriegte diesen Wutanfall allerdings nicht mit, da die Leitung bereits tot war.
Nachdem Kemal Aldan das Zimmer verlassen hatte, legte er eine kleine Pause ein. Er ging in sein Privatzimmer, das persönliche, patientenfreie Refugium und schaltete dort die Kaffeemaschine ein.
Er war stolz auf seine Kaffeemaschine und lobte sie in seinem Freundeskreis bei jeder Gelegenheit. Der Preis für das Gerät war zwar unmäßig hoch, dafür schmeckte der Kaffee aber stets gut. Er lauschte dem Mahlwerk der Maschine, als handelte es sich dabei um ein Musikinstrument, und atmete den frischen Kaffeeduft mit tiefen Atemzügen ein. Er setzte sich mit der Tasse in der Hand auf die Couch und schlürfte seinen Kaffee mit Genuss.
Der letzte Patient, namens Tayfun Tatlidil, war ein dynamischer Mann Anfang dreißig und hatte eine gesunde Hautfarbe. Er stand mit leicht gespreizten Beinen in der Mitte des Zimmers, als würde er versuchen, sein Gewicht zwischen beiden Beinen zu balancieren. Er betrachtete das Aquarell an der Wand, das eine Seelandschaft im Sturm darstellte. Die dunkelblauen Farben beherrschten das Bild.
„Hallo, Bruder Tayfun“, grüßte Emin den Patienten, wobei er zuvor schnell einen Blick auf das Namensetikett auf der Karteikarte warf.
Es kam bei den Patienten immer gut an, wenn er die Patienten bereits bei der ersten Konsultation gleich mit Namen ansprach, auch wenn es unmöglich war, sich alle Namen zu merken. Daher legten die Arzthelferinnen die Karteikarten geschickt an den Rand des Tisches, so dass er bereits beim Betreten des Sprechzimmers sofort den Namen des Patienten lesen konnte.
Emin betrat anscheinend das Untersuchungszimmer so leise, dass sich Tayfun Tatlidil erschrocken umdrehte und wie ein Panther Haltung annahm, der sprungbereit auf seine Beute wartete. Emin ging schnell durch den Kopf, dass er nun mit einem Taekwondo- oder Karatekämpfer zu tun hatte.
„Mensch Doktor, du hast mich aber erschreckt“, monierte Tayfun mit einer bebenden Stimme, als würde er gleich anfangen zu heulen. „Ich war so mit dem Bild beschäftigt, dass ich dich überhaupt nicht gehört habe.“
„Es tut mir leid. Bitte entschuldige, ich wollte dich auf keinen Fall erschrecken.“
„Schon gut, ich werde es überleben."
„Das möchte ich aber schwer hoffen. Ich möchte nicht, dass die folgende Überschrift die Zeitungen von morgen schmücken: Arzt erschreckte seinen Patienten zu Tode“, scherzte Emin gut gelaunt.
„Das würde ich dir auch nicht raten, lieber Herr Doktor. Ich kann nicht nur gut Karate, sondern kenne auch viele hervorragende Anwälte", erwiderte Tayfun, als würde er seinen Text aus einem Drehbuch vortragen.
Bei der Anamnese berichtete Tayfun von Schmerzen am rechten Oberbauch. Nach weiteren Fragen stand für Emin die Diagnose fest. Gallensteine.
Da Tayfun kurz davor ein Dönerkebab gegessen hatte, gab ihm Emin einen Termin für den nächsten Tag um 7.40 Uhr zur Ultraschalluntersuchung.
Nachdem der letzte Patient die Praxis verlassen hatte, schickte er die Sprechstundenhelferinnen nach Hause und ging mit einer Tasse Kaffee in der Hand die Karteikarten und die Tagespost durch.
Als er vor der Außentür der Praxis stand und nach dem richtigen Schlüssel suchte, war es bereits 23.10 Uhr.
Draußen fuhr eine Trambahn quietschend vorbei. Ein paar Jugendliche, die wohl einen über den Durst getrunken hatten, sangen laut „Oleee, Ole, Ole, Ooooleeee."
- KAPITEL 5 -
München, Juni 2002
Bereits kurz nach sechs Uhr wurde es hell und ein wolkenloser Himmel spannte sich über München. Der kühle Wind ließ die Blätter an den Bäumen rascheln. Es hörte sich wie die Hintergrundmusik die Liebesszene einer Oper an.
Zwei junge Frauen mit einem Kurzhaarschnitt standen an der Straßenbahnhaltestelle und fröstelten unentwegt. Sie hatten sich anscheinend von den Sonnenstrahlen mächtig irritieren lassen und zogen ihre Sommersachen an; dünne Blazer, kurzärmlige Blusen, sowie Röcke, die mehr als die Hälfte ihrer Oberschenkel freigaben. Auch wenn sie cool zu wirken versuchten, strahlten ihre Gesichter große Freude, als sie die Straßenbahn erblickten.
Emin schüttelte den Kopf verständnislos und fragte sich, ob die beiden beim Verlassen der Wohnung die Kälte nicht gespürt hatten. Er fröstelte ungewollt und umschlang daher seine Jacke enger um den Körper.
Im Treppenhaus vor der Praxis traf er mehrere Patienten, die auf den Betonstufen saßen und warteten. Manche benutzten Zeitungen als Sitzunterlage. Die Luft roch stark nach abgestandenem Rauch wie in einer billigen Kneipe. Eine dicke Frau mit grauen und fettig glänzenden Haaren saß auf zwei Schaumstoffkissen. Durch die starke Brille sahen ihre Augen winzig aus. Sie röchelte bei jedem Ein- und Ausatmen und hatte eine auffällige rot-blaue Gesichtsfarbe. Neben ihr stand ein Aschenbecher mit mindestens zehn Zigarettenstummeln. Sobald sie Emin wahrnahm, versteckte sie den Aschenbecher hinter ihrem Rücken.
„Guten Morgen!“, sagte er mit einer fröhlichen Stimme. „Geht die Klingel nicht?“
„Sie ist ausgeschaltet. Deine Damen sind aber schon drin. Wir haben mehrmals geklopft und keiner macht die Tür auf“, beschwerte sich die dicke Frau und fuhr nach einer kurzen Atempause fort. „Wir sitzen seit mehreren Stunden hier und frieren uns einen ab!“
„Aber nur die äußeren Schichten. Denn, wie ich sehe und vor allem rieche, hast du dafür deine Lunge bereits überhitzt“, antwortete Emin.
Manche Patienten kicherten und ernteten von ihr nicht nur vernichtende Blicke, sondern auch ausgefallene Bemerkungen. Emin sperrte die Tür auf und bat die Patienten einzutreten. Seine Helferinnen saßen hinter der Rezeption und musterten die Patienten, die eilig hineinströmten. Obwohl Emin immer zuerst diejenigen untersuchte, die einen Termin hatten, wollte jeder als Erster an der Anmeldung sein.





























