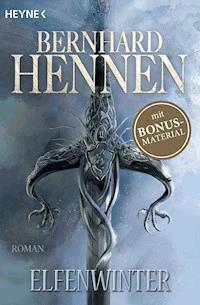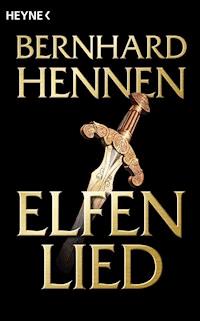13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Schattenelfen-Saga
- Sprache: Deutsch
Die Fürstin von Langollion herrscht über ein märchenhaft wohlhabendes und schönes Reich, das all seinen Einwohnern das persönliche Glück ermöglicht. Doch Alathaias Neider sind zahlreich - und als die Königin der Elfen selbst ihr Assassinen schickt, muss die Fürstin, um Langollion zu retten, an einen Ort reisen, von dem noch niemand lebend zurückkehrte. Verfolgt von den Häschern der Königin und beobachtet von einer dunklen Macht, bricht sie auf. Doch sie weiß, dass mindestens einer ihrer Gefährten nur darauf wartet, sie zu ermorden.
Bestsellerautor Bernhard Hennen kehrt nach »Elfenmacht« erstmals wieder in seine Elfen-Welt zurück und legt ein episches Meisterwerk vor!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1015
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
DASBUCH
Im paradiesisch schönen Reich Langollion ziehen Schatten auf: Fürstin Alathaia hat gerade in Erfahrung gebracht, dass eine mächtige Gegenspielerin Meuchelmörder auf sie angesetzt hat. Auch ihr treuer Leibwächter Nanduval ist in höchster Unruhe. Vollkommen zu Recht: die Assassinin Adelayne, die nur jene umbringt, die es wirklich verdienen, plant bereits einen raffinierten Anschlag auf Alathaia. Unwissend assistiert ihr dabei der Wolfself Melvyn, der als extrem unbegabter Diplomat für Ablenkung sorgt. Und welche Rolle spielt der Meisterbogenschütze Laurelin, der einen schrecklichen Fluch auf sich geladen hat? Als auch noch eine lange tot geglaubte Erzfeindin, Leynelle, wiederauftaucht, muss Alathaia alles auf eine Karte setzen. Gemeinsam mit Freund und Feind zieht sie los, um ihren Traum von einer besseren Welt zu retten. Sie ahnt noch nicht, wie hoch der Preis ihrer Mission sein wird …
DERAUTOR
Bernhard Hennen, 1966 geboren, studierte Germanistik, Geschichte und Vorderasiatische Altertumskunde. Mit seiner »Elfen«-Saga stürmte er alle Bestsellerlisten und schrieb sich an die Spitze der deutschen Fantasy-Autoren. Bernhard Hennen lebt mit seiner Familie in Krefeld.
BERNHARD
HENNEN
SCHATTENELFEN
DIE BLUTKÖNIGIN
Roman
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Bernhard Hennen
Copyright © 2021 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Uta Dahnke
Coverkonzept: Bernhard Hennen
Covergestaltung: Das Illustrat, München,
unter Verwendung einer Illustration von Kerem Beyit
Karten im Innenumschlag: Andreas Hancock
Illustration Elfenknoten: Olaf Sigel
Herstellung: Mariam En Nazer
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-26994-4V003
www.heyne.de
Für die Schöne vom großen Fluss
»Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht!«
(Rosa Luxemburg zugeschrieben)
EIN LETZTES MAL
Ein letztes Mal würde er seine Abscheu überwinden und mit aller Hingabe das Falsche tun. Sobald diese Jagd jedoch vorüber war, würde er mit dem Gemetzel an wehrlosen Tieren für immer aufhören, schwor sich Laurelin.
Der Elf lauschte den Geräuschen des erwachenden Waldes. Das Holz knarrte in der Kälte. Der Ruf eines Eisvogels erklang vom nahen Bach. Nebel trieb zwischen den mit Raureif überkrusteten Bäumen. Goldene Lichtbahnen stießen durch den Dunst und ließen Eiskristalle aufblinken, als habe der Wald diamantenen Schmuck angelegt, um den Winter zu begrüßen.
Doch der ließ sich Zeit in diesem Jahr. In der Nacht hatte ein eisiger Nordwind sein Nahen angekündigt. Aber noch war kein Schnee gefallen. Noch bedurfte es eines wachen Auges, um die Fährten im Laub zu sehen. Die beiden Füchse waren gekommen, ganz wie Morwallon es vorausgesagt hatte.
Der würzig bittere Duft des Herbstlaubs hing in der Luft. Laurelin roch die Losung eines Bären, dicht bei den frostweißen Brombeerbüschen, weiter links am Hang.
Die Hand des Jägers tastete nach dem Köcher an seiner Hüfte.
»Er ist längst fort«, sagte Morwallon mit der Bestimmtheit, die wie stets seinen wenigen Worten das Gewicht unverrückbarer Wahrheit verlieh. Es folgte keine Erklärung, wie er zu seiner Gewissheit kam. Man konnte von ihm kaum lernen, konnte ihn nur beobachten und spekulieren. Das Wissen, das ihn zu dem gemacht hatte, der er war, gab er nicht preis. Aber er war ein Jäger, dem das Glück hold war, und deshalb war Laurelin mit ihm gegangen. Morwallon hatte ihn tief in die Snaiwamark geführt, in das Königreich der Trolle.
Laurelin blieb dem Elfen, der so viele Jahrhunderte älter war, auf den Fersen. Lautlos bewegte sich Morwallon. Er knickte keinen Ast, keinen der fahlen Grashalme. Eine sanfte Brise, die durch den Wald ging, hätte nicht mehr Spuren hinterlassen als er.
Morwallon folgte dem Hang. Er schritt, ohne zu zögern, stur und von sich selbst überzeugt. Gegen jede Vernunft hoffte Laurelin, dass sich der alte Jäger irrte. Der stieß ein selbstgefälliges Schnauben aus und deutete auf einen kleinen Durchschlupf im Brombeerdickicht.
Laurelin sah das Weiß zwischen den Ästen. Es war seidig und nicht kristallen wie der Raureif. Die beiden Füchse trugen schon den schneeweißen Winterpelz.
»Gier«, zischte Morwallon und bedachte Laurelin mit einem bedeutsamen Blick. Der alte Jäger wusste, dass er nur mitgekommen war, um seine Pelze nach Rosan zu bringen, damit sich die Pforten nach Langollion für ihn öffneten. Langollion, das Fürstentum, in dem jeder frei nach Erfüllung in seinem Leben suchte. Ein Ort ohne Zwänge, an dem alle glücklich waren.
Laurelin trat zu seinem Gefährten, der bei dem Dickicht kauerte und vorsichtig die Ranken auseinanderbog. Bei dem Kadaver des Hasen, den sie hierhergebracht hatten, lagen die beiden Schneefüchse. Die Zungen hingen ihnen aus den Schnauzen. Morwallon jagte bevorzugt mit Drahtschlingen. So nahmen die kostbaren Felle keinen Schaden.
»Gier und Liebe ohne Verstand …« Der Jäger griff nach dem ersten Fuchs und löste die Drahtschlinge von dessen Hals.
Auch wenn Laurelin längst nicht die Meisterschaft des alten Jägers besaß, vermochte er die Spuren zwischen den Ranken zu lesen. Es war alles genauso gekommen, wie Morwallon es vorausgesagt hatte. Sie hatten den Köder auf den Wildpfad im Dickicht gelegt, wo sie die Füchse zwei Tage zuvor gesehen hatten. Offenkundig war der Fuchsrüde zuerst gekommen und hatte sich in einer der Schlingen verfangen. Dann hatte die Fähe versucht ihn zu befreien. Morwallon hatte das vorausgesehen und mehrere Schlingen so ausgelegt, dass sie sich darin verfangen musste, wenn sie versuchte dem Rüden zu helfen.
»Ist noch Leben in dir?« Morwallon hatte jetzt die Hand nach dem Weibchen ausgestreckt, das zu zucken begann, obwohl es eben noch wie tot im Dickicht gelegen hatte.
»Zähes, kleines Biest«, sagte der alte Jäger voll Anerkennung, als sich seine schlanke Hand um die Kehle der Fähe schloss.
Ein Geräusch ließ Laurelin herumfahren. Ein Rascheln im trockenen Laub. Er kniete sich in seinen Eibenbogen und zog die Sehne auf.
Auf dem Hügelkamm über ihnen zeigte sich ein Eber mit mächtigen Hauern. Die Flanken des Tieres waren ergraut, wie er wusste. Es zitterte, sein Atem ging schwer. Abwägend blickte es zu ihnen hinab.
»Da stimmt was nicht«, flüsterte Morwallon. »Schieß!«
Es war seltsam, wie der Eber sie betrachtete. Gar nicht tierhaft. Gestern war er schon einmal hier gewesen. Auch da hatte Laurelin das Gefühl gehabt, dass das mächtige Tier sie beobachtete. Dabei stand der Eber so, dass er ein schlechtes Ziel bot. Vor allem sein Kopf war zu sehen, die Flanken verdeckt, als wüsste das Biest, dass ein Pfeil seinen dicken Schädelknochen auf diese Entfernung nicht durchschlagen konnte.
Ein Schauder überlief Laurelin, und die feinen Härchen in seinem Nacken und auf seinen Armen richteten sich auf. Er vermeinte eine abschätzende Bosheit im Blick des Ebers zu erkennen …
»Schieß!«, zischte Morwallon.
Der Eber senkte seinen massigen Schädel, als wolle er den Hang hinabpreschen. Er schnaubte. Sein Atem wogte in weißen Wolken um seine Nüstern.
Laurelin tastete nach seinem Köcher. Er musste eines der Augen seitlich am Kopf treffen. Kein leichtes Ziel.
Die Finger des Elfen tasteten über die Befiederung der Pfeile. Sein Blick blieb fest auf den Eber gerichtet.
Plötzlich warf sich der Eber herum und verschwand hinter dem Hügelkamm.
»Das ist nicht geheuer.« Morwallon hielt noch immer die Kehle der Fähe umklammert. Das Tier zuckte nicht mehr. »Lass uns von hier verschwinden. Schnell!« Er nahm die toten Füchse und ging ohne ein weiteres Wort, als seien düstere Ahnungen etwas, wovor man davonlaufen konnte.
Laurelin glaubte nicht an Omen oder ein vorherbestimmtes Schicksal. Was aus ihm wurde, hatte nichts mit dem Erscheinen eines seltsamen Ebers zu tun, sondern nur damit, wie er sich nun verhielt. Er nahm die Hand vom Köcher. Der kleine Finger seiner Rechten juckte, und er rieb ihn fahrig an seiner Kleidung. Dieses Jucken quälte ihn stets, wenn er angespannt war. Mit weiten Schritten folgte er Morwallon. Sie sollten die Jagdgründe der Trolle verlassen. Die weißen Füchse waren ein kleines Vermögen wert. Ihre Pelze glänzten und waren besonders dicht. Makellos! Sie hatten genug Beute gemacht. Endlich würde er das Leben führen können, von dem er schon so lange träumte.
IN DER HAUT DES TIERES
Goldmähne hatte einen Flugzahn aus dem Lederrund ziehen wollen.
Er aber war alt und erfahren. Er stürmte den Hang hinab und hinein ins Dickicht. Er kniff die Augen zu. Äste griffen in sein dichtes Fell, aber sie vermochten ihn nicht aufzuhalten. Seine Hufe trommelten auf dem weichen Boden. Sein Atem ging schnell. Er war so weit gelaufen.
Und immer noch war da dieser Geschmack von Blut. Er erinnerte sich, wie sich seine Hauer in das weiche Fleisch gegraben hatten, wie er kraftvoll den Kopf hin und her geworfen hatte. Wie seine Hauer das Fleisch zerfetzten und Blut sprühte. Und an das wütende Gebrüll.
Aber er war den grauen Schreiern davongelaufen.
So lange war er gelaufen. Er sehnte sich nach einem Versteck im Unterholz. Nach Rast. Danach, dass er nicht mehr hechelnd vor Erschöpfung atmete.
Seine Hufe zerdrückten das Herbstlaub.
Er musste weiterlaufen. Da war wieder ein Bild, tief in ihm. Ein Kreis aus Steinen, in dessen Mitte alles schwarz war. Der Geruch von Häuten und Tod. Er war dort schon einmal gewesen, hatte Goldmähne und den Alten betrachtet, obwohl er mit den Zweiläufigen nichts zu tun haben wollte. Alle Zweiläufigen waren gefährlich! Es war klug, sich von ihnen fernzuhalten.
Er hatte einmal gesehen, wie ein Flugzahn an einem langen Stock eine Hirschkuh mit nur einem Biss getötet hatte. Sie waren so schlimm wie die großen Adler, die im letzten Winter eine seiner Bachen geholt hatten.
Und dennoch strebte er ihrem Lager entgegen. Etwas zwang ihn, das zu tun und nicht bei seiner Rotte zu sein. Er wollte seine Läufe zwingen, ihn in eine andere Richtung zu tragen, doch gehorchten sie ihm nicht. Er brach aus dem Dickicht und eilte in Richtung Sonnenaufgang. Er preschte durch das hohe Gras, das sein saftiges Grün verloren hatte, vorbei an der Suhle, die er so gerne besuchte, wo das Wasser, das aus der Tiefe drang, warm und schmeichelnd war und der Boden sich in Herbst und Winter stets in Nebel hüllte.
Hinter dem Nebel fand er seine alte Fährte und folgte ihr zu dem Platz, wo ein Fels den Wind abhielt und ein Kreis von Steinen die Schwärze umschloss, die blieb, wenn die beißende Hitze gegangen war. Hier hatten die Zweiläufigen ihr Lager, zu dem sie immer wieder zurückkehrten, so wie er zu seiner Suhle.
Er umrundete das Lager, immer und immer wieder. Seine Läufe gehorchten ihm nicht. Endlich wandte er sich ab, grunzend vor Erschöpfung. Ein kühler Wind fuhr ihm durch das Fell. Er wollte rasten, wollte seine Hauer in schwarzem Erdreich vergraben, bis er die köstlichen, weichen Knollen fand. Aber die fremde Rastlosigkeit ließ ihm keine Ruhe.
Er sah den großen, grauen Stein mit den tiefen Narben. Das Bild war nicht vor seinen Augen, es war tief in ihm. Unwillig warf er seinen schweren Kopf hin und her. Er wollte nicht dorthin. Der Platz machte ihm Angst. Nie ließ sich ein Vogel auf diesem Stein nieder. Selbst der Wind schien vor ihm zurückzuschrecken.
Er warf sich herum, fiel in einen leichten Trab, getrieben dorthin zu hasten, wohin er nicht wollte.
DAS JAGDRUDEL
Morwallon zog sein Messer und durchtrennte den Strick, an dem sie den Sack mit den Fellen an dem Baum hinaufgezogen hatten.
Mit dumpfem Laut fiel er dicht neben Laurelin zu Boden. Der Bogenschütze bückte sich nach dem Rucksack mit dem Eisenkessel und den Vorräten.
»Lass das hier!«, fuhr Morwallon ihn an. »Das hält uns nur auf.«
»Wovor laufen wir fort? Was hast du in dem Eber gesehen?«
Mit geübten Schnitten zog der Jäger den beiden Füchsen das Fell ab. Bei ihm sah es so leicht aus, wie einen Wollstrumpf vom Bein zu streifen. Hastig schlug er die Felle in ein altes Leinentuch ein. Plötzlich hielt er mitten in der Bewegung inne. Er drehte den Kopf und blickte nach Westen. Seine Nasenflügel zitterten wie bei einem Raubtier, das Witterung aufnahm.
Hastig stopfte Morwallon die beiden Felle in den Sack mit der restlichen Beute. »Lauf!«
Laurelin folgte seinem Blick. Ein breiter Streifen glühenden Rots am Horizont war der letzte Gruß des sterbenden Tages. In den Niederungen der sanft geschwungenen Landschaft sammelte sich Nebel, aus dem die Kuppen der Hügel wie Inseln ragten. Auf einem graste eine Herde von Büffeln. Hier und dort gab es kleine Wälder. Laurelin bemerkte einige auffliegende Raben, etwa eine Meile entfernt. Was hatte sie aufgescheucht?
Morwallon war fast im Nebel verschwunden. Mit einem leisen Fluch folgte Laurelin dem alten Jäger. Was fürchtete er? Ein paar Trolle? Laurelin wusste, dass Morwallon ihn vor allem wegen der Trolle mitgenommen hatte. Es gab eine berühmte Geschichte über ihn. Morwallon war bei den Maurawan gewesen, die ins Fjordland gezogen waren, um Königin Emerelle zu retten. Als Späher war er allein von drei Trollen gestellt worden. Sie hatten ihn im Wald angegriffen. Nur fünfzig Schritt entfernt waren sie aus einem Versteck hervorgebrochen. Er hatte jeden von ihnen mit einem Schuss ins Auge getötet. Der dritte war ihm so nahe gekommen, dass er sterbend auf ihn stürzte. Zwei Tage hatte Morwallon im Schnee unter dem Troll begraben gelegen, unfähig, sich unter dem massigen Hünen hervorzuwinden. Er war halb erfroren, als die Maurawan, die nach ihm suchten, in den kleinen Wald kamen.
Jeder Elf im Norden kannte diese Geschichte. Doch Morwallon war nicht mehr der Krieger, der er einst gewesen war. Seine Hände zitterten manchmal, wenn er den Bogen hielt, und sein Blick war nicht mehr scharf wie der eines Falken. Er hatte ihn, Laurelin, ausgewählt, um diese Heldentat zu wiederholen, sollten sie von einem Jagdrudel Trolle überrascht werden. Die grauen Hünen schlossen sich selten zu größeren Rudeln zusammen, wenn sie auf die Pirsch gingen. Laurelin war sich sicher, drei oder vier von ihnen töten zu können, solange ihm fünfzig Schritt blieben, um zu reagieren. Aber es wurde Nacht, der Nebel erhob sich aus den Senken, und er wusste nicht einmal, ob sie vor Trollen davonliefen oder vor etwas ganz anderem. Wenn Morwallon nur reden würde!
Laurelin lauschte in die Dunkelheit. Da war kein verdächtiges Geräusch. Keine Witterung, die nicht zu den ziehenden Büffeln passte. Die Trolle rieben ihre Haut gern mit Fett ein. So roch man sie oft schon, bevor man sie sah.
Das hohe Gras war feucht vom Nebel. Ein Wind kam von Norden auf und schnitt Laurelin scharf ins Gesicht. Er spielte mit dem Nebel. Zerpflückte ihn. Gaukelte dem Blick Gestalten vor, wo es nur wogenden Dunst gab.
Ab und zu hielt Morwallon an und nahm Witterung.
Die ganze Zeit über hielt Laurelin den Bogen in der Linken. Seit Stunden schon war die Sehne aufgezogen. Bei jedem Herzschlag rechnete er damit, die wilden Schlachtrufe von Trollen zu hören. Das Eibenholz und die Sehne würden an Kraft verlieren, wenn er die Waffe immerzu gespannt ließ.
Laurelin blickte zum Mond hinauf. Er war zu zwei Dritteln voll. Keine Wolke zog über den Himmel. Das silberne Licht ließ die Hügelkuppen aussehen, als schwebten sie über dem Nebel. Es war eine Nacht voll magischer Schönheit. Eine Nacht, die er vielleicht auch dann durchwacht hätte, wären sie nicht auf der Flucht.
Etwa eine halbe Meile vor ihnen erblickte Laurelin den Wolvesdrüzzel, einen großen, grauen Felsen, der sich in einer Senke aus dem verdorrten Gras erhob. Er erinnerte entfernt an eine Wolfsschnauze. Es war der Ort, der ihnen die Flucht ermöglichen würde.
Plötzlich hob Morwallon den rechten Arm und ging in die Hocke. Das Gras wuchs hier besonders hoch, es verbarg sie fast ganz, als auch Laurelin niederkniete.
Er sog scharf die Luft durch die Nase ein. Er roch nichts Verdächtiges. Aber es mochte sein, dass der Geruchssinn des alten Jägers schärfer war als der seine.
»Wenn sie uns erwarten, dann hier«, flüsterte Morwallon.
Am Wolvesdrüzzel lag einer der zwei großen Albensterne im Umkreis von mehr als hundertfünfzig Meilen. Es war leicht vorhersehbar, dass sie zu einem der beiden Albensterne flüchten würden, wenn eine Hetzjagd begann. Aber wovor liefen sie davon?
»Wir trennen uns«, zischte Morwallon. »Du näherst dich dem Stein von Süden, ich von Norden. Und sei vorsichtig. Du wirst sie eher riechen als sehen.«
Ohne seine Antwort abzuwarten, verschwand der alte Jäger im Nebel. Laurelin fühlte sich verraten. Warum teilte Morwallon seine Befürchtungen nicht mit ihm? Was ging hier vor? Oder wollte der Jäger ihn einfach loswerden?
Laurelin wartete, horchte in die Nacht. Da war kein Geräusch. Er blieb im hohen Gras knien und wog seine Möglichkeiten ab. Etwas war dort im Dunkel. Etwas suchte nach ihnen. Aber er verstand nicht, was es mit dem Eber zu tun hatte. War das Tier besessen? Oder vermochte es zu zaubern? Oder war es Morwallon, der besessen war? Vielleicht war sein Gefährte einfach zu alt. Vielleicht hatte er zu vieles gesehen, und die Erinnerung an die Schrecken der Vergangenheit verstellte ihm den Blick auf das, was in der Gegenwart tatsächlich vor sich ging.
Laurelin wandte den Kopf in alle vier Himmelsrichtungen. Er roch die Feuchtigkeit und den schweren, schwarzen Boden. Da war ein Hauch von nassem Pelz im Süden. Aber es war ihm unmöglich zu sagen, was für ein Pelztier es war. Und etwas Kleines bewegte sich im Westen durch das hohe Gras. Ein Fuchs vielleicht?
Laurelin richtete sich auf. Vorsichtig hielt er das Gras zur Seite, setzte jeden Schritt mit Bedacht und wagte kaum zu atmen. Jetzt erkannte er den Geruch. Diese unverwechselbare Mischung von Ausdünstungen. Irgendwo vor ihm verbarg sich ein Keiler im hohen Gras.
Der Elf verharrte. Einen Herzschlag. Zwei. Er tastete nach dem Köcher an seiner Seite, schlug die Klappe zurück, die seine Pfeile vor der Feuchtigkeit schützte. Seine Fingerkuppen tasteten über die Nocken aus Horn und die Befiederung der Schäfte. Sie alle unterschieden sich. Er fand den Pfeil, den er gesucht hatte. Den mit der schweren, dreikantigen Spitze. Er war dazu gefertigt, Plattenrüstungen zu durchschlagen. Traf er im rechten Winkel auf, vermochte er fast jeden Helm zu durchdringen. Dieser Pfeil würde vielleicht auch den dicken Schädelknochen des Ebers durchschlagen, wenn er nahe genug an ihn herankam.
Er hakte den Pfeil in die Sehne. In der Finsternis würde er den Eber erst im allerletzten Augenblick sehen. Er sollte sich mehr auf seine anderen Sinne verlassen.
Eine sanfte Bö entlockte dem hohen Gras ein leises Rauschen. Der Nebel geriet in Bewegung. Wie ein Reigen tanzender Geister wirkte er im Mondlicht.
Der Geruch des Eberfells war nun sehr deutlich. Der Schwarzkittel konnte nicht mehr weit entfernt sein. War da ein leises pfeifendes Geräusch?
Laurelin fand eine Gasse niedergetrampelter Halme. Und dann sah er ihn. Gestalt gewordene Dunkelheit. Keine drei Schritt entfernt. Der Eber! Er lag am Boden.
Mit angehaltenem Atem näherte sich Laurelin und zog die Sehne durch.
Die Läufe des Ebers zitterten schwach.
Angespannt beobachtete der Elf den Schwarzkittel. Mit dem Tier stimmte etwas nicht.
Er nahm den Pfeil von der Sehne und schob ihn zurück in den Köcher. Vorsichtig näherte er sich.
Noch ein Schritt.
Er beugte sich vor.
Der Atem des Ebers war nur noch ein sachtes Pfeifen. Laurelin berührte die drahtigen Borsten. Der Körper fühlte sich kalt an. Das Herz schlug schwach und unregelmäßig. Der alte Keiler war zu Tode erschöpft. Er würde sich nicht mehr erheben.
Dunkle Augen blickten zu ihm auf. Da lag nichts Lauerndes mehr in dem Blick. Nichts, was unnatürlich wirkte. Nur das Wissen um den nahen Tod.
Der Nebel über Laurelin zerriss. Fahles Licht leuchtete den letzten Ruheplatz des Ebers aus. Da war etwas … Laurelin stieg über den Schwarzkittel hinweg und fand noch mehr niedergedrücktes Gras. Etwas hatte hier gelegen. Viele Stunden lang.
Laurelin flüsterte ein Wort der Macht. Er konzentrierte sich auf das Licht. Fasste es zusammen, lenkte es. Er legte die Rechte flach und mit weit ausgestreckten Fingern in die Mitte des niedergedrückten Grases. Da war ein Hauch von Wärme. Es war noch nicht viel Zeit verstrichen, seit sich derjenige erhoben hatte, der hier auf den Eber gewartet hatte.
Laurelin kratzte sich nervös am kleinen Finger seiner Rechten. Da war wieder dieses unerträgliche Jucken. Er musste sich beherrschen, sonst würde er sich den Finger blutig kratzen. Dieses verfluchte Jucken!
Das Licht, das er eingefangen hatte, zerstreute sich wieder. Derjenige, der den Eber erwartet hatte, war wahrscheinlich zum Albenstern gegangen. Durch das magische Portal konnte er überallhin fliehen. Seiner Fährte im Netz der magischen Pfade zu folgen überstieg Laurelins Möglichkeiten.
»Komm!«
Das war die raue Stimme Morwallons. Bestimmt war der Jäger schon an dem Portal. Laurelin blickte auf den sterbenden Eber und das niedergedrückte Gras. Er würde nicht mehr herausfinden, wer hier geruht hatte. Und was scherte es ihn? Nur noch ein Tag, und er wäre in Langollion.
Entschlossen wandte er sich ab und strebte durch das hohe Gras dem Menhir entgegen. Tief sog er die nebelfeuchte Luft ein. Es war kalt. Der Atem stand ihm in kleinen Wolken vor dem Mund. Da war kein ungewöhnlicher Geruch. Kein Geräusch.
Er kratzte sich am kleinen Finger. Nur dieses verfluchte Jucken.
Morwallon kauerte vor dem großen Stein. Im Mondlicht wirkten die verschlungenen Muster in der Oberfläche des Menhirs wie Narben.
Der alte Jäger war ganz in sich versunken. Leise murmelte er die Worte der Macht, um das verborgene Tor am Schnittpunkt der sieben Albenpfade zu öffnen.
Laurelin schlug die Klappe seines Köchers zurück und strich über die Nocken seiner Pfeile, um sich von dem unerträglichen Jucken abzulenken.
Zwei Lichtsäulen wuchsen rechts und links von Morwallon aus dem Gras, dick wie die Stämme zwanzigjähriger Eichen. Das Licht hatte das satte Gelb von Butterblumen. Ein weiteres Licht kam hinzu. Blassorange. Es wand sich um die Säulen wie Efeu, das einen alten Baum erdrosselte.
Weitere Lichtstränge rankten empor. Fahlgrün, rot, blau, als wollten sich die Farben eines Regenbogens um die Säulen versammeln. Die Säulen selbst aber krümmten sich und strebten einander entgegen, bis sie sich zu einem Torbogen vereinten.
Laurelins Fingerspitzen tasteten über eine Nocke, erfassten ihre Form, die Art, wie der leimgetränkte Faden um den Schaft darunter gewickelt war. Dies war ein Pfeil mit einer breiten Blattspitze, dazu geschaffen, klaffende Wunden zu schlagen. Wunden, durch die viel Blut rann …
Eine schwarze Fläche erschien im Torbogen und versperrte den Blick auf den Menhir. Einen Herzschlag lang nur, dann war ein goldener Pfad zu sehen. Und riesige Gestalten. Nackt, mit narbenübersäten Körpern, grau wie Granit. Sie hielten Keulen und Steinäxte in ihren plumpen Händen. Starrten sie mit bösartigen, kleinen Augen an.
Eine Gestalt stach zwischen den Hünen hervor. Sie war als einzige bekleidet, wenngleich ihr Gewand wie Lumpen wirkte. Es bestand ganz und gar aus Streifen von altem Fell und Leder, die ohne Ordnung zusammengenäht waren. Die großen Hände waren mit schmutzigem Leinen umwickelt. Vor dem Gesicht trug die Gestalt eine Maske aus verschrumpelter Haut. Kalte graue Augen blickten auf Laurelin herab.
»Wir haben euch erwartet, Elflein«, ertönte eine tiefe Stimme hinter der Maske.
Laurelin riss den Pfeil aus dem Köcher. Mit einer fließenden Bewegung hakte er die Nocke in die Sehne.
Morwallon drückte den Arm, mit dem Laurelin den Bogen hielt, nieder. »Zu viele, zu nah.«
AM SEIDENEN FADEN
Adelayne drückte die Flamme auf der Öllampe neben dem großen Bett aus und flüsterte ein Wort der Macht. An der Aura der jungen Elfe konnte sie beobachten, wie diese aus einem unruhigen Halbschlaf in einen tiefen Schlummer hinüberglitt.
Ruhig betrachtete die Zauberweberin den Fürsten. Er war alt … Es gab Heldenlieder über Bonnefays große Taten in der Vergangenheit. Seine Taten der letzten Jahrzehnte würden keinen Barden je zu einem Lied inspirieren. Über sie wurde nur getuschelt. Er holte sich die jungen Mädchen aus den Elfenfamilien, die seiner Macht und seinem Namen nichts entgegenzusetzen hatten. Manche legten ihm ihre Töchter freiwillig ins Bett, weil sie sich Vorteile davon erhofften. Bei den meisten war es nicht so. Adelayne hatte nicht lange suchen müssen, um eine Familie zu finden, deren Tochter bald in das gefährliche Alter kam und die gern eine beträchtliche Summe Goldes gegen das Leben Bonnefays eintauschen wollte.
In der völligen Dunkelheit des Zimmers vermochte Adelayne allein die Auren der beiden zu sehen. Während die Aura des Mädchens blassgrau vor Angst war und fast unsichtbar blieb, erstrahlte die des Fürsten im Scharlachrot der Selbstgefälligkeit und übertriebenen Sinnlichkeit.
Im Licht der Aura vermochte die Zauberweberin sein Antlitz gerade noch zu erkennen. Das übrige Zimmer blieb im Dunkel. Bedächtig nahm Adelayne den dicken Seidenfaden aus der Tasche an ihrem Gürtel und rollte ihn ab. Mit ausgestrecktem Arm hielt sie ihn über Bonnefays Gesicht. Sein Mund war leicht geöffnet. Der Faden pendelte im Atem des Fürsten.
Mit der Linken nahm Adelayne die kleine Phiole aus der Gürteltasche. Viele Tage hatte sie an dem Gift gewirkt. Es aus den Schwefelpilzen zu destillieren war nicht schwer gewesen, doch ihm seinen Geruch und den bitteren Geschmack zu nehmen hatte sie endlose Stunden gekostet. Es würde Bonnefays Herz immer schneller schlagen lassen, bis es schließlich vor Anstrengung zerspringen musste. Ein schneller und dennoch sehr schmerzhafter Tod. Vor allem aber würde es so aussehen, als habe ihm diese letzte Liebesnacht zu viel abverlangt. Niemand würde an einen Mord denken.
Sie hob die Phiole, bis sie spürte, dass diese die Seide berührte. Dann ließ sie den Faden ein wenig sinken. Undeutlich sah sie das selbstgefällige Antlitz des Fürsten im pulsierenden Licht der Aura. Das Ende des Fadens fand seinen Mundwinkel. Bonnefay gab ein unwilliges Knurren von sich. Adelayne verharrte, wagte nicht einmal mehr zu atmen. Sie wusste nur zu gut um seinen Ruf als Krieger. Wenn er aufwachte, bevor das Gift wirkte, würde er sie binnen weniger Herzschläge überwältigen.
Geduld, ermahnte sie sich stumm. Albenmark würde nach dieser Nacht ein besserer Ort sein. Sie nahm Gold für ihre Morde, ja, aber sie suchte sich ihre Opfer sorgfältig aus. Sie hatte nie jemanden getötet, der unschuldig war.
Bonnefay fuhr sich im Schlaf mit der Zunge über die Lippen. Adelayne hob die Phiole. Ein einzelner Tropfen rann den Seidenfaden hinab zum Mundwinkel des Fürsten. Das mochte er vielleicht noch überleben, doch es würde eine schreckliche Nacht für ihn werden. Sie hob die Phiole erneut und dachte an all die Mädchen, die er sich geholt hatte. Wahrscheinlich hielt er sich auch noch für einen unwiderstehlichen Liebhaber. Er sah nicht schlecht aus, hatte hohe Wangenknochen, eine scharf geschnittene Nase und sinnliche Lippen. Wann hatte er begonnen, innerlich zu verrotten?
Der zweite Tropfen erreichte seinen Mundwinkel. Sein Tod war jetzt unabwendbar. Aber bei dieser Dosis mochte es bis zu einer halben Stunde dauern, bis er verreckte. Er sollte schnell und lautlos sterben, auch wenn er einen leichten Tod nicht verdient hatte.
Ein weiterer Tropfen, klar wie eine Träne, rann den Faden entlang.
Der regelmäßige Atem des Fürsten brach ab, noch bevor das Gift seinen Mundwinkel erreichte. Er schlug die Augen auf und blinzelte verwundert. Dann griff er sich mit der Rechten an die Brust und tat einen tiefen Seufzer.
Der dritte Tropfen versickerte zwischen seinen Lippen. Adelayne zog den Seidenfaden hoch und trat einen Schritt vom Bett zurück.
»Wer ist da?«, fragte Bonnefay und rang um Luft. Er presste sich auch die zweite Hand auf die Brust und richtete sich im Bett auf.
Adelayne wich weiter zurück und beobachtete, wie sich die Aura des Fürsten veränderte. Das Scharlachrot wurde zu einem dunklen Rot, das beinahe die Farbe von Blut hatte. Es flackerte unruhig. »Wer bist du?«, keuchte der Fürst mit sich überschlagender Stimme. Er tastete, über den Körper des schlafenden Mädchens hinweg, nach dem großen Spiegel an der Wand. Seine Aura brannte nun hell wie eine Fackel und bildete Tentakel aus, die in Adelaynes Richtung griffen, sie jedoch nicht erreichten.
»Ich bin der Tod«, sagte die Elfe leise. Sonst waren melodramatische Phrasen so gar nicht ihre Art, doch dem Fürsten dabei zuzusehen, wie das Leben aus ihm wich, erfüllte sie mit einer tiefen Genugtuung.
Bonnefays Atem wurde zu einem hektischen Hecheln. Die Tentakel verblassten. Löcher fraßen sich aus dem Inneren seiner Aura nach außen. Er sank auf die Kissen zurück, gab Laute von sich, die sich nicht mehr zu Worten fügen wollten. Dann war er still. Das Leuchten der verbliebenen Aura verlor an Strahlkraft. Es erinnerte an die ersterbende Glut eines Feuers.
Adelayne schlich zur Tür. Sie würde in das Bett des Hauptmanns Lavalle zurückkehren. Sie hatte dem Krieger einen leichten Schlaftrunk verabreicht. Morgen würde sie das prächtige Herrenhaus verlassen und ihrer Wege gehen. Es gab noch viele Ungeheuer, gegen die niemand das Schwert zu führen wagte. Sie würde nicht lange nach der nächsten Herausforderung suchen müssen.
EIN FALSCHES WORT
Der Gestank des groben Ledersacks, den sie ihm über den Kopf gestülpt hatte, nahm Laurelin den Atem. Wieder kämpfte er gegen den Brechreiz an. In dem Sack mussten die Innereien von Tieren gelegen haben. Länger, viel länger, als gut war. Warum nahmen sie ihm das Ding nicht ab? Er konnte verstehen, dass die Trolle geheim hielten, wohin sie ihn gebracht hatten. Es war für sie wohl irgendein bedeutsamer Ort. Aber jetzt war er hier. Seit Stunden. Er schien in einer Höhle zu sein. Trotz des Sacks konnte er Rauch riechen. Er spürte die Wärme eines nahen Feuers. Nicht weit entfernt hörte er gedämpfte Stimmen. Allerdings verstand er die grobe, kehlige Sprache der Trolle nicht. Für ihn klang es wie das Grunzen wilder Tiere, wenn sie sich unterhielten.
Die Trolle hatten sie durch den Albenstern gebracht. Der Ort, an dem sie nun waren, konnte sich überall auf der Welt befinden. Aber es war kalt in dieser Höhle, und er hoffte, dass sie die Snaiwamark nicht verlassen hatten. Als sie nach ihrer kurzen Reise durch das Nichts aus dem Albenstern getreten waren, hatte sie noch ein langer Fußmarsch über felsigen Grund erwartet. Es war fast die ganze Zeit über bergauf gegangen. Vielleicht waren sie ja irgendwo in der Nähe des Königssteins?
Schritte schreckten Laurelin aus seinen Gedanken.
»Wir sollten etwas von ihnen abschneiden«, drängte die Stimme der Kreatur mit der Maske, die ihnen auf den Albenpfaden bei dem Menhir aufgelauert hatte. Sie sprach Elfisch, damit er verstand, was ihn erwartete.
»Es hilft immer, wenn man etwas abschneidet. Nichts löst Zungen so gut wie ein paar abgetrennte Finger.«
Der Ledersack wurde Laurelin vom Kopf gezogen. Das Licht des nahen Feuers blendete ihn nach der völligen Finsternis. Er blinzelte die Tränen aus den Augen. Verschwommen sah er zwei hünenhafte Gestalten.
»Erstaunlich, in seiner Aura sehe ich kaum Anzeichen von Angst.«
Es war die andere, die nun gesprochen hatte. Sie klang alt wie die Zeit.
»Vielleicht ist er ja zu dumm, um zu verstehen, in welcher Lage er sich befindet«, bemerkte das Trollweib, das ihm an der magischen Pforte aufgelauert und den Sack über den Kopf gestülpt hatte.
Langsam klärte sich Laurelins Blick. Neben der Hünin mit der Maske stand eine gebückte Gestalt. Sie trug ein langes Kleid, das mit so vielen Flicken besetzt war, dass seine ursprüngliche Farbe nicht mehr zu erkennen war. Unzählige Amulette hingen an Lederriemchen von ihrem Hals. Vogelfüße, deren Krallen sich wie die kunstvollen Fassungen eines Goldschmieds um seltsame Steine geschlossen hatten, als sie vertrockneten und schrumpften. Merkwürdige Federn, so bunt, wie Laurelin sie noch bei keinem ihm vertrauten Vogel gesehen hatte. Äste und Knochen. Holzscheiben, in die Runenzeichen geschnitten waren. Ein Daumen, der beunruhigend rosig aussah, als sei er gerade erst abgeschnitten worden. Das unheimlichste an der gebückten Gestalt waren jedoch nicht die Amulette, sondern ihre Augen, die von einer schleimig weißen Schicht überzogen waren und ihn dennoch durchdringend ansahen.
»Du bist die Schattenweberin«, flüsterte Laurelin.
Das Trollweib stieß ein keckerndes Lachen aus. »Wie ich sehe, erzählt man sich noch Geschichten über mich.« Sie lachte erneut. »Jetzt verändert sich seine Aura, Birga. Das leuchtende Grün wird blasser und immer grauer. Langsam kriecht die Angst in sein Herz.«
Laurelin kämpfte dagegen an. Er zitterte nicht, er wich dem Blick der blinden Schamanin nicht aus. Er vermochte seinen Körper zu beherrschen, aber wie er verbergen konnte, dass seine Gefühle sich in seiner Aura spiegelten, wusste er nicht.
Die Blinde legte ihm ihre riesige Hand auf die Schulter. »Recht hast du, Angst zu haben.«
»Morwallon und ich haben nur Wild genommen, das Trolle nicht jagen würden. Wir haben uns zwar in eure Jagdgründe geschlichen, aber wir haben keinen Schaden angerichtet.«
»Frech ist der Wicht«, murmelte die Schamanin mit der Maske und streckte ihre bandagierten Hände nach ihm aus. »Darf ich ihm einen Daumen ausreißen, Skanga? Ich wüsste gern, wie er wimmert.«
Die Blinde schüttelte den Kopf. »Bring den anderen her.«
»Mit ihm werden wir keinen Spaß haben«, grollte Birga. »Wir haben doch schon gesehen, dass er nicht redet. Aber dieser hier …« Sie gab einen lustvollen Seufzer von sich. »Er wird reden, da bin ich mir sicher.«
Laurelin biss sich auf die Lippe. Was würden sie ihm antun? Er war zuversichtlich, dass er der Folter widerstehen würde. Das karge Leben in den Slanga-Bergen machte hart. Aber Skanga war eine Zauberweberin. Ganz sicher kannte sie Wege, die er sich nicht einmal vorzustellen vermochte, um ihm die Zunge zu lösen. Es hieß, dass sie in der Blutmagie bewandert war, jenem dunklen Pfad der Zauberei, der seine Kraft aus der Lebensessenz anderer schöpfte.
»Morwallon«, sagte Skanga nachdenklich, als ihre Gefährtin im Dunkel der Höhle verschwunden war. »Jetzt verstehe ich, warum uns dein Freund seinen Namen nicht genannt hat. Ich werde Herzog Orgrim rufen lassen. Soll er …«
Laurelin entschied sich für die Flucht nach vorn. Gnade durfte man von Trollen nicht erwarten, aber vielleicht schätzten sie Mut und Aufrichtigkeit. »Warum wir hier sind? Wir sind nur einfache Jäger, und wir …«
Der Schlag kam so überraschend wie heftig und riss Laurelin zu Boden.
»Halte mich nicht für dumm, Elflein!«, grollte die Blinde. »Unsere Jäger haben die Spuren gelesen. Der Keiler, der Orgrims Sohn getötet hat, kam aus eurem Lager. Er war auch nach dieser Bluttat bei euch. Und wir haben seinen Kadaver bei dem Albenstern gefunden, durch den ihr flüchten wolltet. Wir wissen, dass es Mord und kein Jagdunfall war. Wir wollen nur noch hören, wer der Dritte war, der euch begleitet hat, und wer euch geschickt hat.«
Laurelin war von dem Schlag noch ganz benommen. Er schüttelte den Kopf. »Wir haben nicht …« Eine Ohrfeige, die seinen Kiefer knirschen ließ, traf ihn.
»Wenn du aufhörst zu lügen, werde ich aufhören, dich zu schlagen«, sagte die blinde Schamanin ruhig.
Laurelin begriff, dass er in dieser Höhle sterben würde. Von dem Mord und was der Keiler damit zu tun hatte, wusste er nichts. Also konnte er nicht sagen, was die Schamanin hören wollte. Trolle hatten Respekt vor Mut und Zähigkeit, aber sie waren so nachgiebig wie Granit. Sie würde auf ihn einprügeln, bis er verreckte.
DIE GEWÄHLTE HAUT
Melvyn krümmte sich vor Schmerz. Das war Freiheit! Seine Gelenke krachten. Der Zauber zerrte an seinen Sehnen und Muskeln. Es fühlte sich an, als wollten sie ihm von den Knochen reißen.
Mit einem wilden Schrei bäumte er sich auf, schrie den Schmerz in den frostklaren Himmel hinauf. Echos hallten von den kahlen Felswänden des weiten Tals.
Ein Wolf antwortete mit einem lang gezogenen Heulen. Mit einer Strophe aus dem Lied, das sie gemeinsam in den Vollmondnächten sangen. Melvyn hätte die Stimme unter Hunderten erkannt. Es war Silberohr, sein Bruder, mit dem er schon so oft zusammen auf die Jagd gegangen war. Vor einer Stunde noch hatten sie gemeinsam nach der Kehle des großen Elchbullen geschnappt, den das Rudel einen Tag und eine Nacht lang gehetzt hatte. Sie waren den mächtigen Hufen des Elchs ausgewichen, der hart um sein Leben gekämpft hatte. Rotrücken war zu alt für diesen Tanz gewesen. Ihn hatte ein Tritt erwischt. In den Nacken. Die Säule aus Knochen, die den Geist und die Glieder miteinander verband, war zerbrochen. Er hatte sich nur noch mit den Vorderläufen vorwärtsschleppen können. Lange hatte sein Leiden nicht gedauert. Ein weiterer Huftritt hatte ihm den Kopf zerschmettert.
Sieben Welpen hatte dem Elch den rechten Hinterlauf durchgebissen. Selbst danach hatte der Bulle noch fast eine Stunde gekämpft. Er hatte sich in ein Eibendickicht zurückgezogen, sodass sie ihn nicht mehr von allen Seiten hatten angreifen können.
Die Verwandlung war beendet. Melvyn hatte wieder jene Gestalt angenommen, die er so sehr hasste. Halb Elf, halb Mensch, war er anders als jedes andere Geschöpf in Albenmark. Er gehörte nicht dazu. Nur die Wölfe behandelten ihn wie einen der Ihren. Oft nahm er Wolfsgestalt an. Sich zu verwandeln war ein lustvoller Schmerz. Von der Haut, in die er geboren war, in jene Haut, die er sich erwählt hatte, zu schlüpfen machte ihn glücklich. Wenn er mit dem Rudel durch die Berge und Wälder streifte, war er frei.
Er vermochte auch lediglich in den Geist eines Tieres einzudringen. Ihm die Taten zu diktieren. Sich seinen Körper und seine Sinne leihen. Er mochte diese Spielart der Magie nicht, wenngleich sie manchmal nützlich war. Gedankenverloren streckte er sich und blickte in den Himmel. Er schmeckte noch Blut auf seiner Zunge.
Wieder heulte sein Bruder Silberohr. Dieses Mal lag eine Mahnung in dem melancholischen Lied.
Melvyn wusste, dass sie da war. Er hatte ihre Witterung aufgenommen. Fast sein ganzes Leben hatte er in der Wildnis verbracht. Ihm entging nur wenig. Selbst wenn er Gedanken an die Jagd nachhing und in den Himmel blickte.
Es roch nach Fuchs, nach feuchtem Leinen und gefettetem Leder. Und da war auch ein Hauch von Duftwasser. Ein schwerer, fremder Geruch. Er erinnerte sich von seinen Reisen in den tiefen Süden daran. Lange war es her … Eine gelbe Frucht. Maracuja. Ein wenig Vanilleduft war auch dabei.
»Was willst du?«, fragte er ungehalten und ohne sich der Besucherin zuzuwenden.
»Ich bin nur eine Botin.« Die Stimme klang sachlich. Und es lag keinerlei Furcht in ihr. Das nötigte Melvyn Respekt ab. Ein großes Rudel Wölfe strich durch das Tal. Obwohl der Elchbulle ein guter Fraß gewesen war, waren viele noch hungrig.
»Es war schwer, dich zu finden«, fuhr die Botin ruhig fort. »Fünf Tage suche ich nun schon nach dir.«
»Ich bin eben ein unsteter Wanderer.« Melvyn drehte sich auf den Bauch. Etwa zwanzig Schritt entfernt, nahe einem herbstkahlen Birkenhain, stand die Lutin. Die fuchsköpfige Koboldin trug ein hoch geschlitztes grünes Kleid, darunter rote Hosen und Stiefel, die teuer aussahen. Ein breiter Gürtel, von dem ein Dutzend Taschen und Beutel hingen, ließ sie etwas füllig erscheinen. Sie hatte den Kopf schief gelegt und sah ihn keck an.
»Wer schickt dich?«, fragte er mürrisch.
»Das weißt du doch«, entgegnete die Lutin ruhig. »Die, deren Wünsche Befehlen gleichkommen. Es gilt, eine alte Schuld zu begleichen, Melvyn.«
DER KRIEG IM SCHATTEN
Nanduval zerrieb ein gelbes Rosenblatt zwischen den Fingern. Dann hob er die Hand an sein Gesicht, schloss die Augen und gab sich ganz dem Duft hin. Er rang um Gleichmut. Seit Tagen wartete er nun schon in der Rosenlaube nahe dem Albenstern. Es war ein goldener Herbst. Die Luft war noch mild. Die Sonne schmeichelte seinem Antlitz, doch ihre Kraft reichte nicht mehr aus, um den Stein der Marmorbank, auf der er saß, warm werden zu lassen.
Gleichmut, ermahnte er sich in Gedanken. Er versuchte das Bild einer vollkommenen Rose hinter seinen geschlossenen Lidern erstehen zu lassen. Blattkranz um Blattkranz baute er sie in Gedanken auf. Er zwang sich, tief und regelmäßig zu atmen.
Am liebsten wäre er losgezogen, um mit einem langen Stock in dem Brennnesselfeld zu wüten, das keine zwanzig Schritt von der Laube entfernt lag. Ein kindlicher Gedanke, das war ihm klar, und doch wäre es erleichternd, all den angestauten Gefühlen endlich freien Lauf zu lassen. Er brauchte etwas, worauf er eindreschen konnte. Eine Fechtstunde wäre auch nicht übel. Er würde gleich drei der jungen Rekruten auf einmal fordern.
Nanduval schlug die Augen auf. Er war nicht der Mann für stille Einkehr. Meditation lag ihm nicht. Er war der Hauptmann der Leibwache der Fürstin von Langollion. Das helle Lied der Schwerter, das war sein Leben! Er hörte das Gezwitscher der Amseln, die hinter ihm im dichten Geäst der Rosenlaube hockten.
Nanduval blickte zu dem nahen Albenstern. Eine geborstene Marmorsäule markierte den Ort, an dem das magische Tor lag. Vier Tage war es her, dass seine Fürstin Alathaia es geöffnet hatte und hindurchgeschritten war. Natürlich ohne ihn. Sie hüllte sich in Geheimnisse, wie andere Fürstinnen sich in kostbare Stoffe hüllten. Sie hatte ihn nicht an ihrer Seite geduldet. Ja, sie hatte ihm nicht einmal gesagt, wohin sie reiste. War sie in Gefahr?
Er zupfte eine ganze Blüte vom Rosenbusch und zerdrückte sie in seiner Rechten. Wie sollte er sie beschützen, wenn sie sich seiner Obhut entzog? Sie hatte viele Feinde. Kein Tag verging, an dem nicht irgendwo in Albenmark ein Dolch gewetzt wurde, der in ihr Herz gestoßen werden sollte. Und alles, was er tun konnte, war, hier zu sitzen und darauf zu hoffen, dass sie wohlbehalten zurückkehrte, von wo immer sie auch gerade war.
Wieder sah er zu der geborstenen Säule. Blutrote Rosen umrankten den alten Marmor. Es hieß, die Säule stamme noch aus den Zeiten der Himmelsschlangen. Nanduval war nicht gut darin, die magischen Pforten zum Goldenen Netz zu öffnen. Er seufzte. Er war in so vielem nicht gut. In der Leibwache galt er als einer der besten Fechter, doch gegen Alathaia vermochte er nicht zu bestehen. Sie war geradezu unheimlich geschickt mit der Klinge. Sie brauchte keinen wie ihn, um sich einen Feind vom Hals zu halten. Zumindest keinen Feind, der so dumm war, sie zum stählernen Tanz zu fordern.
Das Vogelzwitschern verstummte. Plötzlich lag eine Spannung in der Luft. Selbst die leichte Brise erstarb. Es schien die Natur den Atem anzuhalten, als sich schlangengleich Licht aus dem Boden erhob. Sich windend, stiegen die Stränge empor und formten einen Bogen, dessen Inneres kurz von vollkommenem Schwarz erfüllt war. Dann sah Nanduval einen Goldenen Pfad. Darauf eine schattenhafte Gestalt, die durch das Tor ins helle Licht des Herbstnachmittags trat: Alathaia. Die Fürstin von Langollion trug ein schlichtes schwarzes Kleid mit weit ausgestellten Ärmeln. Das rabenschwarze Haar floss offen über ihre Schultern. Große grüne Augen beherrschten das schmale Gesicht mit den hohen Wangenknochen. Alathaia war blass und wirkte erschöpft. Einen Herzschlag lang verlor sich Nanduval im Anblick ihrer sinnlichen Lippen von der Farbe der Rosen, die sich um die Säule rankten.
»Willkommen zurück, Herrin.«
Sie nickte ihm geistesabwesend zu. Kurz sah sie hinüber zum Rosenturm am Ende des weitläufigen Parks, der zum Palast der tausend Blüten gehörte. Die verfluchte Ruine erhob sich auf einer Steilklippe am Meer. Der Turm war der älteste Teil des Palastes und der gemiedenste.
Nanduval trat an ihre Seite. Ein leichter Duft von Herbstlaub und Gras haftete ihr an. »Zwei gesattelte Pferde stehen bereit, Herrin.«
Wieder nickte sie nur geistesabwesend, um dann erneut zu der unheimlichen Ruine zu blicken. Manchmal zog sie sich dorthin zurück. Meist mit ihrem Gemahl. Der Leibwache war es verboten, sich dem Turm auf mehr als hundert Schritt zu nähern. Was dort vor sich ging, gehörte zu Alathaias vielen Geheimnissen.
»Du wirst die Wachen für mich und meine Familie verdreifachen, Hauptmann«, sagte sie so ruhig, als erteile sie lediglich Anweisungen, wie die Tafel für ein Festmahl zu decken sei.
»Was ist geschehen?« Kaum waren die Worte über seine Lippen, da bereute er sie. Sie erklärte sich niemals.
Alathaia sah ihm direkt in die Augen. »Der Krieg im Schatten wird wieder aufleben. Meuchler werden kommen. Die besten Albenmarks. Es wird Blut fließen, und du, Nanduval, wirst meine Augen sein, wo ich nicht hinblicke. Leuchte die dunklen Winkel aus. Misstraue jedem Fremden, der kommt. Achte auf heimtückische Schützen auf den Dächern. Ich weiß nun um ein Geheimnis zu viel. Deshalb ist mein Leben verwirkt. Verkaufe meine Haut so teuer wie möglich, Nanduval.«
»Eure Haut wird keinen …«
Sie hob die Rechte. Ihre Finger senkten sich auf seine Lippen. »Versprich nicht, was du nicht halten kannst. Ich vertraue dir. Ich weiß, du würdest dein Leben für mich geben. Aber jene, die kommen werden, sind genauso entschlossen, wie du es bist. Einen Meuchler, der bereit ist, sein eigenes Leben aufzugeben, kann man fast nicht aufhalten.« Ein trauriges Lächeln umspielte ihre Lippen. »Ich weiß, wovon ich rede.«
Er kannte die zahllosen Gerüchte, die sich um die Fürstin und ihre Vergangenheit rankten. Es gab einen Grund, warum sie so schnell mit der Klinge war. Aber wie sollte er, der er ihr in fast allen Belangen unterlegen war, aufhalten, wovor selbst sie sich fürchtete?
DER GEFRORENE AUGENBLICK
Adelayne fragte sich immer noch, was sie falsch gemacht hatte. Nicht zu wissen, warum der Mord so schnell entdeckt und ihr zugeschrieben worden war, setzte der Elfe mehr zu als die Tatsache, dass ihr vielleicht nur noch wenige Stunden zu leben blieben. Als sie sich entschieden hatte, zur Meuchlerin zu werden, war sie sich darüber im Klaren gewesen, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis sie ein gewaltsamer Tod ereilte. Sei es, weil sie eines ihrer Opfer unterschätzt hatte, sei es, weil sie einen Fehler machte und entdeckt wurde.
Die Zauberweberin strich über ihre linke Hand. Gestern hatte Hauptmann Lavalle ihr die vier Finger und den Daumen gebrochen, als er sie befragte, wer den Auftrag für den Mord an dem Herzog gegeben hatte. Adelayne war stolz auf sich, dass sie trotz der Schmerzen bei ihrer Geschichte geblieben war und behauptet hatte, es sei ihr eigener Entschluss gewesen, dieses Ungeheuer zu töten. Nach der Befragung hatte sie ihre Hand geheilt. Die gebrochenen Knochen waren wieder unversehrt. Doch der Schmerz war nicht ganz vergangen. Und vor allem nicht die Angst, dass sie es wieder tun könnten oder vielleicht andere, perfidere Methoden der Folter versuchen würden.
Adelayne vertiefte sich, auf der Suche nach innerem Frieden, in die Betrachtung der Flamme ihrer Öllampe. Das warme, gelbe Licht ließ ihren Kerker fast heimelig erscheinen. Die Wände der kleinen Kammer waren aus unbehauenem Naturstein gemauert. Es gab kein Fenster. In der Ecke links von ihr stand ein Holzeimer für die Notdurft, den man immerhin mit einem Deckel verschließen konnte. In der flachen Holzschale vor ihrem Lager trockneten die Reste mit Honig gesüßten Haferbreis. Ihr Lager war schlicht. Zwei Wolldecken auf einer Schütte voll Heu. Die trockenen Halme trugen den Duft des vergangenen Sommers in ihren Kerker.
Sie dachte an den Morgen vor drei Tagen zurück. Als Lavalle erwacht war, hatten sie einander geliebt. Der Hauptmann war überraschend leidenschaftlich und zugleich zärtlich gewesen. Als sie sich aneinander erschöpft hatten, lagen sie eng umschlungen bis fast zum Mittag. Dann waren die Alarmrufe erklungen. Lavalle war sofort auf den Beinen gewesen und, nur mit einem langen Hemd bekleidet, aus dem Zimmer gestürmt.
Er war mit einem Schwert in der Hand zurückgekehrt. Woher er mit unumstößlicher Gewissheit gewusst hatte, dass sie die Mörderin seines Fürsten war, war ihr ein Rätsel. Er hatte sie gepackt und sie nackt über den Hof in die Kerkerzelle gezerrt. Die wenigen Blicke, die ihr auf diesem kurzen Weg begegnet waren, hatten eher mitleidig als erzürnt gewirkt.
Adelayne versuchte sich das Gesicht des Mädchens in Erinnerung zu rufen, das neben Bonnefay gelegen hatte. Die Kleine würde nie wieder dem lüsternen Fürsten zu Willen sein müssen. Und so viele andere waren gerettet. Mit einem Lächeln blickte die Zauberweberin in das warme Licht der Flamme. Sie hatte das Richtige getan! Mit sich selbst im Reinen, begann sie leise ein Kinderlied zu summen, das ihre Mutter oft für sie gesungen hatte.
Schritte erklangen auf dem Gang vor der Zellentür. Die Flamme tanzte in einem plötzlichen Luftzug. Scharrend glitt der Riegel der Kerkertür zurück. Eine Elfe, ganz in Weiß gekleidet, trat ein und musterte Adelayne mit hellbraunen, neugierigen Augen. Sie war klein, von zierlicher Gestalt, und doch hatte sie etwas Unnahbares. Die Weisheit ungezählter Jahrhunderte lag in ihrem Blick. Adelayne war ihr nie zuvor begegnet, doch wusste sie sofort, wer dort vor ihr stand.
»Meine Königin«, sagte sie demütig und überrascht, dass ihre Tat Emerelle zu Ohren gekommen war.
»Du kannst nun entscheiden, ob du dich ohne Wenn und Aber in meinen Dienst stellst oder lieber in dieser Zelle darauf warten möchtest, dass dein Urteil vollstreckt wird.« Es lag eine Härte in der Stimme der Königin, die so gar nicht zu ihrer zarten Erscheinung passen wollte.
»Ich gehöre dir«, antwortete Adelayne, ohne zu zögern, und erhob sich von ihrem Lager. Verlegen zupfte sie an dem schäbigen, grauen Leinenkleid, das Hauptmann Lavalle ihr statt ihrer Gewänder in den Kerker gebracht hatte.
»Folge mir. Die Zeit drängt!« Emerelle wandte sich ab und verließ die enge Zelle.
Adelayne fragte sich, ob dies ein Traum war. Rasch folgte sie der Herrscherin. Im Gang vor dem Kerker lagen zwei Wachen hingestreckt. Sie lächelten, gefangen in tiefem Schlummer.
An der Treppe nach oben saß der weißhaarige Schlüsselbewahrer. Sein Kopf ruhte, auf seine Arme gebettet, auf der Tischplatte. Er schnarchte leise.
Es schien Adelayne, als sei sie in ein Märchen geraten. Als sie die Treppe hinaufstieg, ließ sie die Rechte über den rauen Stein der Wand gleiten. Deutlich spürte sie die unebene Oberfläche unter den Fingerkuppen.
Der Hof des großen Herrenhauses war in klares Licht getaucht. Keine Wolke zeigte sich am Himmel. Ein Stück vor ihnen lag ein großer Ackergaul hingesunken in seinem Geschirr. Er war vor einen hoch beladenen Heuwagen gespannt, auf dem ein Fuhrknecht friedlich schlummerte.
Gänse lagen schlafend neben einer schlammigen Pfütze. Eine Kriegerin in hohen Reitstiefeln hielt drei Pferde an den Zügeln. Sie war die Einzige außer ihnen, die wach war.
Adelayne war aufgewachsen mit den Geschichten über Emerelle, der Gerechten. Niemals wurde sie es müde, Unheil von Albenmark abzuwenden. Unablässig führte sie einen Krieg im Verborgenen gegen jene, die aus Selbstsucht und Machtgier den Frieden der Welt störten. Emerelle war ihr ein Vorbild gewesen, auch wenn sie nicht verstanden hatte, warum so viele Männer wie Herzog Bonnefay mit ihren Untaten davonkamen. Sie selbst hatte es besser machen wollen und hatte dabei so kläglich versagt.
»Warum ich?«, fragte Adelayne beschämt.
Emerelle hielt an. Sie drehte sich zu ihr und wirkte tatsächlich überrascht. »Ich bin deinen Spuren auf den Albenpfaden gefolgt. Ich weiß, was du getan hast, und bekenne, du hast mich beeindruckt. Ich empfand es als ungerecht, dass ein dummer Zufall dein Ende sein sollte. Du hast alles richtig gemacht. Von nun an soll dein Talent im Dienst der rechten Sache stehen.«
»Was für ein Zufall?«
»Du weißt es also nicht …« Die Königin bedachte sie mit einem schmallippigen Lächeln. Dann wandte sie sich zum Haupthaus. »Folge mir!«
Sie querten den Hof. Bei den eingeschlafenen Wachen am Portal des Herrenhauses entdeckte Adelayne Hauptmann Lavalle. Sein Antlitz war eine Grimasse des Schreckens, als habe er noch begriffen, was geschah, bevor ihn der Schlaf übermannte.
In der Eingangshalle nahmen sie die Treppe zur Linken. Ein Zauber war in das Mauerwerk der Halle gewoben. Er gaukelte dem Betrachter den Blick in einen herbstlichen Wald vor und ließ die Wände verschwinden. So schien die Treppe nirgendwohin zu führen, ebenso wie die Türen, die zwischen den Bäumen standen. So vollkommen war das Zauberwerk, dass sich die Blätter an den Ästen in einer leichten Brise zu bewegen schienen und man ihr Rascheln hörte.
Emerelle blieb von dem Zauber unbeeindruckt. Sie stieg die Treppe hinan und trat auf den langen Flur, der zum linken Flügel des großen Hauses führte. Als kenne sie den Ort ganz genau, hielt sie vor der Tür zum Schlafgemach des Herzogs. »Tritt ein, und sieh dir die Schlafstätte an. Das wird dir die Augen öffnen.«
Adelayne folgte den Worten der Königin. Ein Hauch von Parfum hing in der Luft. Das Gemach lag im Halbdunkel. Zwei goldene Lichtbahnen drangen durch die fast geschlossenen Läden vor den großen Fenstern. Staubflocken tanzten im Licht. Ein schwerer Teppich schluckte das Geräusch ihrer Schritte. Das Gewand des Herzogs hing über einer Stuhllehne neben dem großen Bett. Die Laken waren zerknüllt. Man konnte ahnen, wo Bonnefay gelegen hatte, als der Tod ihn endlich fand.
Dann sah Adelayne den Spiegel. Der Augenblick, in dem der Herzog nach dem Rahmen gegriffen hatte, war im Spiegelglas gefroren. Obwohl Bonnefay in seinem Grab lag und das viel zu junge Mädchen hoffentlich bei seiner Familie war, zeigte der Spiegel die beiden noch immer im Bett. Und sie waren nicht allein. Auch sie war in dem Spiegel zu sehen.
Adelayne beugte sich vor, um ihr Bild eingehender zu betrachten. Da lag eine Härte in ihren Zügen, die ihr fremd war. Das braune Haar, die blauen Augen, dieses Gesicht … Hatte der Spiegel es verändert? »Wie hat er das gemacht?«
»Die einzige Grenze, die es für einen begabten Zauberweber gibt, ist seine Vorstellungskraft, Adelayne.« Die Königin berührte sanft ihre Hand. »Komm mit mir, und ich verspreche dir, ich lasse deine Vorstellungskraft bis zum fernsten Horizont fliegen, um das Licht der Gerechtigkeit dorthin zu tragen, wo unsere Welt am dunkelsten ist.«
DIE KUNST, DEN RICHTIGEN ZU FRAGEN
»Der Jüngere wird nicht sehr lange widerstehen«, sagte Birga entschieden. Sie kannte sich aus mit der Folter. »Zwei, drei Stunden vielleicht. Wenn wir ihm alle Zähne herausgerissen und ein paar Finger und Zehen abgeschnitten haben, wird er reden, da bin ich mir ganz sicher. Der Alte ist hart wie Eisenholz. Mit dem können wir uns tagelang mühen und werden nichts erfahren. Aber der Jüngere …« Sie lachte leise. »Es heißt doch, er sei ein großartiger Bogenschütze. Fangen wir also mit den Fingern an.«
Skanga grunzte. Birga war der mürrische Laut nur allzu vertraut. So grunzte sie, wenn Darmwinde sie quälten oder etwas sie verärgert hatte.
»Bei dem Alten stimme ich dir zu, Birga. Der wird nicht einmal reden, wenn wir ihm das Fleisch von den Knochen reißen. Dennoch werden wir Morwallon foltern. Er hat es sich verdient, und Fürst Orgrim wird darauf bestehen.«
Birga verdrehte die Augen. »Welchen Nutzen hat das?«
»Wir schenken dem Herzog die stille Genugtuung, die aus Rache geboren wird. Außerdem werden wir Laurelin von nun an bei allem, was wir seinem Gefährten antun, zusehen lassen. Ich bin mir ganz sicher, er wird sehr schnell anfangen zu reden, um die Leiden Morwallons zu beenden.«
Birga blickte zu den beiden Elfen, die gefesselt neben dem Feuer lagen. »Bist du sicher, dass sie uns nicht verstehen können, Skanga?«
Die blinde Schamanin rieb ihren neuesten Talisman zwischen Daumen und Zeigefinger. Es war der abgeschnittene Mittelfinger Morwallons. »Ich glaube nicht, dass Laurelin uns versteht. Bei Morwallon hingegen bin ich mir fast sicher, dass er unsere Sprache beherrscht. Aber was ändert das schon? Soll er seinem Gefährten nur sagen, was wir vorhaben. Laurelin wird trotzdem anfangen zu reden, wenn wir dem Alten genug zusetzen.«
VON ROMANTIKERN UND DER WELT
Laurelin musste immer wieder auf Morwallons linke Hand starren. Die Trolle hatten den alten Jäger übel zusammengeschlagen. Seine Lippen waren aufgeplatzt, die Augen so zugeschwollen, dass er sie kaum noch öffnen konnte. Aus seinem linken Ohr troff Blut. Aber am meisten entsetzte Laurelin der Anblick der linken Hand. Sie sah aus, als sei jeder einzelne Knochen darin gebrochen. Und der Mittelfinger war abgeschnitten. Und dennoch lächelte Morwallon. »Du bist ein Romantiker.« Das Sprechen fiel dem Jäger schwer. »Deshalb habe ich dich mitgenommen.«
Laurelin glotzte ihn an. »Ich verstehe nicht … Ich dachte, ich begleite dich als Bogenschütze.«
»Ich hab dich ausgewählt, weil du mir, ohne zu zögern, zu Hilfe geeilt wärst, sei ich auch von hundert Trollen umringt.«
»Am Albenstern …« Laurelin senkte beschämt das Haupt. »Ich habe nicht einmal einen Pfeil abgeschossen.«
Morwallon schnaubte. »Sie haben uns überrumpelt. Es waren zu viele, und sie waren zu nah. Gräm dich deshalb nicht. Du magst die Balladen über Farodin und Ollowain, nicht wahr? Und über Emerelle, als sie noch als fahrende Ritterin durch das Land zog. Und über Falrach.«
Laurelin fühlte sich ertappt. All die Wochen, die sie gemeinsam gereist waren, hatte Morwallon ihn nie darauf angesprochen. »Das stimmt …«
»Albenmark ist nicht so wie in diesen Geschichten. Ich habe im letzten Trollkrieg gekämpft. Hier in der Snaiwamark und sogar in der Welt der Menschen. Der Krieg ist nicht so, wie die Dichter ihn schildern. Die Trolle sind keine Ungeheuer …« Er stockte und rang pfeifend um Atem.
Laurelin betrachtete die zerquetschte Hand. Sie war auf fast das Doppelte ihrer eigentlichen Größe geschwollen.
»Ich habe nichts Unrechtes im Krieg getan. Aber es waren nicht alle so. Ich habe zugesehen, wie sie Frauen und Kinder niedergemetzelt haben. Edle Elfenfürsten, die unvergleichlich Laute spielten und im Gespräch Gedanken von solcher Schönheit spinnen konnten, dass die Welt ein besserer Ort war, wenn sie redeten. Ich habe mich ihnen nicht in den Weg gestellt, als sie mordeten. Ja, ich habe nicht einmal meine Stimme erhoben. Ich habe weggesehen und geschwiegen. Ich glaube, du hättest anders gehandelt.«
Morwallon hatte jetzt mehr gesprochen als sonst in einer halben Woche in der Wildnis. Laurelin erkannte in ihm nicht mehr den Mann, für den er den alten Jäger gehalten hatte.
»Die Welt braucht Romantiker wie dich. Männer, denen das Lächeln einer Frau genügt, um sich zu verlieben und bis ans Ende der Welt zu gehen. Männer, die niemals akzeptieren, dass etwas aussichtslos sein könnte. Deshalb wirst du aus dieser Höhle herausgelangen … Mich aber werden meine alten Sünden einholen. Ich werde …«
»Wir gelangen hier zusammen heraus oder gar nicht!«, stellte Laurelin klar.
Morwallon lachte auf. Es war nicht zu übersehen, wie sehr ihn das schmerzte. »Genau das meine ich.«
»Wir werden …«
Sein Gefährte wandte sich von ihm ab. »Still, sie kommen zurück.«
Auch Laurelin hörte nun die schweren Schritte. Und es waren nicht nur die beiden Schamaninnen. Da war noch ein dritter Troll. Er blieb außerhalb des Lichtkreises stehen, den das kleine Feuer in die Dunkelheit der Höhle schnitt.
Es war die unheimliche Gestalt mit der Maske, die sich vor ihnen niederkniete. Sie hielt etwas silbern Glänzendes in der Hand. Es erinnerte an eine Schere, nur dass die Schnittblätter gekrümmt und massiger waren.
»Soll ich nicht doch mit dem Jüngeren beginnen?« Birga blickte zu der blinden Schamanin zurück.
»Nein!«
Die Trolle redeten Elfisch. Laurelin hatte das Gefühl, dass alles genau abgesprochen war, was geschah. Ihre Peiniger wollten, dass sie alles verstanden. Nein, dass er sie verstand. Morwallon beherrschte ja ihre Sprache.
Birga nahm die rechte Hand des alten Jägers. Sie setzte die Schere am Ringfinger an und trennte ihn mit einem metallisch klackenden Schnitt ab.
Morwallon stöhnte auf.
»Das geht nicht!«, empörte sich Laurelin. »Ihr habt ihn ja nicht einmal etwas gefragt. Das ist gegen alle Regeln.«
Bitteres Gelächter erscholl in der Dunkelheit. »Ein Elf, der von Regeln redet. Noch einen Finger, Birga!«
Die Schamanin setzte die gekrümmte Schere an den rechten Daumen. Ein Klacken. Morwallon bäumte sich auf. Er schaffte es, einen Schrei zu unterdrücken, doch das gequälte Keuchen besiegte er nicht.
»Bitte fragt etwas!«, rief Laurelin verzweifelt. »Bitte! Ich werde reden.«
Die Schamanin mit der Maske gab ein mürrisches Grunzen von sich und sah zu der Blinden. Die lächelte.
»Wer hat euch geschickt?«, fragte die Gestalt im Dunkel.
Laurelins Gedanken überschlugen sich. Was sollte das? »Geschickt? Niemand hat uns geschickt!«
»Den anderen Daumen!«, befahl der Troll im Dunkel.
Birga griff nach Morwallons Linker.
»Nein, nicht!«, schrie Laurelin. »Nicht den Daumen. Er wird nie wieder etwas richtig halten können. Erklärt mir bitte die Frage. Ich bin …«
»Den Daumen!«, forderte die Stimme im Dunkel.
Die gekrümmte Schere klackte.
Jetzt wimmerte Morwallon leise.
»Still die Blutung!«, befahl die Stimme ohne Gnade. »Er soll noch länger durchhalten.«
Die Schamanin mit der Maske packte beide Hände und stieß sie in die Glut des Feuers.
Jetzt schrie Morwallon. Er bäumte sich auf, aber das Trollweib war unendlich viel stärker als er. Er war wie ein Kind, das gegen die Kraft eines Erwachsenen ankämpfte.
»Wer war der Dritte im Bunde, Morwallon?«, fragte die Stimme im Dunkel.
Der alte Jäger stieß nur ein Grunzen aus. Die Schamanin drückte seine Hände noch immer in die Glut. Der Geruch von bratendem Fleisch stieg Laurelin in die Nase.
»Bitte, ich habe es gesehen, das niedergedrückte Gras bei dem Eber. Wir beide wissen nicht, wer dort gelegen hat. Was auch geschehen ist, wir haben nichts damit zu tun!«