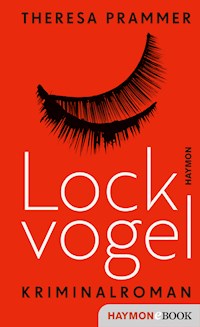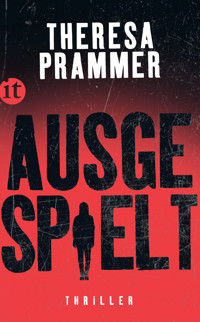13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Carlotta Fiore im Wettlauf gegen die Zeit: Wenn ein Serientäter seine Untaten begeht, zählt jede Sekunde! Wien hält den Atem an … Eine Aneinanderreihung von Mordfällen in Wien versetzt die Großstadt in Schrecken: Mehrere Jugendliche werden getötet, und die Morde erinnern an einen Serienmörder, der vor 30 Jahren seine Taten begangen hat! Mittlerweise ist er aber im Gefängnis verstorben, also kann es sich nur um einen Nachahmungstäter handeln. Vor 30 Jahren hat Ex-Polizeikommissar Konrad Fürst den Täter gestellt, doch jetzt ist er gerade erst aus dem Koma erwacht – ohne Erinnerungen. Dunkle Familiengeschichten Carlotta Fiores Familie war damals in die Mordserie verwickelt, daher sucht die Polizei ein zweites Mal ihre Hilfe. Der zuständige Polizeikommissar setzt auf Konrads Unterstützung, und Lotta soll seinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Auch privat hat Lotta großes Interesse an dem Fall: Von Konrad weiß sie, dass seine Tochter als kleines Mädchen entführt wurde. Jedenfalls muss Konrad so schnell wie möglich seine Erinnerungen wiederfinden, denn nur er kann Lotta helfen, den Täter zu stellen und Licht in ihre Vergangenheit zu bringen. Die lebendigsten Figuren, seit es Kriminalromane gibt Lottas Leben ist ein Auf und Ab: gescheiterte Träume und neue Chancen, Familienzusammenführung, Liebe – oder doch nicht? Die gescheiterte Sängerin ist die erste Figur, der Theresa Prammer in Romanform Leben einhauchte, nachdem sie schon als Mädchen begann, Kurzgeschichten in ein buntes Heft zu schreiben. Als Schauspielerin und Regisseurin ist Prammer Profi darin, sich einzufühlen in andere Leben – und so treten uns die Menschen aus ihren Büchern entgegen wie gute Bekannte, die man viel zu lange nicht gesehen hat und die man auf der Stelle auf eine Melange einladen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Theresa Prammer
Mörderische Wahrheiten
Ein Wien-Krimi
Für Joseph, weil jede Straße zu dir führt
Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Reinhold Niebuhr
Inhalt
Prolog
1
1. Interview, 48 Stunden zuvor
2
3
4
5
6
2. Interview
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3. Interview
22
23
24
25
26
27
4. Interview
28
29
30
31
32
33
34
35
5. Interview
36
37
38
39
40
41
Epilog
Die Autorin
Impressum
PROLOG
Ein Herzschlag trennte ihn vom Aufprall. Er wollte nicht sterben. Nicht so. Ein Schrei schnitt von unten durch die Luft und wurde immer lauter, je schneller er auf den schwarzen Boden zuraste.
Es heißt, das Leben zieht an einem vorbei, wenn man stirbt. Aber an ihm flitzten nur die grellen Lichter der unzähligen Scheinwerfer und die Schemen der Menschen vorüber, die zu ihm auf die Beleuchterbrücke hinaufgesehen hatten. Auch sie stand unten. Er spürte ihren Blick. Sie. Endlich. Fast sein halbes Leben hatte er nach ihr gesucht. Seine Tochter.
Vielleicht war es heute doch nicht zu Ende? Vielleicht gab es so etwas wie Gott oder das Schicksal, das ihn gerade jetzt verschonte? In sein Flehen mischte sich das Aufblitzen eines Hoffnungsschimmers.
Und trotzdem wäre er gleich da, der Schmerz. Unvermeidlich. Sein Körper würde aus sechs Metern Höhe aufprallen.
Er wollte schreien und riss instinktiv den Mund auf. Doch kein Laut kam aus seiner Kehle.
Und plötzlich war alles vorbei. Kein Schmerz, kein Krachen der Knochen, keine Erschütterung. Nichts.
Die Erleichterung weckte ihn auf. Es war nicht echt. Alles nur ein böser, dunkler Traum.
Er versuchte sich zu erinnern, er hatte das schon oft geträumt. Es war immer so real. Der muffige Geruch nach staubiger Kleidung. Die Hitze. Sein trommelndes Herz, als er den Halt verlor. Oder war alles wirklich passiert?
Erinnerungsfetzen stiegen auf, doch es hatte keinen Sinn, sie ließen sich nicht festhalten. Seine Gedanken waren so flüchtig wie Wassertropfen im Feuer.
Er hatte Hunger. Und seine Muskeln taten weh, wie beim schlimmsten Muskelkater. Hatte er kürzlich Sport gemacht?
Er wollte sich aufsetzen, aber irgendetwas fühlte sich falsch an. Sein Körper gehorchte ihm nicht. Seine Arme und Beine lagen bleischwer auf der weichen Unterlage und bewegten sich keinen Millimeter.
Auch seine Augen. Er strengte sich mit ganzer Kraft an, aber er konnte sie nicht öffnen. Als er erkannte, warum, stürzte ihn der Schock zurück in die Dunkelheit.
Sie waren zugeklebt.
1.
„Wohin soll es gehen?“, fragte der Taxifahrer, kaum war ich eingestiegen. Er schaltete den Taxameter an und legte den ersten Gang ein. Weil ich nicht antwortete, drehte er sich zu mir um.
„Junge Dame, wo soll es hingeh… Moment, ist alles in Ordnung mit Ihnen?“ Er kniff die Augen bis auf einen Spalt zusammen, als könnte er mich dadurch besser sehen.
„Ich muss ins Allgemeine Krankenhaus“, sagte ich, die Worte klangen, als hätte ich Kieselsteine im Hals.
„Geht es Ihnen nicht gut?“ Sein Blick wanderte besorgt über die anthrazitfarbene Rückbank, als rechnete er damit, dass ich mich jeden Moment darauf übergeben würde.
„Mit mir ist alles okay.“
„So schauen Sie aber nicht aus.“
Er fixierte mich weiter, der Taxameter erhöhte bereits um 50 Cent, obwohl wir uns noch keinen Meter bewegt hatten. „Nicht, dass Sie mir hier meinen Wagen …“
Normalerweise wäre ich jetzt ausgestiegen und hätte ein neues Taxi gerufen. Doch da ich keine Zeit hatte, holte ich meine Geldbörse aus der Tasche, nahm meine Kreditkarte heraus und reichte sie ihm.
„Für den Fall, dass ich Ihr Taxi anders verlasse, als es momentan aussieht. Und jetzt bitte ins AKH. Schnell.“
Skeptisch betrachtete er die Kreditkarte und murmelte: „Sie heißen Fiore? Wie Maria Fiore?“
„Ja, genau, Maria Fiore. Wenn das was hilft, ich bin die Tochter. Können Sie jetzt bitte losfahren?“
Er drehte sich zu mir, der Ausdruck auf seinem Gesicht war wie ausgewechselt, ein strahlendes Lächeln zog sich von einem Ohr zum anderen. Dann beugte er sich zur Seite, öffnete das Handschuhfach und holte etwas heraus. Es war eine CD.
Die Aufnahme der „Madame Butterfly“ aus der Wiener Oper musste um die 20 Jahre alt sein.
Die mit dickem schwarzen Lidstrich mandelförmig geschminkten Augen von Maria Fiore sahen mir besorgt vom CD-Cover entgegen. Maria Fiore, die weltberühmte Opernsängerin, ein Star, eine Diva. Und die Frau, die bis zu ihrem Tod vorgegeben hatte, meine Mutter zu sein. Doch dieses Geheimnis lag mit ihr in einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof.
Der Taxifahrer gab mir die Kreditkarte zurück und schnippte die CD-Hülle auf.
„Das freut mich jetzt aber, ich sammle nämlich Autogramme“, sagte er, die Sorge um seine Sitze war vergessen. Er zog das Innenblatt heraus und reichte es mir mit einem Kugelschreiber. „Da Ihre Mutter nicht mehr lebt, darf ich Sie um eines bitten, Frau Fiore?“ Er lachte, als wäre das witzig. Energisch nahm ich ihm den Kuli ab, schmierte eine unleserliche Wellenlinie über das Inhaltsverzeichnis und drückte ihm beides wieder in die Hand.
„Ich muss wirklich dringend ins AKH, ich werde erwartet.“
„Sofort.“
Mit einer Hand nestelte der Taxifahrer die CD aus der Halterung. Bevor er sie in den Schlitz des Autoradios schieben konnte, sagte ich: „Ich möchte Radio hören.“
Die Enttäuschung über meine Bitte war am Herabsacken seiner Schultern zu erkennen. Er drückte auf den Einschaltknopf und im nächsten Moment dröhnte aus den Lautsprechern über mir die Stimme einer R&BSängerin, Beyoncé oder Rihanna.
Es war ein strahlend schöner Vormittag, einer dieser Sommertage, an denen die Stadt aussieht, als wäre sie in goldenes Licht getaucht. Das Taxi bog in die Ringstraße ein und reihte sich in die rechte Spur. Ich sah aus dem Seitenfenster, die prächtigen Fassaden der Häuser und Hotels glitzerten in der Sonne. Radfahrer zischten über den Radstreifen am Gehweg, Touristen irrten mit Stadtplänen umher, und in den Schanigärten der Nobelhotels frühstückten Geschäftsmänner in enganliegenden Maßanzügen. Als wäre das ein ganz normaler Tag. Aber das war er nicht. Es war der Tag, nach dem ich mich die letzten 18 Monate gesehnt hatte.
Ich weiß nicht, warum ich so überrascht war, als die Fassade der Wiener Oper plötzlich vor uns auftauchte. Vielleicht, weil ich mit meinen Gedanken ganz woanders war. Vielleicht auch, weil ich alles, was ich vor 18 Monaten hier erlebt hatte, so gut es ging, vergessen wollte. Als der Wagen an der Oper vorbeifuhr, sprang die Ampel an der Kreuzung auf Gelb. Ich setzte an, dem Fahrer zu sagen, er solle Gas geben, aber da hatte er auch schon gehalten. Monumental reckte sich rechts des Taxis eines der weltberühmtesten Opernhäuser empor. Unerschütterlich in seiner ganzen Pracht und anscheinend unberührt von den Ereignissen, die darin stattgefunden hatten.
Hier hatten wir ermittelt. Konrad Fürst, zu dem ich gerade ins Allgemeine Krankenhaus unterwegs war, und ich.
Die Ampel sprang auf Grün, das Taxi fuhr los, und die Fassade der Oper zog schmerzhaft an mir vorbei, wie ein Pflaster auf einer Wunde, das man zu langsam abzieht.
Eineinhalb Jahre hatte Konrad wegen seines „Unfalls“ in der Wiener Oper im Koma gelegen. Eineinhalb Jahre war ich neben seinem Bett gesessen. Hatte versucht, den Blick auf seine Augenlider zu meiden, die ihm zugeklebt worden waren, um ein Austrocknen der Hornhaut zu verhindern. Hatte auf jede noch so winzige Bewegung seines Brustkorbs beim Atmen geachtet. Dem Piepsen der Überwachungsmaschine gelauscht.
Und mich jeden Tag gefragt, ob er jemals wieder aufwachen würde. Heute war es passiert.
„Oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer!“, riss mich die Stimme des Taxifahrers aus meinen Gedanken. Einen absurden Moment dachte ich, er würde über mich sprechen.
„Was?“
Er beugte sich vor und drehte die Lautstärke des Radios höher.
„… den Leichenfund bestätigt. Ich wiederhole, hier ist Andi Knoll. Sie hören Ö3, und wir müssen das Musikprogramm erneut unterbrechen …“ Die sonst so fröhliche Stimme des Radiomoderators klang ernst und tiefer als üblich. „… wie berichtet, wurde in der Prater Hauptallee heute Morgen die Leiche eines Mädchens gefunden. Laut weiteren Informationen handelt es sich um eine 14-jährige Wienerin. Die Polizei geht beim Täter von einem Nachahmer aus. Vorbild für die Tat sollen die vor 30 Jahren stattgefundenen Jugendmorde von Dr. Alfred Riedl sein. Seine Mordserie hatte in den Achtzigerjahren weltweites Aufsehen erregt. Riedl war anerkannter Kinderarzt, Ehemann und Vater von drei leiblichen Kindern und einer Adoptivtochter. Und er war der Mörder von drei Jungen und drei Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren. Sie waren innerhalb eines Jahres aufgefunden worden, erstochen mit 21 Messerstichen. Ich will das gar nicht weiter vorlesen …“
Die Worte zogen an mir vorbei, als würden sie bei einem Ohr hinein- und bei dem anderen gleich wieder hinausgehen. „Können Sie das bitte leiser machen?“, fragte ich, doch der Taxilenker reagierte nicht. Ich versuchte es noch einmal, er reckte seitlich den Kopf und nickte mir freundlich zu. „Ist es laut genug?“
„Zu laut“, sagte ich.
„Ja, gell, super Anlage.“
Wahrscheinlich war er schon schwerhörig. Ich gab auf, verkroch mich im Sitz und schloss die Augen.
„Nach dem sechsten Mord wurde Dr. Alfred Riedl überführt. Darauf entbrannte ein politischer Skandal, niemand konnte sich vorstellen, dass Riedl zu solchen Taten fähig war. So etwas war einfach nicht möglich. Der Polizei wurden Ermittlungsfehler vorgeworfen, bis Riedl selbst alle Zweifel an seiner Schuld zerstreute. Er gestand die Morde, die Jugendlichen hatte er bereits Jahre zuvor … Moment, ich bekomme gerade eine aktuelle Meldung der Polizei herein. Oh nein … die beste Freundin des Opfers wird vermisst. Sie ist …“
Mein Handy in der Tasche vibrierte, sonst hätte ich den Anruf nicht bemerkt. Hannes’ Name stand am Display. Es hatte lange gedauert, bis wir zuerst ein Paar und schließlich eine kleine Familie geworden waren. Ich hob ab, bei ihm war Stimmengewirr zu hören. Der Taxifahrer drehte das Radio nicht leiser, ich musste mir ein Ohr zuhalten, um Hannes zu verstehen.
„Lotta, bist du schon bei Konrad im Krankenhaus?“ Er klang gehetzt, seine Stimme hatte diesen zittrigen Bass, wie immer, wenn er in höchster Anspannung war. Was in seinem Job öfter vorkam, da er als Kommissar in der Mordkommission arbeitete. Aber eigentlich sollte er jetzt zu Hause sein, gemeinsam mit Konny, unserem sechs Monate alten Sohn.
„Nein, was ist los? Ist was mit Konny?“
Seine Antwort wurde durch laut gerufene Anweisungen im Hintergrund überlagert. „Was hast du gesagt, ich verstehe nichts, es ist so laut“, brüllte ich ins Telefon.
Zum Glück dachte der Taxifahrer, ich würde ihn meinen, denn er schaltete das Radio aus.
„Ein Mädchen wurde ermordet, ihre Leiche liegt im Prater. Sie haben mich angerufen …“
„Wo ist Konny?“, fragte ich alarmiert.
„Es ist alles in Ordnung, mach dir keine Sorgen. Anna kümmert sich um ihn.“ Sofort entspannte ich mich. Unsere Nachbarin Anna liebte Konny, sie passte gern auf ihn auf.
„Ich musste herkommen. Das Mädchen wurde erstochen mit … es ist furchtbar. Auf so etwas ist man nie vorbereitet.“
In der Leitung klopfte es, ich nahm das Handy für einen Moment vom Ohr, um den Namen des Anrufers lesen zu können.
SA Krump. SA für Superarsch.
Normalerweise reichte schon die Nennung seines Namens, und Wut flammte in mir auf wie ein angerissenes Streichholz. Hauptkommissar Krump war nicht nur Hannes’ Vorgesetzter bei der Kriminalpolizei, in meinen Augen war dieser kleine verschlagene Mann auch die „Ausgeburt des Bösen“. Er hatte es erfolgreich geschafft, sich auf der Seite der Guten zu verstecken, indem er den richtigen Leuten in den Hintern gekrochen war und noch immer darin steckte.
Ich drückte ihn weg und fragte Hannes: „Wieso ruft Krump mich an?“
„Heinz Krump? Mein Chef?“, fragte Hannes.
„Ja. Warte, es klopft schon wieder.“ Ich sah erneut aufs Display. „Er ist es noch mal.“ Rasch drückte ich den Anruf wieder weg.
„Wahrscheinlich sucht er mich, ich bin gerade erst eingetroffen. Ich ruf ihn an.“
Ich sagte nichts, er wartete kurz, dann sagte er: „Ich liebe dich“, und legte auf.
Er sagte es nicht oft, doch jedes Mal, wenn er es tat, wirbelte es mich durch, als wäre ich im Inneren einer Schneekugel, die gerade geschüttelt wurde. Diese drei Worte fielen Hannes leicht, als wären sie ganz normal, so wie man „Guten Morgen“ oder „Danke“ sagt. Gehört hatte er es in den letzten eineinhalb Jahren von mir nie.
Kaum hatte Hannes aufgelegt, rief Krump wieder an, ich zögerte, doch dann drückte ich ihn zum dritten Mal weg.
Das Taxi kam so abrupt zum Stehen, dass ich mich am Vordersitz abstützen musste.
„Das macht 12 Euro 80“, sagte der Taxifahrer. Ich hatte es nicht bemerkt, aber wir waren da. Rechts vom Auto erhob sich die dunkle Fassade des Allgemeinen Krankenhauses, in dem Konrad lag. Schlagartig krampfte sich alles in mir zusammen.
Ich bezahlte und lief mit Wachsknien durch den Krankenhauseingang, stolperte zwei Mal in der Halle beim Weg zu den Aufzügen.
Im 17. Stock stieg ich aus.
Der Flur war menschenleer. Nur meine Schritte hallten in dieser Totenstille. Bis auf den Geruch nach Desinfektionsmittel wirkte alles so unwirklich wie die Kulisse in einem Film. Ich wischte mir den kalten Schweiß von der Stirn und atmete ein paarmal tief durch.
Mein Herz hämmerte, und das Blut rauschte in meinen Ohren. Ich schluckte Tränen hinunter, bemühte mich zu lächeln, damit ich Konrad durch meine Aufregung nicht erschreckte. Dann öffnete ich die Tür zu seinem Krankenzimmer.
Doch ich konnte weder ihn noch sein Bett sehen, denn jemand versperrte mir die Sicht. Jemand, den ich, obwohl er mit dem Rücken zu mir stand, sofort erkannte. Jemand, der eben drei Mal versucht hatte, mich telefonisch zu erreichen. Hauptkommissar Heinz Krump.
1. Interview, 48 Stunden zuvor
„Also, Emmy, erzähl ein bisschen von dir“, hörte sie eine Stimme aus der Dunkelheit hinter den Scheinwerfern.
Sie klang merkwürdig, ein wenig verzerrt und knatternd, fast wie die Stimme von Onkel Robert, nachdem sein Kehlkopf herausgeschnitten worden war und er durch dieses Loch im Hals hatte reden müssen. Aber im Gegensatz zu ihrem Onkel konnte sie nicht ausmachen, ob es die Stimme von einem Mann oder einer Frau war.
„Wer spricht da?“, fragte sie und schob sich die Haare hinter die Ohren. Ihr Mund war so trocken, dass die Zunge am Gaumen festklebte.
„Jemand, der dich kennenlernen will. Erzähl von dir, Emmy.“
Sie war alleine hier. Niemand wusste, wo sie war. Sie konnte nicht sehen, wer da mit ihr sprach.
Die Angst wanderte durch sie hindurch, aber trotzdem blieb sie stehen, unterdrückte jeden Impuls wegzulaufen. Normalerweise konnte sie ihre Angst ignorieren. In den vergangenen vier Jahren hatte sie gelernt, stillzuhalten und zu gehorchen.
Doch jetzt war Flucht der einzige Gedanke, der in ihrem Kopf Platz fand. Weg. Sie schnappte nach Luft. Tränen machten sich selbstständig und flossen ihre Wangen herunter. Hektisch wischte sie sie ab.
„Emmy, du hast doch keine Angst?“, fragte die widerliche Stimme. War das Einbildung, oder hatte die Frage amüsiert geklungen?
„Ich möchte gehen“, sagte sie. Die Worte holperten aus ihr heraus, als würde sie eine Treppe hinunterstolpern.
„Wirklich?“
„Ja.“
„Du bekommst dann aber keine 200 Euro.“
„Das macht nichts. Ich will bitte gehen. Bitte.“
„Schade. Aber natürlich, wenn du das möchtest. Hinter dir ist die Tür. Mach es gut.“
Dieses Gefühl, als sie die Türklinke herunterdrückte und sich mit aller Kraft dagegenstemmte, bis sie den Gang dahinter im Lichtschein sah, war überwältigend. Nie wieder würde sie so etwas Unüberlegtes tun. Nie, nie wieder!
„Ach, eine Sache noch“, sagte die Stimme, als sie schon mit einem Fuß draußen war, „wenn du oben Diana siehst, schick sie doch bitte gleich herunter.“
Sie wollte schon nicken, als sie plötzlich begriff, was sie da gehört hatte.
„Meinen Sie meine Freundin Diana?“
„Ja.“
„Hat sie auch eine Einladung bekommen?“
„Auf Wiedersehen, Emmy.“ Das Scheinwerferlicht wurde ein wenig runtergedreht, sonst passierte nichts. Keine Antwort auf ihre Frage.
„Auf Wiedersehen.“
Sie zögerte, blieb stehen. Hatte sie überreagiert? Wenn Diana auch gekommen war, dann konnte es doch nicht schlimm sein. Und was das hier auch war, sie wären gemeinsam da. Ein Gefühl von Sicherheit machte sich in ihr breit.
„Ich möchte bleiben, aber können wir auf Diana warten?“, fragte Emmy.
Die Stimme verstummte, und gerade als das Mädchen dachte, sie würde nicht mehr antworten, hieß es: „Gut. Aber während wir auf sie warten, zieh schon mal die Sachen hinter dem Paravent an und lackier dir die Nägel.“
„Was für Sachen?“
Der Scheinwerfer wurde wieder hochgedreht. Erst jetzt bemerkte sie ein paar Meter von der Tür einen dunkelroten Paravent. Aber um zu sehen, was sich dahinter befand, müsste sie weg von der Tür, weg von dem Ausgang. Unschlüssig blieb sie stehen.
„Es ist besser, du gehst, du bist anscheinend noch nicht so weit. Schade, ich dachte, du bist schon erwachsen genug. Diana soll alleine herkommen“, sagte die Stimme. Dann wurde das Licht so weit heruntergedreht, dass der Raum fast ganz im Dunkeln lag.
Was hatte es bloß mit dieser ganzen Sache hier auf sich? Wieso konnte sie nicht einfach auf ihre Freundin warten, anstatt irgendwelche Kleidung anzuziehen? Wenn ihr doch nur einfallen würde, was es gab, das sie beide … Sie stoppte den Gedanken, bevor sie ihn zu Ende gedacht hatte. Die Antwort war soeben aufgetaucht und schob alle Verwirrung und Bedenken beiseite. Es war plötzlich so offensichtlich, dass sie auflachte. Und sie verstand auch den Grund, warum es ihr nicht sofort eingefallen war. Sie hatten es bereits vor drei Monaten getan, darum hatte sie nicht mehr daran gedacht.
Damals hatten Diana und sie sich für die neue Staffel von „Austria’s next Topmodel“ beworben. Sie hatten dafür extra Fotos voneinander gemacht. Und waren beide so enttäuscht gewesen, weil sie keine Einladung zum Casting bekommen hatten. Hinter dem Paravent befand sich sicher die Einheitskleidung, um bei der Auswahl der zukünftigen Models nicht vom Outfit beeinflusst zu werden.
Das hier war ein Test. So etwas wurde in den Topmodel-Shows gemacht, um herauszufinden, wie professionell sich die Models in schwierigen Situationen verhielten. Zum Glück hatte sie nicht zu sehr geheult, wahrscheinlich wurde sie schon die ganze Zeit gefilmt.
Da musste irgendein Prominenter hinter den Scheinwerfern sitzen. Darum war die Stimme verzerrt, damit man nicht erkannte, wer es war. Die Türschnalle glitt ihr aus der Hand und schloss mit einem leisen Schnappgeräusch.
„Ich ziehe die Sachen an, während wir auf Diana warten“, sagte Emmy.
„Okay.“ Das Licht wurde wieder hochgedreht, und sie ging zum Paravent hinüber. Dahinter befand sich ein schwarzer Hocker. Zu ihrer Verwunderung lag darauf nicht eine Jeans und ein weißes T-Shirt, wie bei der Auswahl zur letzten Staffel, sondern ein gelbes T-Shirt und eine kurze graue Hose. Daneben ein Fläschchen mit pinkfarbenem Nagellack. Die Kleidung roch ein bisschen muffig, wie die Wintersachen, die ihre Mutter Ende Oktober aus den Koffern holte. Sie suchte ihre Taschen nach ihrem Handy ab, sie wollte Diana eine SMS schicken, dass sie hier war und ihre Freundin sich beeilen sollte. Diana kam notorisch zu spät, immer. Emmy hatte sich schon daran gewöhnt, aber Diana hatte erzählt, dass sie ihre Lehrer damit in den Wahnsinn trieb und eine Verwarnung bekommen hatte. Sie waren nicht auf derselben Schule, dafür waren Emmys Noten in den letzten Jahren zu schlecht geworden.
Emmy konnte das Handy nicht finden. Mist, sie musste es zu Hause vergessen haben. Also zog sie sich rasch um, setzte sich auf den Hocker und begann, ihre Fingernägel zu bemalen. Ihre Gedanken schweiften ab. Diana und sie würden um die Welt reisen, von einem Job zum nächsten, auf Laufstegen Kleider präsentieren, für Fotos posieren, am roten Teppich gehen. Und sie, Emmy, wäre endlich, endlich weg von ihrem Stiefvater.
Als der letzte Nagel lackiert war, stand sie auf und trat hinter dem Paravent hervor in die Mitte des Raums. Der Scheinwerfer wurde wieder hochgedreht, aber jetzt machte es ihr keine Angst. Im Gegenteil. Diana würde sicher jeden Moment kommen.
„Was würdest du für 100 000 Euro tun, Emmy?“, fragte die Stimme.
„Alles“, schoss es automatisch aus ihrem Mund.
„Alles?“
„Ja, ich würde alles für 100 000 Euro tun. Und Diana sicher auch.“
100 000 Euro, das war der Gewinn für das Model, das in der finalen Liveshow die meisten Anrufe bekam. Wenn sie es in die Show schafften, dann würden sie sich nie wieder so winzig und unbedeutend fühlen. Und dann würde sie sicher nie mehr von ihrer Mutter hören, wie kleinbehirnt und einfältig sie war, oder diese Sachen mit ihrem Stiefvater machen müssen.
Ein Sessel wurde gerückt. Schritte kamen auf sie zu. Wahrscheinlich wollte ihr die prominente Person gratulieren, dass sie es in die Show geschafft hatte. Ach, wieso verspätete sich Diana ausgerechnet jetzt?
Obwohl sie noch nichts erkennen konnte, sprang Emmy, kaum sah sie die ersten Schemen, in die Luft und warf freudig die Arme über ihren Kopf. Das würde man sicher in der Sendung zeigen.
Schon im Sprung erkannte sie, dass sie die Person in weißer Kleidung nicht kannte, die da auf sie zukam. Und das in deren Hand konnte auch kein Papier sein, dafür glänzte es zu stark.
Sie war so irritiert, dass sie nicht mehr auf ihre Körperhaltung achtete und umknickte, als sie wieder am Boden landete. Der stechende Schmerz im linken Knöchel ließ sie rückwärtsstolpern. Sie fiel der Länge nach hin.
Viel zu spät erkannte sie ihren Fehler. „Wieso … haben Sie ein Messer?“, fragte sie.
Sie bekam keine Antwort. „Bitte nicht“, flehte sie.
Das hier musste ein Irrtum sein. Solche Dinge passierten nicht. Nicht ihr. Sie hatte doch alles richtig gemacht.
Das Bild ihrer Mutter tauchte in ihrem Kopf auf. Ob sie die vielen Male bereuen würde, wenn sie „dummes Gör“ zu ihr gesagt hatte? Ob sie um sie weinen würde? Wahrscheinlich saß sie gerade vor dem Fernseher, wie jeden Nachmittag. Sah sich eine Talkshow an, gab heimlich Whiskey in ihre Cola light und telefonierte nebenbei mit ihrer Schwester.
Was würde ihr Stiefvater tun, wenn er sie nicht mehr in der Nacht besuchen kommen konnte? Wenn er sein „kleines Zuckerdöschen“ nicht mehr hatte, das er in die ‚Geheimnisse der körperlichen Liebe‘ einweihen konnte? Wie würde es Diana gehen? Ihrer besten Freundin, die kostbarer war als alles andere und die Einzige, der sie vom „Stiefvater“ erzählen konnte.
Ein letzter Blick in die Vergangenheit holte sie fort. Sie war wieder auf der Wiese. Die Frühlingsblumen wehten im warmen Wind. Sie hatten sich Gänseblümchen zwischen die Zehen gesteckt und Kirschsaft aus Plastikflaschen getrunken. Wie alt war sie da? Zehn? War das ihre glücklichste Erinnerung?
Diana hatte ihr die Hand gereicht, ihre Finger ineinander verschränkt. Und sie hatten gelacht. Über den schwarz-weißen Welpen, der ständig über seine eigenen Pfoten fiel. Dass sie an diesem Abend den neuen Mann an der Seite ihrer Mutter kennenlernen würde, hatte sie nicht gewusst. Der Mann, den ihre Mutter so viel mehr liebte als sie. Der Mann, der kein kleines Mädchen in ihr sah.
Das Messer wurde tief in ihren Brustkorb gestoßen. Sie wurde in einem Raum ermordet, in dem sie nie zuvor gewesen war. Beleuchtet von drei Scheinwerfern. Voller Pläne für eine Zukunft, die nie stattfinden würde.
„Mama“, war das letzte Wort von Emmy Hauser, 14 Jahre alt.
2.
Der Anblick von Hauptkommissar Krump in Konrads Krankenzimmer gehörte in die Kategorie ‚Das muss eine Halluzination sein‘. Doch der weißhaarige Mann, bei dem ich immer an einen Kobold in einem Märchen dachte, löste sich nicht in Luft auf. Und ich war zu fassungslos, um zu reagieren. Der Hauptkommissar hatte mich nicht bemerkt, er war damit beschäftigt, auf Konrad, der im Bett lag, einzureden.
„… Vermisstenmeldung …“, sagte Krump und beugte sich vor, „… gleich eine Pressekonferenz … Opfer, Konrad … die ersten 24 Stunden … damals bei Riedl … 21er-Mörder … jedes Detail erzählen.“ Anscheinend antwortete Konrad nicht, denn Krump kam wieder hoch und trat zur Seite.
„Jetzt red schon. Wieso schaust du mich so an?“, sagte er lauter.
Erst jetzt sah ich Konrad. Er lag halb aufgerichtet im Bett, zwei Kissen steckten hinter seinem Rücken. Obwohl seine Hände auf der weißen Bettdecke ruhten, zitterten sie leicht. Sein Gesicht war zerknittert und blass, als wäre es aus Pergamentpapier, und schwarzviolette Ringe umrandeten seine Augen.
Vorher war mir nicht mehr aufgefallen, wie abgemagert er war. Sein Blick war verwirrt und ängstlich, er sah an Krump vorbei in meine Richtung, ohne Ziel, als würde er durch mich hindurchschauen. Es war ein Schock, ihn so zu sehen. Dieses veränderte, fast schon fremde Gesicht unter den gewellten dunklen Haaren, die mittlerweile mit unzähligen Silberfäden durchzogen waren.
„Geht’s dir nicht gut?“, fragte Krump. „Komm, Konrad, reiß dich nur für einen Moment zusammen!“
„Nein … nein … nein.“
Das war aus Konrads Mund gekommen. Gekrächzt und mit hoher Stimme, wie ein Stück trockener Kreide, das über eine Schultafel kratzt.
Endlich fand ich nicht nur meine Stimme, sondern auch meine Wut auf Krump wieder. Ich machte einen Satz nach vorne, und noch ehe der Hauptkommissar begriff, dass ich da war, hatte ich ihn am Arm gepackt.
„Verdammt, was soll … Fiore …?“, sagte er. Doch ich reagierte nicht, sondern zerrte ihn aus dem Krankenzimmer.
Erst als wir draußen waren, ließ ich ihn wieder los und schloss so leise wie möglich hinter uns die Tür zu Konrads Zimmer. Es kostete mich jeden Funken an Selbstbeherrschung, nicht loszubrüllen.
„Was haben Sie hier zu suchen, Krump?“
Der Hauptkommissar machte eine abfällige Handbewegung, als wäre ich es nicht einmal wert, dass er mir antwortete, und wollte an mir vorbei, zurück in Konrads Zimmer.
„Wagen Sie es ja nicht!“ Mein Arm schoss vor, und mit dem Ellbogen drückte ich ihn zurück.
„Verdammt, Fiore, ich hab jetzt keine Zeit für Ihre Spinnereien.“
Er packte mich. Ich war überrascht, wie kräftig dieser kleine Mann war. Ich entwand mich seinem Griff, er zuckte zurück, als wäre er selbst erschrocken, zu welcher Reaktion er sich hatte hinreißen lassen.
„Pardon“, murmelte er und trat einen Schritt von mir weg.
Ich baute mich mit ausgebreiteten Armen vor der Tür zu Konrads Krankenzimmer auf. „Nur über meine Leiche kommen Sie da noch mal rein.“
Krump rang nach Worten, warum, war mir nicht klar, denn er war sonst auch nie zimperlich mit mir umgegangen. Vor Anstrengung, die ihn die Zurückhaltung augenscheinlich kostete, schnaubte er so sehr, dass seine Nasenflügel bebten.
„Und … wie ist es mit der Leiche … einer 14-Jährigen?“, presste er hervor.
Doch es reichte ein „Das tote Mädchen im Prater? Deshalb wollen Sie zu Konrad? Soll er den Mörder für Sie finden? Wollen Sie mich verarschen?“ von mir, da verflog seine Mäßigung auch schon.
Mit seinen kurzen fleischigen Fingern fuchtelte er mir vor dem Gesicht herum und krähte: „Ich habe eine tote 14-Jährige, die es so nicht geben darf, und ein Mädchen, das verschwunden ist. Und wenn sie nicht bald auftaucht, dann wird sie es sehr wahrscheinlich auch nie wieder tun. Der Einzige, der mir darüber etwas erzählen kann, liegt da drin. Also lassen Sie mich gefälligst wieder zu ihm. Oder soll ich der Presse sagen, es tut mir sehr leid, mir sind bei den Ermittlungen die Hände gebunden, weil eine geschasste Polizeischülerin sich querlegt? Jetzt gehen Sie aus dem Weg, Fiore! Ich hab keine Zeit, ich muss zu Konrad.“
Einen Moment standen wir da, als wäre einer von uns der Stier und der andere der Torero. Außer Krumps Schnaufen war nichts zu hören. Ich bewegte mich keinen Millimeter, starrte ihn nur an, ohne zu blinzeln.
„Was soll gerade er darüber wissen? Er lag 18 Monate im Koma!“
„Es geht um den 21er-Mörder.“
„Den was?“
Krump rang übertrieben nach Luft. „Sie wollten zur Polizei und wissen nichts über einen der spektakulärsten Fälle! Bravo! Dr. Alfred Riedl, der 21er-Mörder, er hat in Wien sechs Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren umgebracht. Vor 30 Jahren. Konrad war damals der ermittelnde Kommissar, als Riedl gefasst wurde. Es war sein Fall. Niemand weiß so viel darüber wie er. Heute Morgen wurde diese Leiche der 14-Jährigen gefunden. Getötet nach haargenau demselben Schema, mit dem Riedl es vor 30 Jahren getan hat. 21 Messerstiche. Und auch der Rest … die Schnellanalyse hat ergeben, dass sich jede Menge DNA von Alfred Riedl auf der Leiche befindet.“
Die Radiomeldung, die ich im Taxi gehört hatte. Hannes’ Anruf.
„Dann war er es eben wieder. Fall gelöst. Auf Wiedersehen, Krump.“
Krump bleckte seine Zähne wie eine Ratte. „Lesen Sie auch mal Zeitung, Fiore? Alfred Riedl ist vor drei Tagen gestorben. Im Gefängnis, in dem er seit seiner Inhaftierung gesessen hat.“
Obwohl ich es nicht wollte, verflog meine Wut auf Krump augenblicklich.
„Ich brauche Konrad. Er hat Riedl studiert, hat ihn aufgespürt, lange bevor irgendwer bei der Polizei wusste, was Profiling überhaupt bedeutet. Wenn wir dieses verschwundene Mädchen nicht so schnell wie möglich finden, dann …“ Er seufzte genervt, lehnte sich gegen die Gangmauer. „Ich wäre nicht gekommen, wenn … ach, Sie wissen schon.“
Ich stellte mich neben ihn und verschränkte die Arme. Hier so bei Krump zu stehen hatte etwas, als wären die Naturgesetze außer Kraft.
„Ich sag es nicht gerne, Fiore. Bei Gott. Aber ich brauche Ihre Hilfe. Sie und Konrad, vor dem Unfall, Sie haben sich sehr nahegestanden, nicht wahr?“
Sofort richtete ich meinen Blick in die entgegengesetzte Richtung, damit Krump mein erschrockenes Gesicht nicht sehen konnte. Der Hauptkommissar war hinterlistig. Vielleicht war das eine Fangfrage, um zu sehen, wie ich reagierte? Bis jetzt hatte ich keine Ahnung, ob er von dem Geheimnis wusste, das ich kurz nach Konrads Unfall vor 18 Monaten erfahren hatte.
Es war die Geschichte eines Mädchens, das im Alter von vier Jahren auf einem Parkfest entführt worden war. Ihr Vater hatte ihr gerade ein Eis gekauft und nicht aufgepasst. Sie war wohl zu der Clownshow, wegen der sie dort waren, vorausgelaufen. Doch sie kam nie dort an. Die berühmte, geachtete und verehrte Operndiva Maria Fiore hatte das Mädchen abgepasst und mitgenommen. Und vor 18 Monaten hatte ich erfahren, dass ich dieses Mädchen war.
Ich hatte keine konkrete Erinnerung an diese Entführung, die vor fast 25 Jahren stattgefunden haben sollte. Es gab nur schemenhafte, blasse Bilder in meinem Kopf, von denen ich nicht wusste, ob sie der Realität entsprachen.
Doch wenn diese Geschichte stimmte, dann war mein richtiger Name nicht Carlotta Fiore.
Sondern Julia Fürst. Die Tochter von Konrad Fürst, der jetzt ein paar Meter von mir entfernt lag, nur getrennt durch die Tür zu seinem Krankenzimmer. Und neben mir stand Hauptkommissar Heinz Krump, der Mann, der dafür verantwortlich war, dass man damals die Suche nach Julia eingestellt hatte.
Obwohl durch Krumps Initiative das Mädchen offiziell für tot erklärt worden war, hatte Konrad die Suche nach seiner Tochter nie aufgegeben. Und durch sein Koma war es bis jetzt ein ungelöstes Rätsel, ob ich wirklich Julia war.
„Warum wollen Sie das wissen?“, fragte ich Krump, ohne ihn anzusehen.
„Weil ich Sie jetzt um etwas bitten muss. Befragen Sie ihn so schnell wie möglich nach den Ermittlungen damals. Ich muss wissen, ob jemals der Verdacht bestand, dass Riedl nicht der Mörder war? Ob er möglicherweise einen Komplizen hatte? Ich sorge dafür, dass Sie alle notwendigen Unterlagen erhalten.“
Sein Handy klingelte, er holte es aus seiner Sakkoinnentasche und zuckte zusammen, als er aufs Display sah. Er meldete sich mit seinem Titel und Namen, hörte kurz zu und sagte: „Einen kurzen Moment bitte, ich bin sofort bei Ihnen.“
Dann hielt er das Mikrofon seines Telefons verdeckt und flüsterte: „Kann ich auf Sie zählen?“
Er wartete meine Antwort nicht ab. „Rufen Sie mich sofort an, wenn Sie etwas wissen.“
Er nahm seinen Finger wieder vom Telefon. „Verzeihen Sie die Verzögerung. Sie können mich jetzt zum Herrn Innenminister durchstellen, vielen Dank“, säuselte er ins Telefon, machte kehrt und lief Richtung Treppe.
Als sowohl der Hall von Krumps Schritten als auch seine Stimme verstummt waren, löste ich mich von der Wand. Wieder setzte ich mein Lächeln auf und öffnete die Tür zu Konrads Krankenzimmer.
Er saß unverändert auf seinem Bett. Sonnenstrahlen fielen durch das Fenster auf seine weiße Bettdecke. Er nickte kaum merklich, sah mich aber nicht an.
Mein Lächeln fiel mir aus dem Gesicht. Ich wollte etwas sagen, war aber unfähig, meine Lippen, geschweige denn sonst irgendetwas zu bewegen. Krumps Worte und alles, worum er mich gebeten hatte, waren wie weggeblasen. Konrad. Er war wach. Ich konnte nur stumm dastehen und ihn anstarren.
Er wandte sich ab, sah aus dem Fenster, dann drehte er so langsam sein Gesicht wieder zu mir, als würde ihm die Bewegung Schmerzen bereiten. Er runzelte die Stirn, etwas in seinem Ausdruck veränderte sich, er streckte den Kopf vor und legte ihn leicht schief.
Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren sah Konrad mir in die Augen. Er öffnete seinen Mund ein paar Millimeter, ich dachte, er wollte etwas sagen. Doch dann zog er einen Mundwinkel hoch zu diesem schiefen Lächeln, mit dem er mich früher oft angelächelt hatte. Ich hatte meine Hoffnung auf dieses Lächeln schon aufgegeben. Mir jedes Mal selbst STOP zugebrüllt, wenn mich die Sehnsucht danach überrollte. Doch jetzt war es da. Konrad Fürst war wirklich wieder da.
Ein Lachen, tief aus meinem Bauch, stolperte an die Oberfläche.
„Ha“, kullerte es aus mir heraus, „haha … hahahaaaaaa.“
Ich lachte und lachte und konnte gar nicht mehr aufhören. Ich stürzte auf ihn zu, fiel ihm um den Hals und presste mein Gesicht an seine Schulter. Tränen mischten sich in mein Lachen, zuerst aus Glück und Freude, doch dann wurden sie immer mehr und mehr. Und irgendwann wusste ich nicht mehr, ob ich lachte oder weinte.
„Wie … wie geht … es dir?“, fragte ich.
Statt einer Antwort begann er zu brummen, zuerst leise und dann immer lauter. Die Laute klangen wie „Krum … Krum“. Als würde er versuchen, Krumps Namen auszusprechen.
„Ja, Krump … war hier. Er braucht deine Hilfe. Ein Mädchen … sie ist …“
Ich konnte vor Schluchzen nicht weitersprechen.
„Sch, sch“, beruhigte mich Konrad, „sch, sch, sch.“
Er umfasste mit seinen Händen meine Oberarme und schob mich ein Stückchen von sich. Sein Griff war so leicht, dass ich ihn fast nicht spürte. Ich wollte ihn wieder umarmen, doch er schüttelte den Kopf, drückte ein bisschen fester zu und schob mich noch weiter von sich weg. Und dann noch weiter. Er schob mich so weit, dass er dabei fast aus dem Bett fiel. Erst dann ließ er meine Oberarme los.
„Brauchst du was?“, fragte ich und wischte mir über das Gesicht. „Soll ich …?“
Er bedeutete mir mit erhobener Hand, nicht weiterzusprechen, mit der anderen Hand tastete er nach dem beigen Hörer, der am Haltegriff über seinem Bett befestigt war.
Ein leises Pfeifen ertönte aus dem Gang, dann waren laufende Schritte zu hören, die Tür wurde aufgerissen, und eine dunkelhäutige Frau in weißer Krankenschwesternuniform stürmte herein. Ich kannte sie, ihr Name war Betty.
„Ist alles in Ordnung, Herr Fürst?“
Erst als Konrad den rechten Zeigefinger ausstreckte und auf mich deutete, bemerkte sie, dass ich auch da war.
„Wer … das?“, krächzte Konrad.
„Was meinst …“, sagte ich. Er unterbrach mich und wiederholte so laut, dass sich sein Körper vor Anstrengung schüttelte: „WER … DAS?“
„Bitte, Herr Fürst, bitte, Sie dürfen sich nicht aufregen.“
Die Krankenschwester ging auf ihn zu, während sie mich anschaute und mit einem Kopfnicken zur Tür wies. Aber ich begriff nicht und blieb stehen.
„Es ist alles in Ordnung, Herr Fürst, bitte, alles in Ordnung, so beruhigen Sie sich doch.“
Konrad rang so panisch nach Luft, dass sein Gesicht purpurrot anlief.
„WER … DIESE FRAU?“
Seine Stimme klang wie zerreißendes Papier.
„JETZT GEHEN SIE ENDLICH“, brüllte mich die Krankenschwester an und betätigte den Notfall-Schalter an der Wand hinter Konrads Bett.
„RAUS! SOFORT!“
Ich hörte sein Röcheln, als ich das Zimmer verließ, untermalt von Bettys beruhigendem Gemurmel, bei dem sie ihm immer wieder beteuerte, dass alles gut war.
Eine Frau und ein Mann in weißen Kitteln rauschten an mir vorbei in sein Zimmer. Die Frau kannte ich ebenfalls. Dr. Kirchschlager, eine Neurologin Anfang 40, die zum Ärzteteam der Station gehörte.
Keine Sekunde später kam der Mann wieder heraus, verschwand kurz in einem angrenzenden Raum, um gleich darauf mit einem silbernen Rollwagen, auf dem sich verpackte Spritzen und Glasflaschen mit durchsichtigen Flüssigkeiten befanden, erneut in das Krankenzimmer zu stürmen. Dann wurde es ruhiger.
Meine Beine wurden so weich, als wären sie aus Wasser. Ich konnte nicht mehr stehen, rutschte hinunter und setzte mich auf den Steinboden. Die Kälte der Fliesen kroch in mich hinein, ich schloss die Augen und versuchte, an nichts zu denken.
Die Tür zu Konrads Zimmer ging wieder auf, dann war eine Frauenstimme zu hören, die flüsterte: „Sie sind so ein depperter Idiot! Ich weiß, dass das Ihr erster Tag auf der Station ist, aber ohne Erlaubnis anzurufen, wissen Sie, was das für Folgen haben kann?“ Darauf eine andere Frauenstimme: „Nicht hier, Frau Doktor. Sie ist noch da.“
Ich sah hoch. Konrads Neurologin hatte mit dem jungen Arzt im weißen Kittel geschimpft, die dunkelhäutige Krankenschwester stand zwischen den beiden wie ein Schiedsrichter.
Er sah erschrocken zu mir herunter. In dem Moment, wo sich unsere Blicke trafen, wusste ich: Grasgrün, gebackener Emmentaler und 29 Jahre. Lieblingsfarbe, letzte Mahlzeit und das Alter. Meine „Eingebungen“ waren seltener geworden – viel seltener, seit ich ihren vermeintlichen Ursprung kannte, aber weggegangen waren sie nicht. Wenn ich einem Menschen, den ich nicht kannte, zum ersten Mal in die Augen sah, tauchten diese drei Dinge in meinem Bewusstsein auf, als hätte ich sie eben auf einem Plakat gelesen.
Der junge Arzt stammelte: „Es tut mir … so leid, ich wusste wirklich nicht …“, doch da unterbrach ihn die Krankenschwester mit den Worten:
„Herr Doktor, bitte, kommen Sie doch mit, ich brauche Ihre Unterschrift“, hakte ihn unter und ließ mich alleine mit Konrads Ärztin.
„Was war das eben? Was heißt, er könnte jetzt tot sein?“
„Frau Fiore …“
„NEIN!“ Es war schärfer herausgekommen, als ich beabsichtigt hatte.
„Was ist los?“
Dr. Kirchschlager senkte den Blick.
„Warten Sie bitte, ich rufe lieber den Herrn Primar an.“ So schnell ich konnte, stand ich auf.
„Ich will mit keinem Primar sprechen. Sagen Sie es mir. Bitte.“ Sie musterte mich, und nach einem kurzen Zögern nickte sie.
„Gut, ja, aber nicht hier. Kommen Sie mit.“
Ich folgte ihr den Krankenhausgang entlang bis in einen Besprechungsraum, in dem nichts weiter stand als ein riesiger metallener Aktenschrank, davor ein weißer Schreibtisch und zwei Plastikstühle.
Sie öffnete die oberste Schublade des Aktenschranks und nahm eine Krankenakte heraus. Dann hob sie den Stuhl, der hinter dem Schreibtisch stand, und stellte ihn neben den für Besucher. Es war eine nette Geste, dass wir nebeneinandersaßen. Zu nett und darum beunruhigend. Sie legte sich die Akte auf den Schoß und verschränkte ihre schmalen Finger ineinander.
„Okay. Sie haben sicher viele Fragen, aber zuerst möchte ich Ihnen sagen, dass es Herrn Fürst den Umständen entsprechend nicht schlecht geht. Dass er nach der langen Zeit in diesem Zustand aufgewacht ist, gleicht einem Wunder.“
Sie öffnete die Akte und warf einen Blick hinein. Ihre brünetten Haare fielen ihr ins Gesicht, sie strich sie schwungvoll mit großer Geste zurück, als wären wir an der Riviera und nicht in einem Spital.
„Soweit man das bis jetzt beurteilen kann, hat die Motorik kaum Schaden genommen. Das Gehen wird ihm die nächsten paar Monate noch schwerfallen, aber das ist normal und bei allen ehemaligen Komapatienten so. Sie wissen doch, dass er tägliche Strombehandlungen gegen den Muskelabbau bekommen hat?“
„Ja, weiß ich. Aber was haben Sie vorhin gemeint mit den Folgen?“
„Das Problem ist sein Gehirn. Der Zeitraum zwischen Eintritt des klinischen Todes und der Wiederbelebung war bei Herrn Fürst relativ lang.“
„Ja, ich war dabei.“
„Bei Patienten wie ihm besteht die Gefahr eines Schocks. In den ersten 24 Stunden ist allergrößte Vorsicht geboten. Im schlimmsten Fall kann ein Hirnschlag oder Herzstillstand ausgelös–“
„Was meinen Sie damit, ‚Patienten wie ihm‘?“
Ein blitzartiges Zittern wanderte durch mein Gesicht, meine Lippen wurden taub.
Wieder die Riviera-Haargeste, dazu die einstudierte Senkung der Tonlage. Wurden Ärzte in so etwas geschult?
„Ich meine damit Patienten, die an Amnesie leiden“, sagte sie und setzte ein mitleidiges Augenzwinkern ein. „Konrad Fürst hat keine Erinnerung. Er weiß gar nichts. Wir machen noch einige Untersuchungen, aber aus Erfahrung muss ich Ihnen sagen, es ist nach dieser langen Zeit im Koma mehr als unwahrscheinlich, dass ihm jemals wieder irgendetwas einfallen wird.“
3.
„Ich nehme ihn mit nach Hause.“
Das waren meine ersten Worte, als ich wieder klar denken konnte. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Minuten vergangen waren. Vielleicht eine, vielleicht zehn – ich hatte das Zeitgefühl verloren. Dr. Kirchschlager nickte mir zu.
„Ja, das ist gut. Es ist das Beste für Amnesiepatienten, wieder in ihre alte Umgebung zu kommen. Das wird so in drei Monaten der Fall sein, nach der Reha.“
„Nein.“ Ich stand so rasch auf, dass der Sessel nach hinten umkippte.
„Ich nehme ihn jetzt mit nach Hause. So früh es geht. Er wird auf keine Reha geschickt. Wenn es sein muss, kommt jemand, der sich um ihn kümmert. Er wird nirgendwohin geschickt.“
Sie seufzte und sah auf die Uhr. Wahrscheinlich hatte ich schon zu viel ihrer Zeit in Anspruch genommen. Dann nickte sie halbherzig. „Okay.“ Sie sah in die Akte, blätterte vor und zurück, runzelte kurz die Stirn. „Wieso steht hier nicht, dass Sie seine Tochter sind?“
Innerliche Vollbremsung – das konnte sie nicht wissen. Außer mir gab es nur fünf Menschen, die davon wussten. Bei der Krankenhausverwaltung hatte ich angegeben, dass ich seine Kollegin war und mich um ihn kümmerte, da er keine Angehörigen hatte.
„Wieso sagen Sie das?“
„Moment, jetzt bin ich verwirrt … Herr Fürst ist doch Ihr Vater?“
„Wie kommen Sie darauf?“
„Na ja … ich glaube, ja, es war vor ein paar Monaten, ich bin in sein Zimmer gegangen, Sie haben mit ihm gesprochen und … also, ich bilde mir ein, Sie haben ihn Papa genannt. Darum dachte ich … aber das war anscheinend ein Irrtum, entschuldigen Sie. Sind Sie denn mit ihm verwandt?“
Weil ich nicht wusste, was ich sonst antworten sollte, sagte ich: „Nicht wirklich.“
„Aha, okay. Na, in diesem Fall gibt es für Sie keine Möglichkeit, ihn aufzunehmen.“
Sie stand auf, nahm einen Zettel aus der Mappe, legte ihn auf den Tisch und holte einen Kugelschreiber aus der Brusttasche ihres Kittels.
„Gut, dann wird Herrn Fürst ein Sachwalter zur Verfügung gestellt. Und auf Reha fährt er auf jeden Fall.“
„Was wäre, wenn ich mit ihm verwandt bin?“, unterbrach ich sie.
Sie schrieb und sagte nebenbei: „Es tut mir leid, es wird nicht klappen, Ihnen ein Verwandtschaftsverhältnis anzudichten. Diese Fälle werden sehr genau überprüft, und eine Reha ist bei Gott nix Schlimmes. Dort wird er gut …“
„Sie sind an die ärztliche Schweigepflicht gebunden?“, unterbrach ich sie.
„Ja, wenn es um einen Patienten geht, dann …“
„Gut, hiermit bin ich ab sofort Ihre Patientin.“
Sie kam hoch, sah mich einen Augenblick verwundert an, und obwohl ihr die Haare wieder ins Gesicht hingen, vergaß sie auf ihre Riviera-Geste. Sie setzte sich und schlug die Beine übereinander. „Ich bin gespannt.“
Ich nahm neben ihr Platz. „Schwören Sie es mir“, forderte ich sie auf und streckte ihr meine Hand entgegen.
„Frau Fiore, ich verstehe nicht …“
„Bitte geben Sie mir Ihre Hand. Das, was ich Ihnen erzählen werde, wird diesen Raum nie verlassen.“
„Okay, natürlich, wenn Ihnen das wichtig ist.“ Wir schüttelten einander die Hände, es wirkte lächerlich, wie der Schwur zweier Kinder. Ich bemühte mich, mit fester und ruhiger Stimme zu sprechen, um ihr keinen Augenblick meinen Zweifel an der Geschichte zu verraten.
„Mein richtiger Name ist nicht Carlotta Fiore. Ich heiße Julia Fürst. Ich bin seine Tochter.“
„Also doch. Sie sind die Tochter von Maria Fiore und Konrad Fürst?“
„Nein, das bin ich nicht. Die beiden haben einander nicht gekannt.“
„Wie meinen Sie das …“
„Als ich vier Jahre alt war, wurde ich entführt. Ich wollte mit meinem Vater die Zaubershow eines Clowns ansehen, bei einem Fest im Stadtpark. Dort hat mich Maria Fiore mitgenommen.“ Die Worte auszusprechen war so schmerzhaft wie ein Tritt in die Magengrube.
Mit „Moment, ich komme da nicht mit“ holte die Ärztin meine Aufmerksamkeit wieder in dieses Zimmer. „Von welcher Maria Fiore reden Sie? Ich dachte, Ihre Mutter war die Opernsängerin …“
„Ja, wir sprechen von haargenau derselben Maria Fiore. Die größte Operndiva, die vor ein paar Jahren gestorben ist und noch immer von der ganzen Welt verehrt wird … nur ist sie nicht meine Mutter. Sie war es auch nie.“
‚Das weißt du nicht‘, flüsterte die Stimme in meinem Kopf, wie so oft, seit diesem Nachmittag vor eineinhalb Jahren.
„Was bedeutet ‚mitgenommen‘?“
„Es bedeutet, dass sie mich entführt hat.“ Ich fixierte sie, so gut ich konnte, um meinen Worten das nötige Gewicht zu geben. „Maria Fiore hatte eine leibliche Tochter, doch die war ihr zu verrückt. Darum hat sie die echte kleine Carlotta Fiore unter anderem Namen in ein teures Privatheim gesteckt, in dem man keine Fragen stellt, und mich an deren Stelle aufgezogen.“
„Frau Fiore, ich weiß nicht …“
„Es ist egal, ob Sie mir glauben oder nicht. Ich erzähle Ihnen das alles nur, weil es um die Gesundheit meines Vaters geht. Er hat mich 23 Jahre lang gesucht. Ich habe erst erfahren, dass ich seine Tochter bin, als er schon im Koma lag.“
„Aha. Und was haben Sie für Beweise?“
„Beweise?“
„Ja, Dokumente, irgendwas.“
Es war ein Gefühl, als hätte sie mich über die Klippe gestoßen, an der ich seit eineinhalb Jahren stand. Ich hatte keine Beweise. Nichts.
Ich wusste nicht, ob meine plötzlichen „Erinnerungen“ an die Entführung wirklich die Wahrheit oder Einbildungen waren, geboren aus den Erlebnissen einer unzweifelhaft verkorksten Kindheit. False Memories. Vielleicht war ich einfach nur verrückt?
Es gab keinen Zweifel, dass Konrads Tochter Julia beim Parkfest verschwunden war. Auch nicht, dass Henriette, aus welchen Gründen auch immer, von Maria Fiore in ein Privatheim abgeschoben worden und ich alleine bei ihr aufgewachsen war. Doch neben all diesen Geheimnissen gab es einen unbekannten Faktor: meine Identität.
„Es gibt keine Dokumente darüber“, sagte ich.
„Verstehe. Lassen Sie mich kurz nachdenken.“ Sie strich sich über die Oberlippe und fixierte einen Punkt am Boden. Dann legte sie den Kopf schief und sah mich an. „Okay, machen wir einen DNA-Abgleich. Eine Speichelprobe reicht.“
Die Panik, die dieser Vorschlag bei mir auslöste, überraschte mich nicht. Über diese Möglichkeit hatte ich schon die ganze Zeit nachgedacht. Was wäre einfacher, um Gewissheit zu haben? Doch es war eine Gewissheit, vor der ich mit Feigheit rebellierte. Ich stieß ein so scharfes „Wozu?“ hervor – wäre es ein Pfeil, hätte es sie getötet. „Entschuldigung, ich wollte nicht …“, versuchte ich zu beschwichtigen. „Es ist nur, ich kann keinen DNA-Abgleich machen.“
„Und warum nicht?“
„Es ist kompliziert. Zu viele Menschen hängen mit drin, es geht nicht.“ Das war allerdings nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte war gefüllt mit der Angst vor dem Ergebnis und all seinen Konsequenzen.
„Tut mir leid, dann kann ich nichts für Sie tun, Frau Fiore.“
„Gibt es nicht irgendeine andere Lösung? Bitte!“
Sie hob die Schultern und sagte gelangweilt: „Sie können mit dem Herrn Primar sprechen. Vielleicht kann er Ihnen weiterhelfen. Er ist im Haus, soll ich ihn fragen, ob er kurz Zeit hat?“
„Ja, danke.“
Sie stand auf und ließ mich allein. Je länger sie weg war, desto mehr verglühte mich brennende Reue. Ich hatte mein Geheimnis einer Fremden preisgegeben. Ich wusste nicht, was schlimmer war – dass sie nun zu dem kleinen Kreis gehörte, der davon wusste, oder dass meine Erklärung ohne Ergebnis geblieben war. Wieso hatte ich ihr nicht einfach gesagt, ich wäre eine uneheliche Tochter von Maria Fiore und Konrad Fürst? Vielleicht hätte das genügt? Der Name Fiore hatte schon oft Türen geöffnet und Unmögliches möglich gemacht. Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt, ich versuchte, ruhig zu atmen, aber es gelang mir nicht. Jetzt würde es auch noch irgendein Primar erfahren, nein, ich musste sie aufhalten, mir irgendwas einfallen lassen. Gerade als ich aufstand, wurde die Tür geöffnet. Die brünette Neurologin steckte den Kopf herein.
„Primar Hutbauser kommt in einer Minute.“
„Was haben Sie ihm erzählt?“
„Dass Sie wegen Konrad Fürst mit ihm reden wollen.“
Noch ehe ich genauer nachfragen konnte, tauchte hinter ihr jemand auf.
„Oh, da sind Sie ja schon, Herr Primar“, sagte Frau Dr. Kirchschlager mit einem koketten Lächeln, ihre Stimme war eine Oktave höher gerutscht. Sie trat zur Seite und ein großer, schlanker Mann mit rundem Gesicht und einem Grübchen im Kinn betrat das Zimmer. Für einen Chefarzt war er jung, ich schätzte ihn allerhöchstens auf Mitte 40. Über seiner schwarzen Jeans und dem hellblauen Hemd trug er wie die Ärztin einen weißen Kittel. Als er mich sah, stockte er kurz, dann streckte er mir erfreut die Hand entgegen.
„Frau Fiore, hallo. Mein Name ist Peter Hutbauser.“
Mein Kopf blieb leer, als ich ihm in die ockerfarbenen Augen blickte, seine Hand fühlte sich ein bisschen feucht an. Er wandte sich wieder zur Neurologin: „Ach, Frau Dr. Kirchschlager, ich war vorhin beim Patienten auf 1714, können Sie bei ihm reinschauen, bitte?“
„Sehr gerne, Herr Doktor.“
Sie warf ihm einen weiteren koketten Blick zu, dann schloss sie die Tür von außen.
„Komisch, dass ich Sie noch nie hier gesehen habe. Ich kenne Sie natürlich aus den Medien“, sagte der Primar und deutete auf die zwei Stühle. „Wollen wir uns nicht setzen?“
Wir nahmen nebeneinander Platz. „Meine Kollegin hat mir erzählt, Sie wollen etwas wegen Ihres Bekannten Konrad Fürst besprechen.“
„Mein Bekannter, richtig“, sagte ich erleichtert.
Ein breites Lächeln entblößte die makellosen Zähne von Primar Hutbauser. „Verzeihen Sie mir, wenn ich das noch rasch erwähne, aber Ihre Mutter war eine so unglaublich großartige Künstlerin. Diese Stimme! Leider habe ich sie nur ein Mal auf der Bühne erlebt. Aber meine Mutter hat ihre Platten rauf- und runtergespielt. Ich bin quasi mit der Stimme Ihrer Mutter groß geworden.“ Er lachte auf, und ich fühlte mich verpflichtet mitzulachen.
„Sie singen auch, nicht wahr?“, fragte er. „Ich habe darüber gelesen – es ist aber schon einige Jahre her. Leider habe ich Sie nie auf der Bühne …“
„Das war in einem anderen Leben“, winkte ich ab.
„Ach, wirklich? Wieso haben Sie aufgehört?“
„Es war nicht das Richtige“, wich ich aus. Weil er mich erwartungsvoll ansah, ergänzte ich: „Ich bin jetzt Hausdetektivin. In einem Möbelhaus.“ Konny hatte ich absichtlich nicht erwähnt. Ich hatte Bedenken, es könnte ihn beeinflussen („Nein, Sie können nicht für ein Baby und einen Exkomapatienten gleichzeitig sorgen“).
„Auch nicht unspannend“, sagte er freundlich.
Anscheinend war die Small-Talk-Runde damit beendet. „Also, was darf ich für Sie tun, Frau Fiore?“ Er hob die Augenbrauen, und gerade als ich mich vorbeugte und zu sprechen anfing, zuckten seine Augen zu meinem Busen und blieben drei Sekunden dort hängen. Ihm war es auch aufgefallen, er fasste sich im nächsten Moment hektisch an die Nase und kratzte sich. Und da wusste ich es.
Dieser kleine „Ausrutscher“ hatte mir soeben einen Weg eröffnet, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Vor mir saß Konrads Entlassungsschein. Ich musste ihn nur noch aktivieren.
Mit herausforderndem Flirten ist es wie mit dem Fahrradfahren: einmal begriffen, nie mehr verlernt. Ich verdrängte die Bedenken wegen Hannes, ich hatte nicht im Mindesten die Absicht, ihn zu betrügen. Ich redete mir ein, dass das hier einfach ein Spiel war, bei dem ich mich sehr gut auskannte. Mit dem Ziel, Konrad so schnell wie möglich hier rauszubekommen.
„Es ist sehr nett, dass Sie sich Zeit für mich nehmen“, sagte ich mit einer Stimme, so süß und dunkel wie flüssiges Karamell. Die Art, wie der Primar mich ansah, war mir vertraut. Mir war nicht klar, ob er mich wirklich attraktiv fand oder ob es etwas mit der Tatsache zu tun hatte, dass er mich für Maria Fiores Tochter hielt. Auch das hatte ich oft erlebt.
„Das ist doch selbstverständlich.“
Ich verschränkte meine Arme, sodass sie wie ein Push-up-BH wirkten.
„Das finde ich nicht.“
Es war plump, dass ich dabei scheinbar unabsichtlich an meinem Busen entlangstreifte, aber ich hatte keine Zeit zu verlieren. Er folgte meinem Daumen wie ein Hund einem Knochen.
„Sie haben sicher viel zu tun.“
„Ähm … nein, das ist schon in Ordnung. Ich nehme mir gerne für Sie Zeit.“
„Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr mich das freut.“
Er wurde ein wenig nervös, räusperte sich. Wenn ich jetzt keinen Fehler machte, dann hatte ich in spätestens fünf Minuten das, was ich wollte. Und je weniger sein Verstand ihm dabei im Weg stand, umso besser.
Konrads Gesicht schob sich in meinem Kopf vor mein schlechtes Gewissen. Es war nicht das abgemagerte, eingefallene Gesicht von vor zehn Minuten. Es war das Bild seines blutüberströmten Gesichts vor eineinhalb Jahren, als er auf der Bühne der Wiener Oper im Sterben gelegen hatte.
„Herr Fürst also, ja, was ist mit ihm?“, fragte der Arzt nach, da ich nicht weitersprach.
Ich schenkte Primar Hutbauser ein kleines dreckiges Grinsen, im vollen Bewusstsein, dass ich nun eine Grenze überschreiten würde. Es war meine einzige Chance, ohne etwas erklären zu müssen, ohne die Ungewissheit, ob es die Wahrheit war, ohne Konsequenzen eines DNA-Tests, ohne Ausflüchte oder Rechtfertigungen. Und ohne Beweise.
Statt einer Antwort senkte ich meinen Blick ganz bewusst zwischen seine Beine, verweilte ein paar Sekunden bei den Knöpfen seiner Jeans und sah dann wieder hoch in seine Augen. Anders als er versuchte ich nicht zu überspielen, was ich getan hatte. Meine Aktion verfehlte nicht ihre Wirkung, er starrte mich an, und auf seinen Wangen traten rote Äderchen hervor.
„Wollen Sie mich …“, ich öffnete leicht den Mund, bevor ich das letzte Wort aussprach, „… unterstützen?“
Obwohl ich wusste, dass es nie dazu kommen würde, hatte ich die Frage so gestellt, als hätte ich damit etwas anderes gemeint. Etwas ganz anderes. Um meine vorgetäuschte Absicht zu verdeutlichen, rutschte ich mit meinem Becken vor an die Stuhlkante. Auch wenn ihn mein Verhalten anscheinend überraschte, schien es ihm zu gefallen. Ein Grinsen zog sich über sein Gesicht, er beugte sich vor, seine Pupillen hatten sich so geweitet, dass die ockerfarbene Iris fast nicht mehr zu sehen war. „Wobei?“
„Konrad Fürst hier rauszubekommen. In meine Obhut, ohne Reha.“
„Und aus welchem Grund?“
„Wie ist es damit?“, fragte ich und öffnete mit einer Hand einen Knopf meiner ohnehin schon dekolletierten Bluse. Sein Blick veränderte sich, und ich öffnete noch einen Blusenknopf.
„Keine Reha für Herrn Fürst?“, fragte er und lehnte sich zurück. Während ich den Kopf schüttelte, öffnete ich den dritten Knopf. Die Beule, die sich in seiner Hose abzeichnete, war für mich wie der nahende Zieleinlauf für einen Marathonläufer.
„Keine Reha“, sagte ich leise, „du stellst ihn frei, und ich nehme ihn so schnell wie möglich mit.“
„Das ist sehr viel, was du da verlangst.“
„Dann sagen wir, es ist ein Gefallen, für den ich mich revanchieren werde“, log ich.
Eine kleine Schweißperle bildete sich auf seiner Oberlippe, und gerade als ich dachte, ich wäre am Ziel, öffnete er die Beine, griff mit beiden Händen nach meinem Stuhl und zog ihn langsam zu sich heran. Gekonnt fasste er unter meine Knie und richtete mich so, dass ich mich jetzt zwischen seinen Beinen befand. Mit den Händen strich er meine Oberschenkel entlang und wanderte auf meine Hüften.
„Okay. Da werde ich wohl seine Entlassungspapiere unterschreiben müssen.“
„Und wir werden uns in einem Hotel treffen“, flüsterte ich und tat so, als läge das Zittern in meiner Stimme an meiner Erregung. Der Plan, den ich mir zurechtgelegt hatte, beinhaltete eine Verabredung, die ich nicht einhalten würde.
Er hob seine Hände zu meinem Busen, fuhr über die Spitze meines BHs, sein Atem ging schwerer. „Wir tun es hier. Jetzt.“
Seine Zurückhaltung war verflogen, sein rechter Zeigefinger glitt wie selbstverständlich unter meinen BH, bis er meine Brustwarze erreichte, gleichzeitig öffnete er mit der linken Hand hastig die Knöpfe seiner Jeans. Und ich begriff, dass diese Situation für ihn nicht ungewöhnlich war. Ganz im Gegenteil.
Mit beiden Händen packte ich seinen Unterarm und versuchte, seine Hand wegzuschieben. Er lachte auf, entwand sich meinem Griff und drückte seine Lippen auf meine.
Ich weiß nicht, was dann passiert wäre – hätte nicht jemand die Tür geöffnet. Es war zwar angeklopft worden, aber nur ein Mal und so schnell, dass keine Zeit geblieben war, unsere Position zu ändern. Wir mussten ein groteskes Bild für Dr. Kirchschlager abgeben.
Sie schnappte nach Luft. „Peter?“
Sowohl ihre hohe Stimme als auch der panische Blick verrieten sofort, dass Hutbauser und sie mehr als Kollegen waren. Doch im nächsten Moment war ich es, die panisch dreinsah. Denn hinter Konrads Neurologin stand Hannes.
4.
Frau Dr. Kirchschlager machte am Absatz kehrt und rannte weg. Hutbauser saß da, völlig perplex, seine Hose immer noch geöffnet und die Hand ausgestreckt, um mir wieder an den Busen zu fassen.
Als Hannes auf ihn zuschoss, sprang er vom Stuhl auf. Hannes zückte seinen Dienstausweis, er sah aus, als wäre in ihm ein Vulkan, der jeden Moment auszubrechen drohte. Er streckte die kleine Plastikkarte mit vor Wut zitternder Hand dem Primar entgegen. Dann sah er zu mir hinunter und brüllte: „Was hat er getan?“
„Ich habe nichts getan“, sagte der Arzt. Er wandte sich hektisch ab und knöpfte seine Hose zu. „Frau Fiore, Sie können Herrn Fürst in zwei Wochen abholen. Auf Wiedersehen.“ Und damit stürmte er aus dem Besprechungsraum.
Langsam ließ Hannes seinen Dienstausweis sinken. Er schluckte, sah mich an, als könne er nicht begreifen, wovon er eben Zeuge war. „Was … was machst du da?“
Den Vater deines Kindes von deiner Unschuld überzeugen zu wollen, während du den Busen wieder in den BH packst und die Bluse zuknöpfst, ist nicht ganz leicht. Darum versuchte ich es auch gar nicht erst. Sein Handy läutete, aber er ignorierte es.
„Konrad hat Amnesie. Er erinnert sich an nichts. Ich möchte, dass er nach Hause kommt.“
„Und dafür vögelst du mit einem Arzt?“ Er sah zur Tür, als könnte er es noch immer nicht glauben.
„Nein. Ich habe nicht. Und ich hätte auch nicht. Es … war schwierig.“
„Bist du verrückt?“
„Es war meine einzige Chance.“
Sein Handy erstarb, aber nur, um im nächsten Moment wieder loszugehen. Er nahm ab und brüllte „Was ist los?“ ins Telefon. Er hörte zu und ließ mich dabei nicht aus den Augen. „Es tut mir leid, ich wollte dich nicht … ja, ist gut. Ich komme wieder … er soll in zwei Minuten hier sein. Vor dem Haupteingang. Nein, du brauchst nicht zu warten … Ja, ich komme danach auch zu Krump.“
Er legte auf, drehte sich um, ohne mich anzusehen, und ging mit raschen Schritten hinaus.
„Hannes, warte“, rief ich, er wurde schneller. Bei den Aufzügen holte ich ihn ein.
„Es ist nicht, wie du denkst“, sagte ich. Er reagierte nicht, starrte stur geradeaus. Mit einem „Pling“ kam der Lift an, im Inneren der Kabine war eine Familie mit Zwillingen im Kinderwagen. Weil ich ihn so nicht gehen lassen wollte, stieg ich ebenfalls ein.
„Hannes, bitte, hör mir zu“, sagte ich, als wir ausgestiegen waren, und lief ihm durch die Halle nach. Er blieb abrupt stehen, sein Gesicht rot und angespannt, als würde er jeden Moment explodieren.
„Ich kann dir nicht zuhören. Ich muss zum Fundort einer ermordeten 14-Jährigen. Den ich verlassen habe, um dich nicht allein zu lassen.“
Der Grund, weswegen Krump bei Konrad gewesen war. Der 21er-Mörder.
„Hannes, hier“, rief jemand. Es war ein uniformierter Polizist, er war riesig, sicher zwei Meter, und stand ein paar Meter entfernt in der automatischen Eingangstür.
„Bitte, Hannes, lass es mich erklären.“
Er sah mich nur voller Verachtung an, drehte sich um und folgte seinem Kollegen zum Einsatzwagen, der in zweiter Spur vor dem Krankenhaus stand. Er stieg auf der Beifahrerseite ein. Weil ich nicht wusste, was ich tun sollte, öffnete ich die hintere Autotür und setzte mich einfach auf den Rücksitz.
„Was soll …?“, fragte der Polizist, der die langen Beine unter das Lenkrad fädelte.
„Lotta, steig aus“, zischte Hannes.
„Das werde ich nicht.“
„Wer ist das?“, fragte Hannes’ Kollege und drehte umständlich den Kopf, der die Autodecke berührte, zu mir. „Moment, sind Sie nicht die Tochter dieser berühmten Opernsängerin … wie hieß die noch mal?“
„Ach Gott, Franz, fahr einfach. Ich hab keine Zeit“, sagte Hannes. Franz startete den Motor, er musste immer den Kopf einziehen, um seinen Hintern ein bisschen zu heben, wenn er einen anderen Gang einlegte, da sein rechtes Knie im Weg war. Ich versuchte, über den Rückspiegel Blickkontakt mit Hannes herzustellen, aber er sah nicht einmal hinein. Als ich meine Hand auf seine linke Schulter legte, beugte er sich zur anderen Seite.