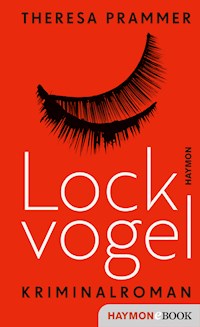13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Gefährlich ist, wo Carlotta Fiore ist: Mordfälle in der Wiener Oper und eine Undercover-Ermittlerin, die eigentlich gerne Opernsängerin geworden wäre. Von der Sängerin zur Kaufhausdetektivin Lotta, gescheiterte Sängerin, ist mit ihrer Arbeit als Kaufhausdetektivin zufrieden, doch so ganz glücklich macht sie der Job nicht. Natürlich ist auch die Tatsache, dass sie die Tochter der berühmten Sopranistin Maria Fiore ist, ein weiterer Schatten über ihrer erfolglosen musikalischen Karriere. Carlotta ist chaotisch, ironisch, und sie ist dem Alkohol stärker zugetan, als es für sie gut ist. Und sie ahnt noch nicht, wie sehr sich ihr Leben verändern wird … The show must go on Als die Polizei Lotta um Hilfe bei Ermittlungen in der Wiener Oper bittet, sagt sie sofort zu, denn auch als Polizistin hätte sie sich einmal gesehen. In dem imposanten Haus ab der Ringstraße verstummt eine Nachtigall nach der anderen auf mysteriöse Weise. Und zwar während der Vorstellung. Vor Publikum! Lotta stürzt sich undercover in die Wiener Künstlerszene. Zusammen mit dem Ex-Kriminalkommissar Konrad Fürst, der sich seit der Entführung seiner kleinen Tochter als Clown durchschlägt, ist sie dem Täter auf den Fersen – dennoch können sie nicht verhindern, dass für manche Opernstars der Vorhang für immer fällt. Die lebendigsten Figuren, seit es Kriminalromane gibt Lottas Leben ist ein Auf und Ab: gescheiterte Träume und neue Chancen, Familienzusammenführung, Liebe – oder doch nicht? Die gescheiterte Sängerin ist die erste Figur, der Theresa Prammer in Romanform Leben einhauchte, nachdem sie schon als Mädchen begann, Kurzgeschichten in ein buntes Heft zu schreiben. Als Schauspielerin und Regisseurin ist Prammer Profi darin, sich einzufühlen in andere Leben – und so treten uns die Menschen aus ihren Büchern entgegen wie gute Bekannte, die man viel zu lange nicht gesehen hat und die man auf der Stelle auf eine Melange einladen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Theresa Prammer
Wiener Totenlieder
Kriminalroman
Für Joseph
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Epilog: Eineinhalb Jahre Später
Die Autorin
Impressum
Keiner schlafe! Keiner schlafe! Auch Du,
Prinzessin, in Deinem kalten Gemach
betrachtest die Sterne,
die vor Liebe und Hoffnung beben!
Aber mein Geheimnis ist in mir verborgen,
meinen Namen wird keiner erfahren!
aus Turandot von Puccini
Alles, was einmal war, ist immer noch,
nur in einer anderen Form.
Hawaiianisches Sprichwort
PROLOG
Vorstellung:MONOSTATOS
„Monostatos auf die Bühne! Zum Beginn der dritten Szene, Monostatos auf die Bühne! Bitte!“
Bereits zum dritten Mal hallte die Stimme des Inspizienten aus dem Lautsprecher in der Wiener Oper. Und zum sicher zehnten Mal innerhalb der letzten Minute betätigte der Tenor Wilhelm Neumann mit zitternden Fingern die Klingel, um seinen Garderobier Fritz zu rufen.
Der Sänger hielt inne und horchte – nichts rührte sich. Auf dem Gang waren noch immer keine Schritte zu hören. Hatte Fritz ihn vergessen und war mit den anderen Garderobiers auf der Hinterbühne, um die Premiere zu verfolgen? Oder war vielleicht die Klingel kaputt?
Wilhelm Neumann riss die Tür auf, streckte den Kopf hinaus und rief, so laut er konnte: „FRIIIT…!“ Voller Panik stoppte er vor dem „Z“.
Was war das gewesen? Hatte seine Stimme etwa gerade gekiekst?
So Gott wollte, käme in ein paar Minuten sein großer Auftritt als Monostatos in Mozarts Zauberflöte mit dem Lied „Alles fühlt der Liebe Freuden“. Und wenn Fritz nicht bald auftauchte, dann würde er es eben in der Unterhose singen, die er jetzt trug. Aber wenn bei seinem einzigen Solo seine Stimme nicht saß …!
Er räusperte sich, hüstelte ein paarmal. Ein Glück, die Stimme fühlte sich gut an. Ein paar „Mmmm“ und eine Tonleiter aus „A-a-a-a-a-a-a-a-a“ gaben ihm Gewissheit.
Leiser wiederholte er den Namen seines Garderobiers und fügte noch ein paar „Hallo“ und „Hilfe“ hinzu.
Doch der Gang, der die Sologarderoben der Herren miteinander verband, lag weiterhin wie ausgestorben da. Einzig die feuchten braunen Kaffeeflecken auf dem hellgrauen PVC-Boden waren der Beweis, dass hier jemand vor nicht allzu langer Zeit durchgegangen war.
„Monostatos auf die Bühne! Monostatos dringend auf die Bühne!“, drängte die sonst so devote Stimme des Inspizienten aus dem Lautsprecher. Wilhelm Neumanns Herz schien bis zum Hals hinaufzuschlagen. Verzweifelt suchte er mit einem Bein den Eingang in sein Kostüm – ein Ungetüm aus weißem Latex und glänzenden scharfkantigen Metallplatten.
Reichte es denn nicht, dass heute die Premiere der Neuinszenierung der Zauberflöte war? Zum ersten Mal seit seiner abgeschlossenen Ausbildung vor sieben Jahren durfte er in der Wiener Oper, dem bedeutendsten Opernhaus der Welt, auftreten. Die wichtigsten Kritiker saßen im Publikum, sein Debüt war mit seinen zweiunddreißig Jahren ein Drahtseilakt. Und die Gewissheit, dass der heutige Abend über seine weitere berufliche Karriere entscheiden würde, hatte ihm in der letzten Woche mehr als einmal den Schlaf geraubt.
Fast hatte er die Hoffnung schon aufgegeben, nachdem er sich jahrelang durch Kellertheater und Provinzopernhäuser gesungen hatte. Doch dann hatte er es geschafft, sich durch alle drei Runden beim Vorsingen gequält und schließlich das Angebot als Tenorbuffo für die Rolle des Monostatos bekommen.
Sogar die fünf Wochen Probenzeit mit diesem egozentrischen Arschloch von Regisseur hatte er nach außen hin mit geradezu buddhistischer Gelassenheit ertragen. Und wofür das alles? Etwa um an diesem absolut hirnrissigen Kostüm, einer Mischung aus Sadomaso-Outfit und Hollywoodmonster, das er in dieser Szene tragen musste, zu scheitern?
Vor vier Wochen hatte er noch gedacht, es wäre ein Scherz, als man ihm bei der Probe den Entwurf dieses Kostüms gezeigt hatte. Er hatte laut aufgelacht. Leider hatte es der cholerische Regisseur gehört und „Wenn er es nicht versteht, kann er die Rolle auch nicht singen!“ gebrüllt. Sofort hatte sich der Tenor für seinen Ausrutscher entschuldigt. Aber was hatte er auch anderes erwartet von diesem modernen Konzept der Zauberflöte? Ein Konzept, das man noch nicht einmal dann verstand, wenn man sich die zweiundzwanzigseitige Erläuterung im Programmheft durchlas!
Als Wilhelm Neumann endlich sein rechtes Bein mit Gewalt in das Latexbein verfrachtet hatte, war er so außer sich, dass er nicht mehr sagen konnte, ob es Schweißperlen oder Tränen waren, die ihm übers Gesicht liefen. Das Problem war nicht nur der Latexanzug, der so eng war, dass er mit dem Kostümbildner darum hatte kämpfen müssen, darunter seine Unterhose anbehalten zu dürfen. Die viel größere Schwierigkeit waren die unzähligen Bänder, die sich im Innenleben des Anzugs wie ein Labyrinth verflochten. Jedes einzelne musste beim Anziehen in einer exakten Position an seinen Körper gebunden werden, um den Metallplatten die richtige Ausrichtung zu geben, damit sie wie ein sich bewegender zerbrochener Spiegel für das Publikum wirkten.
„Monostatos, sofort auf die Bühne! Monostatos, die zweite Szene ist gleich zu Ende!“, kreischte es nun laut aus dem Lautsprecher über ihm.
Der Tenor fing an, zu wimmern wie ein kleines Mädchen. Oh Gott, das Kostüm schaffte er jetzt wirklich nicht mehr. Er musste also tatsächlich in der Unterhose auftreten. Würde er dann nicht zur Lachnummer der ganzen Aufführung werden? Andererseits, er konnte noch immer die Schuld auf den Kostümbildner schieben. Oder zumindest auf Fritz. Und ganz ehrlich, was sollte an einer weißen Feinrippunterhose schlimmer sein als an diesem hässlichen Ungetüm? Vielleicht würden sie ihn sogar als Helden feiern?
Er zog an dem Latexbein, um sich davon zu befreien, ließ aber sofort wieder davon ab, als er eine der scharfen Metallkanten an seiner Wade spürte und ein dicker Blutstropfen über das weiße Plastik lief.
Schon mit der Hilfe von Fritz war es ein Kunststück, heil in und vor allem aus diesem Kostüm zu kommen. Er brauchte beim Ausziehen Hilfe. Sofort und egal von wem. Sonst würde er gleich die Bühne vollbluten.
Als er auf den Gang humpelte, die klirrenden Metallplatten hinter sich herschleifend, hörte er noch die blecherne Stimme des Inspizienten: „MONOSTATOS! BÜHNE! JETZT!“
„Hilfe, ich brauche Hilfe“, heulte Wilhelm Neumann. „Bitte Hilfe.“ Wie konnte das möglich sein, wo waren denn alle?
Poch, poch, poch.
War das sein Herz, oder hatte da gerade jemand geklopft? Da wieder: poch, poch, poch. Es kam von weit her, aus der Richtung, wo der Gang eine Linkskurve machte und zu den Herrentoiletten führte. Indisches Häusl wurden sie von den Angestellten genannt, denn sie lagen jenseits des Ganges.
Wilhelm Neumann folgte dem Hämmern, es wurde immer lauter, je näher er den Toiletten kam.
„Fritz, Fritz, sind Sie das?“, kreischte der Sänger über das Geklirre und Geklopfe.
„Ja, oh Gott, Herr Neumann, ich bin’s! Ich kann nicht raus! Die Tür klemmt! Ihr Auftritt …“
Dem Tenorbuffo blieb nur ein kurzer Moment, um die Eisenstange zu bemerken, die von außen so unter die Türschnalle der Toilettentür geklemmt worden war, dass man sie von innen unmöglich öffnen konnte.
Ein Arm griff nach ihm, riss ihn an der Schulter herum, und noch ehe Wilhelm Neumann begriff, was passierte, war der Mann, dem der Arm gehörte, auch schon über sein Bein gebeugt und befreite ihn aus dem Latex-Gefängnis. Dann packte er ihn fest am Oberarm und schrie: „BÜHNE!“
Erst jetzt erkannte er in dem Retter den Inspizienten, der ihn bis vorhin noch über den Lautsprecher eingerufen hatte. Sie rannten den Gang entlang, der Inspizient krachte so fest gegen die Tür, die ins Stiegenhaus führte, dass das dicke Glas schepperte. Auf den Stufen stolperte Wilhelm Neumann ein paarmal, aber der Inspizient riss ihn sofort wieder hoch, noch ehe er gestürzt war.
„Kostüm?“, fragte der Tenor, als sie im Erdgeschoss angekommen waren, und krallte seine Finger in den Unterarm des Inspizienten.
„DAS DA“, brüllte der als Antwort, machte eine Kopfbewegung Richtung Unterhose und riss die Bühnentür auf.
Auf der Hinterbühne herrschte ein einziges Gedränge. Eine Unmenge an Statisten, Bühnenarbeitern, Technikern und Menschen, die Wilhelm Neumann noch nie gesehen hatte, versperrte ihm den Weg. Durch einen Seitengang, der direkt auf die Bühne führte, konnte er bereits seine Kollegin, die die Pamina sang, in dem großen schwarzen Bett mitten auf der Bühne sehen. Wie eine Zuschauerin bei einem Tennismatch wand sie auf der Suche nach ihm den Kopf, als würde sie einem imaginären Ball folgen.
„Wie lange schon?“, keuchte Wilhelm Neumann und meinte damit, wie lange seine Kollegin schon auf seinen Auftritt wartete. Doch statt einer Antwort bugsierte ihn der Inspizient gekonnt durch die Menge. Seinen Text „Wo finde ich nun die schöne Pamina?“ konnte er sich bei seinem Auftritt auf jeden Fall schenken.
Jemand hinter ihm, den er im Gegenlicht des Scheinwerfers nicht erkennen konnte, warf ihm etwas über die Schultern. Es war einer der weißen Schutzmäntel aus dünnem Frottee, die normalerweise über dem Kostüm getragen wurden, um es vor Flecken während des Kantinenbesuchs zu schützen. Das war zwar nicht chic, aber immerhin besser als das Unterhosen-outfit. Bevor er endgültig aus dem Seitengang auf den für das Publikum sichtbaren Teil der Bühne geschubst wurde, spürte der Tenorbuffo einen unglaublich stechenden Schmerz im Rücken, der ihm den Atem raubte.
Jetzt nicht auch noch seine Bandscheiben! Sein Arzt hatte ihn nach dem siebten Bandscheibenvorfall gewarnt, er hätte sich schon längst operieren lassen müssen. Doch selbst wenn er es jetzt auf allen vieren kriechend tun müsste – er würde singen!
Zum Glück war der Schmerz schon beim ersten Schritt auf die Bühne vergessen – das unruhige Gemurmel des Publikums empfing ihn wie eine Horde summender Wespen. Er nickte dem Dirigenten zu, der auch sofort dem Orchester ein Zeichen gab und zu „Alles fühlt der Liebe Freuden“ einsetzte.
Die Worte „Alles fühlt der Liebe Freuden, schnäbelt, tändelt, herzet, küsst, und ich soll die Liebe meiden, weil ein Schwarzer hässlich ist, weil ein Schwarzer hässlich ist! Ist mir denn kein Herz gegeben? Bin ich nicht aus Fleisch und Blut?“ schmetterte er nur so aus seiner Kehle.
Noch nie, niemals, hatte er so gut gesungen. Es war, als hätten der Stress und die Panik, die er eben erlebt hatte, alle Blockaden der Angst, mit denen er sonst bei seinen Auftritten gekämpft hatte, aufgelöst.
Voller Elan wandte er sich dem Publikum zu, es war zwar nicht inszeniert, aber das war sein Frotteemantel-Outfit auch nicht. Ein greller Schrei hinter ihm ließ ihn zusammenfahren.
War das etwa Pamina? Wollte sie sein Lied zerstören? Diese blöde Kuh, wahrscheinlich war sie eifersüchtig, weil er so gut war – zu gut! Aber er würde es ihr zeigen.
Gerade als er genauso kraftvoll mit der zweiten Strophe einsetzen wollte, entglitten ihm plötzlich die Worte. Ein Röcheln kam stattdessen aus seinem Mund. Schlagartig legte sich eine bleierne Schwere über seinen Körper, und der Raum begann sich zu drehen. Das Publikum saß in einem Meer, dessen Wellen sich auf ihn zubewegten. Daran war nur die blöde Kuh schuld, ihr Schrei hatte sein Lampenfieber wieder aufgeweckt und ihn aus dem Flow gebracht!
Wütend drehte er sich zu seiner Kollegin, wurde aber sofort von der Reaktion des Publikums abgelenkt. Lachen mischte sich mit empörten Buhrufen, jemand rief „Scheißinszenierung“, andere wisperten, sogar vereinzelter Beifall war zu hören.
Es musste irgendetwas mit ihm zu tun haben, doch es war plötzlich so schwer, einen klaren Gedanken zu fassen – als wäre sein Gehirn aus Kaugummi. Mehr aus Reflex als aus Überlegung fasste sich Wilhelm Neumann an seine Rückseite. Der Frotteemantel war über seinem Hintern komplett durchnässt! Oh Gott, war das der Grund gewesen, weshalb er so schwach war, Pamina geschrien und das Publikum so reagiert hatte? Weil er sich in die Hose gemacht hatte?
Wenn er in diesem Moment einen Wunsch hatte, dann war es der, auf der Stelle tot umzufallen. Langsam zog er seine Hand wieder nach vorne. Das grelle Bühnenlicht tat ihm in den Augen weh, er blinzelte, während er aus dem Augenwinkel die hektischen Bewegungen des Dirigenten sah. An Singen war nicht mehr zu denken, er hatte schon die größte Mühe damit zu atmen. Langsam hob er seine Hand vor die Augen.
Sie schimmerte rot. Leuchtendes, dunkles Rot. Das war kein Durchfall.
Das war Blut.
Und mit einem Mal wusste er es: der eingesperrte Fritz, der Schmerz in seinem Rücken vor dem Auftritt. Es waren nicht die Bandscheiben gewesen.
Er versuchte mit den Fingerspitzen zu ertasten, was da in der Mitte seines Rückens steckte, doch er konnte es nicht erreichen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren.
Wie ein betrunkener Krebs wankte er bei dem Versuch über die schwarzen Bühnenbretter.
Gerade als er die scharfe Kante, die in seinem Rücken steckte, berührte und in ihr eine der Metallplatten seines verhassten Kostüms erkannte, verlor er endgültig die Balance.
Sehr leise stürzte er in den Orchestergraben. Das Letzte, was er in seinem Leben hörte, waren die Schreie des Posaunenbläsers, den er unter sich begrub.
Dann war da nur noch dieses Licht – als würde die Welt um ihn in tausend rosafarbene Kristalle zerbrechen.
1.
„Oh bitte – nicht schon wieder!“
Ich stöhnte laut auf, lehnte mich in meinem Schreibtischstuhl zurück und schlug mir die Hände vor die Augen. Als würde die Frau, die eben auf einem der zwölf Monitore vor mir aufgetaucht war, dadurch verschwinden. Auch ohne die Kamera auf sie zu zoomen, hatte ich sie, kaum hatte sie einen Fuß in das Möbelhaus gesetzt, erkannt.
„Nein, Henriette, geh weg!“, flehte ich und linste durch meine Fingerspitzen auf den Bildschirm, der den Eingangsbereich zeigte. Doch da sie mich nicht hören konnte, schritt sie mit ihrem unverwechselbaren Gang auf die Rolltreppe zu. Selbst unter den tausend Kunden, die ich jeden Tag aus meinem kleinen Büro beobachtete, würde ich sie schon alleine deshalb immer sofort erkennen.
Henriette ging nicht – sie schritt. Wie eine Balletttänzerin, die jeden Moment damit rechnet, aus dem Stand eine Pirouette zu drehen. Den Oberkörper durchgestreckt, das Becken nach vorne gekippt und die Fußspitzen, die bei jedem Schritt als Erstes zart den Boden berührten, zur Seite gedreht. Es hatte etwas grotesk Elegantes. Henriette wog über hundert Kilo, die Gläser ihrer Brille hatten die Stärke von Aschenbechern, und man konnte ihrer Kleidung ansehen, dass sie aus der Altkleidersammlung stammte. Obwohl wir fast gleich alt waren, kam es mir immer so vor, als lägen Jahrzehnte zwischen uns.
„Also gut, worauf hast du es diesmal abgesehen“, gab ich mich geschlagen und vergrößerte mit dem Joystick das Bild. Sie blieb vor der Tafel mit dem Verzeichnis der Abteilungen in den Stockwerken stehen und tat so, als würde sie sie studieren.
„Ach bitte, als würdest du das nicht alles auswendig wissen“, sagte ich und überlegte, ob ich ihr diesmal den Spaß verderben und sie gleich aufhalten sollte. Andererseits hatte ich so wenigstens etwas zu tun, denn obwohl Samstag war, war es ruhig in dem Möbelhaus. Kein Wunder, denn schließlich war nicht nur der erste schöne Frühlingstag, es war auch noch Ende des Monats.
Henriette schien ihre Auswahl getroffen zu haben, betrat leichtfüßig die Rolltreppe, und ich wechselte zu dem Monitor, der ihre Fahrt in das nächste Stockwerk zeigte.
Kein einziges Mal war sie hier gewesen, ohne zu versuchen, etwas mitgehen zu lassen. Dieses Spiel spielten wir jetzt schon seit zwei Jahren. Damals hatte ich sie in meiner zweiten Woche als Hausdetektivin beim Diebstahl einer billigen gläsernen Teekanne erwischt.
Jedes Mal seit dieser Begegnung verlief alles nach dem gleichen Schema: Nachdem ich ihr das Diebesgut abgenommen hatte, wollte ich sie gehen lassen. Doch sie bestand darauf – der Ordnung halber, wie sie sagte –, in mein Büro zu gehen, wo ich den Tathergang und ihre Daten aufnehmen sollte.
Die Polizei rief ich schon lange nicht mehr, nachdem aufgeflogen war, dass Henriette log, was ihren Nachnamen und ihre Adresse betraf.
Ihr wirklicher Aufenthaltsort war eine Nervenheilanstalt, von der sie ein paarmal die Woche Ausgang hatte. Als ich sie darauf angesprochen hatte, hatte sie gegrinst und gesagt: „Wir haben alle unsere Geheimnisse, nicht wahr? Wie war das doch gleich bei Ihnen? Hat nicht geklappt mit der Polizeischule? Ein Jammer, Ihre Mutter muss sehr enttäuscht gewesen sein, weil Sie ja deshalb nicht als Opernsängerin weitergemacht haben, oder?“
Ich fragte nicht, woher sie das wissen konnte, und wir hatten danach nie wieder ein Wort darüber verloren.
Nach dem dritten versuchten Diebstahl wurde mir klar, dass Henriette gar nicht die Absicht hatte, etwas zu stehlen. Mir kam es vor, als wäre sie mehr an einer Unterhaltung und dem Kaffee interessiert, den sie jedes Mal verlangte und auch bekam, wenn sie in meinem Büro saß.
Eine Person, die hinter Henriette aufgetaucht war, zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Hatte diese dunkle Gestalt eben in die Kamera gewunken?
Mit dem Joystick wechselte ich die Perspektive, und meine Finger verkrampften sich auf dem schwarzen Plastikteil, als ich ihn erkannte. Das letzte Mal hatten wir uns vor drei Jahren gesehen, kurz nachdem ich diesen Job hier angenommen hatte.
Der Mann auf dem Bildschirm deutete auf sich, dann führte er seine Finger zum Mund, machte ein paar stumme Sprechbewegungen und richtete schließlich seinen Zeigefinger in Richtung Kamera. Auch ohne ihn zu hören, verstand ich die Worte, die er jetzt mit den Lippen bildete: „Es ist wichtig.“
„Ach du Scheiße“, fluchte ich, nahm mein Handy vom Tisch und verließ die kleine dunkle Kammer, die mir als Büro diente.
„Und, was führt dich zu mir?“, fragte ich bemüht beiläufig, nachdem ich Henriette einen Pappbecher mit Kaffee in die Hand gedrückt und sie – trotz ihres lauten Protests – aus meinem Büro geführt hatte.
„Bekomme ich auch einen Kaffee, oder ist der nur für deine Ladendiebe reserviert?“, überging Hannes Fischer meine Frage. Er stand vor dem Tisch mit den Monitoren und hatte die Arme fest auf Brusthöhe verschränkt. Bis auf seine längeren Haare und ein paar graue Strähnen hatte er sich überhaupt nicht verändert. Er sah noch immer so gut aus wie damals, was ich von mir nicht behaupten konnte.
„So wie immer?“, fragte ich und schaltete die Espressomaschine wieder ein.
„Wie immer ist gut“, lachte er. Der Vorwurf darin war nicht zu überhören. „Wenn du mit ‚wie immer‘ wie vor drei Jahren meinst, dann nein. Ich trinke ihn schwarz.“
Ich wechselte das Thema: „Wieso wusstest du eigentlich, dass ich dich sehe?“
„Was meinst du?“ Er schien sich ein bisschen zu entspannen und lockerte seine Haltung.
„Auf der Rolltreppe. Wieso hast du gewusst, dass ich gerade dabei war, Henriette zu beobachten?“, fragte ich und füllte frischen Kaffee in den Siebträger.
„Die Überwachungskameras haben sich in ihre Richtung bewegt.“
„Das ist dir aufgefallen?“
Ich stieß einen anerkennenden Pfiff aus und setzte mein verführerisches Grinsen auf, doch er fuhr dazwischen: „Versuch das jetzt bloß nicht.“
„Was?“
„Hör auf zu flirten, Carlotta!“
„Nenn mich nicht so!“, fauchte ich und zeigte mit dem silbernen Siebträger auf ihn.
Im ersten Moment dachte ich, er würde wütend werden, doch dann hob er die Hände, als würde er sich vor meinem Siebträger ergeben, und sagte lächelnd: „Okay, entschuldige. Ich hab’s vergessen.“
Obwohl ich nicht wollte, musste ich darüber lachen. Das Eis zwischen uns schien gebrochen, ich hängte den Siebträger ein, und der Kaffee floss zischend in die kleine Porzellantasse. Als sie zur Hälfte gefüllt war, reichte ich sie ihm und nahm auf meinem Schreibtischstuhl Platz.
Ich konnte mich noch gut an unser letztes Treffen vor drei Jahren erinnern: Er hatte gebrüllt, ich hatte gebrüllt, dann hatten wir beide gebrüllt, und das war es. Hannes Fischer war, wie für mich üblich, eine Affäre gewesen. Zumindest redete ich mir das ein. Er hatte in Gedanken bereits unsere gemeinsame Wohnung eingerichtet, während es für mich schon zur Höchstleistung zählte, dass wir uns zweimal die Woche sahen.
„Du bist nicht mehr Ausbilder“, sagte ich, „hast jetzt groß Karriere gemacht. Ist in der Zeitung gestanden …“
„So groß auch nicht, ich habe noch immer genug Leute über mir, die mir das Leben zur Hölle machen. Zum Beispiel Krump!“
Automatisch verzog sich mein Gesicht bei diesem Namen. Schließlich war es Krump gewesen, der damals dafür gesorgt hatte, dass ich schon nach einer Woche aus der Polizeischule geflogen war.
„Wie geht es dir?“, fragte er nach dem ersten Schluck. „Ich meine … hier?“ Er war meinem Blick bei dem Wort „hier“ ausgewichen.
„Phantastisch, es ist das Paradies auf Erden.“
„Okay, gut. Und sonst?“
„Was sonst?“ Ich funkelte ihn herausfordernd an, doch er ging nicht darauf ein.
„Kannst du noch diese Sache?“
Ich verdrehte die Augen. „Wieso fragst du mich nicht gleich, ob ich noch Auto fahren kann? Ja, deine Lieblingsfarbe ist noch immer Moosgrün, oh, du hattest heute Schokoflakes zum Frühstück, wie nett, und du bist 35, aber das weiß ich auch so, ohne diese Sache.“
Er hatte keine Miene verzogen. „Und was macht die Singerei?“
„Ist das wichtig?“, fragte ich knapp.
Hannes schüttelte den Kopf. „Okay, warum ich hier bin, Carlott…“, er stoppte und verbesserte sich selber, noch bevor ich Einspruch eingelegt hatte. „Entschuldige, ich weiß, Lotta. Es geht um einen neuen Fall. Und ich bin hier, weil ich deine Hilfe brauche. Hast du von dem Todesfall während einer Vorstellung in der Wiener Oper gehört?“
„Du meinst das mit der umgestürzten Kulisse, von der eine Soubrette während ihrer Arie erdrückt wurde? Ja, ich hab es in den Nachrichten gesehen.“
„Das war Mord.“
„Wieso Mord? Es hieß, es war ein Unfall.“
„Das dachten wir zuerst auch, aber es war der erste Mord.“
„Der erste?“
„Ja, denn gestern Abend, bei der Premiere der Zauberflöte, gab es den zweiten. Ein Sänger wurde durch eine Spiegelscherbe im Rücken getötet – sie war Teil seines Kostüms. Während seines Solos ist er auf der Bühne gestorben.“
„Wie poetisch! Und wieso seid ihr so sicher, dass es gestern nicht doch ein Unfall war?“
„Weil er sein Kostüm gar nicht angehabt hat. Der Typ, der ihn hätte anziehen sollen, wurde in der Toilette eingesperrt.“
„Das ist also dein neuer Fall?“
„Ja, das ist er.“
„Und was hat das mit mir zu tun?“
Hannes stellte die Kaffeetasse auf den Tisch und beugte sich so nah über mich, dass ich sein Aftershave riechen konnte. Süßer Jasmin und herbe Bergamotte, ich hatte es nicht vergessen.
„Ich habe ein Jobangebot für dich“, flüsterte er und deutete mit dem Daumen zu der geschlossenen Tür. „Oder willst du mir einreden, du hast deine Erfüllung darin gefunden, den ganzen Tag solchen Verrückten aufzulauern?“
Ich hielt seiner Nähe stand und flüsterte zurück: „Und was soll das für ein Angebot sein?“
Dann fuhr ich ihm mit den Fingern zart über seine glatt rasierte Wange und hauchte: „Oder bist du doch aus einem anderen Grund hier und benutzt diese Geschichte nur als Vorwand?“
Er seufzte, und einen Moment dachte ich, er würde darauf eingehen.
Doch dann richtete er sich wieder auf: „Bitte, hör damit auf, Lotta.“
„Warum?“, fragte ich und legte mich tiefer in den Stuhl.
„Hörst du damit auf, wenn ich es dir sage?“
„Ich verspreche es hoch und heilig“, antwortete ich und streckte meinen Oberkörper ein bisschen durch, damit mein Busen besser zur Geltung kam.
„Ich bin vor kurzem von einer Frau verlassen worden, die ich sehr geliebt habe. Mir ist nicht nach irgendwelchen Spielchen.“
Ich verharrte in meiner Position und überspielte den unerwartet heftigen Stich, den es mir gab, mit: „Oh, hat eine böse Frau dein kleines Herz gebrochen?“
„Ich bin hier, weil ich Hilfe brauche. Inoffizielle Hilfe. Und mir sind nur du und noch jemand dafür eingefallen. Durch deine Vergangenheit und deine Mutter bist du einfach ideal dafür.“
„Könntest du dich ein wenig klarer ausdrücken?“
„Hat deine Mutter nicht damals an der Wiener Oper gesungen?“
„Meine Mutter hat auf der ganzen Welt gesungen!“
„Heißt das ja?“
„Natürlich heißt das ja!“
„Gut, dann kann sie dir sicher einiges darüber erzählen, wie es dort zugeht.“
Ich lachte laut auf. „Das wäre ein Wunder! Meine Mutter ist vor zwei Jahren gestorben. Sag bloß, du hast nichts davon mitbekommen? Dieses pompöse Ehrenbegräbnis, für das fast der ganze 1. Bezirk gesperrt war?“
„Es tut mir leid, das wusste ich nicht.“
„Da bist du wahrscheinlich der Einzige in ganz Wien. Also, jetzt sag endlich, wieso du gekommen bist“, unterbrach ich ihn.
„Okay, es geht um die Wiener Oper. Da deine Mutter dort aufgetreten ist, wärst du keine Unbekannte, wenn ich dich …“ Er stockte, als würde er nach den richtigen Worten suchen, und ich fragte: „Wenn du mich was?“
„Wenn ich dich als Statistin einschleuse!“
Ich sprang von meinem Schreibtischstuhl hoch, er rollte weg und donnerte gegen die Wand. „Spinnst du? Das soll der Job sein, den du mir vorschlägst? Als Statistin? Willst du mich verarschen?“
„Lotta, du verstehst das falsch … es hat nichts damit zu tun, dass es mit deiner Gesangskarriere nicht geklappt hat. Es ist eher … das Paket, das du bist.“
Ich zischte „Raus!“ und machte eine Kopfbewegung Richtung Ausgang.
„Hör mir vorher noch zu. Du weißt genug über die Oper, dann natürlich der Bonus, den du durch deine Mutter hast, die meisten Leute werden dich kennen und dir sicher mehr erzählen als uns … wir müssen von weiteren Morden ausgehen … du hast keine Ahnung, unter welchem Druck ich stehe! Krump weiß nicht, dass ich hier bin, niemand weiß es, bis auf … die Person, die mir ein anonymes Bankkonto eingerichtet hat und mich hat wissen lassen, dass dieser Fall sofort geklärt werden muss. Egal, was es kostet …“
Ich wollte gerade nach der Türschnalle greifen, um ihm den Weg zu weisen, doch dieser letzte Satz wirkte wie ein Stoppschild.
„Was meinst du mit ‚Egal, was es kostet‘?“, fragte ich.
„Ich meine das, was es heißt. Du bekommst 10 000 Euro, die nirgendwo aufscheinen werden. Dafür wirst du in drei Stücken als Statistin eingesetzt. Also, was sagst du?“
Ich zuckte unbeeindruckt mit den Schultern, während in meinem Kopf ein Feuerwerk startete.
10 000 Euro!
„Was muss ich sonst noch dafür tun?“
„Wir werden die Ermittlungen natürlich weiterführen, aber du sollst deine Kontakte nutzen, um diesen Opernhaus-Mikrokosmos von innen zu durchleuchten.“
„Als Statistin?“ Die Stimme war mir hochgerutscht, aber ich stemmte die Hände in die Hüften, um die Peinlichkeit zu überspielen.
„Das ist die einzige Möglichkeit. Nicht nur wegen dir, es geht auch um den Undercoverpartner, mit dem du zusammenarbeiten wirst. Er hat keine Ahnung von der Oper, aber er kennt sich mit der Ermittlungsarbeit aus. Und was Auftritte betrifft, nun ja, er hat … gewisse Vorkenntnisse.“
„Was für Vorkenntnisse?“
Statt einer Antwort nahm er einen kleinen Zettel aus seiner Brusttasche und drückte ihn mir in die Hand. „Morgen, 14 Uhr. Und sei pünktlich.“
Kaiserwiese – Bühne vor dem Riesenrad, Clown Foxi stand da. Was sollte das alles?
„Ich überleg es …“, begann ich, doch als ich den Kopf hob, stand die Bürotür offen. Von Hannes war nichts mehr zu sehen.
Das Mädchen – 30. August
Sie war vier Jahre alt, als das merkwürdige Mädchen verschwand.
Plötzlich war es fort. Der Platz im Bett, auf dem es neben ihr geschlafen hatte, war noch warm. In den Kissen und in der Bettdecke hing der süße, schwere Geruch nach den buttrigen Keksen mit der dicken Schokoladenglasur, die das Mädchen immer in sich hineingestopft hatte.
Kaum war eine neue Packung da, hatte das Mädchen sie auch schon wieder leer gegessen. Wie oft hatte sie sich darüber geärgert, dass es ihr nicht einmal einen einzigen Keks übrig gelassen hatte. Doch auf ihren Protest hatte das Mädchen sie jedes Mal mit ihrem schokoladeverschmierten Mund angegrinst, die Arme ausgestreckt, sie an sich gedrückt und abgeküsst, als wäre sie auch aus Schokolade.
Jede Nacht waren sie eingeschlafen, die Finger so ineinander verschlungen, dass man auf den ersten Blick nicht sagen konnte, welche Hand zu welchem Mädchen gehörte.
Jetzt war sie zum ersten Mal alleine hier, weit weg von zu Hause. Diese verschlingende Angst wanderte durch ihren kleinen Körper, alles hätte sie in diesem Moment hergegeben – Teddybären, Puppen, Spielsachen, sogar ihre heiß geliebten pinkfarbenen Schuhe mit den violett glitzernden Klettverschlüssen, wenn nur das merkwürdige Mädchen wieder auftauchte. Wenn sie nur nicht alleine hierbleiben müsste.
Plötzlich öffnete jemand die Tür. Sie konnte die große Gestalt in der Dunkelheit nicht erkennen, aber sie war sich sicher, dass es dieselbe Person war, die sie hier eingesperrt hatte. Verzweifelt versuchte sie, um Hilfe zu rufen, aber die Angst lähmte ihre Stimme. Panische Tränen liefen in kleinen Bächen über die Wangen, den Mund zu einem stummen Schrei aufgerissen, flehte sie in Gedanken: „Bitte, lass mich nach Hause. Ich will nach Hause!“
Statt einer Antwort tauchte ein vertrauter Schmerz in ihrem Oberarm auf und dazu ein Rütteln, als würde ihr Bett vibrieren.
„Schatz, wach auf!“
Das merkwürdige Mädchen, sie wollten doch zusammenbleiben. Sie musste doch …
„Schatz, komm, wach auf! Ich bin es, deine Mama.“ Keuchend riss sie die Augen auf. Es war nicht echt gewesen. Sie hatte wieder geträumt!
Es dauerte einen Moment, bis sie die hübsche Frau vor ihrem Bett erkannte, die jetzt zerzauste Haare hatte und deren schneeweißer Schlafmantel schief über den Schultern hing.
„Ach Schatz, es war doch nur ein böser Traum“, flüsterte die Frau, während sie ihr die schweißnassen Haare aus der Stirn wischte. „Alles nur ein böser Traum. Mama ist da.“
Sie nickte, obwohl sie wusste, dass es nicht die Wahrheit war.
Es war noch nie nur ein Traum. Denn das war nicht ihr Bett, in dem sie lag. Und das war auch nicht ihr Zuhause. Genauso wenig, wie diese Frau ihre Mutter war.
2.
Es war, als würde der Sommer ein paar Monate zu früh auf Stippvisite vorbeikommen, als ich am nächsten Tag kurz nach 14 Uhr im Prater ankam. Die Sonne strahlte, ein sanfter Wind wehte und wäre ich nicht so verkatert und übermüdet gewesen, hätte ich es genossen. Aber so nervte mich nur, dass meine langärmelige Bluse am Rücken klebte und der Wind mir ständig die Haare ins Gesicht blies. Meine Haarspange musste noch im Bett von Gerd oder Bert liegen – ich hatte mir seinen Namen nicht gemerkt.
Je mehr ich mich mit wackeligen Schritten der Kaiserwiese näherte, desto öfter trug das laue Lüftchen Gekreische in meine Richtung. Zuerst dachte ich, es käme von irgendeiner Achterbahn, doch je näher ich meinem Ziel kam, desto lauter wurde es.
„Das hat mir gerade noch gefehlt“, murmelte ich, als ich bei der Kaiserwiese angekommen war. Mein Kopf würde gleich zerspringen von dem Lärm.
Mitten auf der Wiese war eine riesige Bühne aufgebaut, vor der sich über zweihundert Kinder drängten. Sie grölten, plärrten, johlten und quietschten der Person auf der Bühne zu.
CLOWN FOXI stand in großen roten Buchstaben auf dem quer gespannten Banner, unter dem ein Mann im Clownkostüm seine Show abzog. Er hatte eine grellrote Coppola-Kappe auf, unter der sich dichte schwarze Locken auf seiner Stirn kräuselten. Über einem weißen T-Shirt trug er ein genauso grellrotes Gilet und einen viel zu großen karierten Smoking, der fast bis zum Boden reichte. Er tanzte und wirbelte in seinen riesigen schwarzen Clownschuhen herum, die über den Zehen zu einer großen Beule gewölbt waren. Seine untere Gesichtshälfte war mit einem Kreis aus weißer Farbe überzogen, Nase und Lippen waren im selben roten Farbton bemalt wie Kappe und Gilet. Die Augen hatte er mit schwarzem Kajal und blitzblauem Lidschatten betont, und zwei Apfelbäckchen auf den Wangen gaben ihm den letzten Schliff.
Ich sah ein paar Minuten zu, wie er ein kleines Mädchen auf die Bühne holte und mit seiner Hilfe versuchte, einen blauen Schal grün zu zaubern. Natürlich klappte es nicht, anstatt die Farbe zu wechseln, verschwand der Schal einfach. Und die Kinder schrien wie auf Kommando aufgeregt durcheinander, als dem Clown der verschwundene blaue Schal plötzlich aus einem Hosenbein wuchs. Das Geschrei schwoll an. Es war ohrenbetäubend. Ich wollte gerade die Flucht ergreifen, bevor sie mir meinen letzten Rest an Gehirn herausbrüllten, doch ich kam nicht weit. Hinter mir stand Hannes, und ich lief direkt in ihn hinein. Er trat einen Schritt zurück, musterte mich und schüttelte mitleidslos den Kopf.
„Dir auch einen guten Morgen“, brüllte ich, um lauter zu sein als das Kindergekreische. Ein Schmerz blitzte durch meinen Schädel und ich zuckte zusammen, doch Hannes reagierte nicht auf mein Gejammer, sondern bedeutete mir nur, ihm zu folgen.
Wir gingen in einen abgesperrten Bereich links neben der Bühne. Zwischen Lkws, Kleintransportern und Wohnwägen standen zwei lange Holztische mit Sitzbänken.
„Gibt es hier Kaffee? Wasser?“, fragte ich. Meine Stimme knarrte so sehr, dass sie mir fremd vorkam.
„Geh dich erst mal frisch machen“, befahl Hannes und deutete auf einen der Wohnwägen, an dem ein Schild mit „Clown Foxi“ angebracht war.
„Seine Show dauert noch eine halbe Stunde. Ich besorge dir in der Zwischenzeit Kaffee.“
„Du bist ein Engel.“ Ich stolperte auf den Wohnwagen zu.
„Und fass nichts von seinen Sachen an“, rief Hannes mir nach. Statt einer Antwort knallte ich die Wohnwagentür hinter mir zu.
Ich war das letzte Mal als Kind in einem Wohnwagen gewesen. Es war in Paris, während eines Gastspiels meiner Mutter in der Opéra National. Sie war an einem freien Abend mit mir in den Zirkus gegangen. Nach der Vorstellung wollte der Zirkusdirektor sie unbedingt kennenlernen und lud sie zu sich in seinen luxuriösen Wohnwagen ein. Er war sichtlich enttäuscht, als meine Mutter, die für ihren freizügigen Lebenswandel bekannt war, plötzlich mit mir im Schlepptau auftauchte. Ich war überwältigt von den roten Samtmöbeln und dem goldenen Stuck an der Decke, es war wie ein kleiner Palast auf vier Rädern.
Dieser Wohnwagen hier war vollkommen anders. Von außen hatte er nicht so schäbig gewirkt, wie er sich innen präsentierte. Der hellbraune Spannteppichboden war zwar sauber, aber ausgefranst und löchrig. Es gab ein kleines Waschbecken, der Wasserhahn darüber war mit Isolierband abgedichtet, aber es bildete sich trotzdem ein kleines Rinnsal, das in die angeschlagene Waschmuschel lief. Auf einem Klapptisch, an dem schon die Lasur abblätterte, stand ein großer Spiegel, der Tisch war vollgestellt mit diversen Schminksachen, Tiegeln mit Cremes und Abschminktücherpackungen. Vor dem kleinen Fenster hingen fein säuberlich ein sauberes weißes Hemd und eine dunkelblaue Hose. Darunter stand eine breite Sitzbank mit einem altmodischen karierten Überzug, dessen Farbe schon ausgeblichen war.
Als ich mich im Spiegel sah, rutschte mir ein „Oha“ heraus. Meine Haare standen verfilzt vom Kopf ab, und die Wimperntusche hatte sich unter meinen Augen in den kleinen Fältchen abgesetzt. Der Lippenstift hatte blassrosa Schatten über meiner Oberlippe hinterlassen. Weil ich meinem Undercoverpartner nicht wie Winnetous Schwester auf Entzug entgegentreten wollte, setzte ich mich an den Tisch, griff nach einem der Abschminktücher und entfernte die zerlaufene Wimperntusche. Dann reinigte ich damit auch gleich mein Gesicht von Lippenstift und Make-up-Resten. Aus der Palette mit Clownschminke, die auf dem Tisch lag, zog ich mit grellem Rot meine Lippen nach und malte mir damit genau solche Apfelbäckchen wie der Clown Foxi. Mit dem schwarzen Kajal umrandete ich meine Augen und legte mir ebenfalls den blitzblauen Lidschatten auf die Augenlider. Dann betrachtete ich mein Werk. Ja, ich sah wieder aus wie ein Mensch.
Zufrieden nahm ich einen tiefen Atemzug, und erst da fiel mir dieser Geruch auf. Ich schloss die Augen und schnüffelte – es war eine Mischung aus Herbstlaub, reifen Zitrusfrüchten, frisch geschnittenem Holz und einem Hauch Zimt, er erinnerte mich an irgendetwas, aber ich kam nicht darauf, was es war.
Also legte ich mich auf die Sitzbank, und während ich versuchte, mir ins Gedächtnis zu rufen, woher mir der Geruch so bekannt vorkam, schlief ich ein.
Das Flüstern zweier Männerstimmen weckte mich auf.
Der Geruch war nun stärker geworden und ein weiterer Duft hatte sich dazugemischt: frischer Kaffee!
„Ich habe Ihnen einen Kaffee geholt“, sagte Hannes, worauf eine fremde Männerstimme knurrte: „Danke. Ich habe nur kurz Zeit, es geht in fünf Minuten weiter.“
Gerade als ich meine Augen öffnen wollte, sagte die unbekannte Stimme: „Wer ist das? Wen haben Sie da mitgebracht?“ Es hatte nicht besonders freundlich geklungen – ich nahm an, er meinte mich.
„Es tut mir leid, ich werde sie sofort …“
„Nein, wecken Sie sie nicht“, unterbrach ihn die fremde Stimme. Sie klang viel tiefer und rauer als die des Clowns auf der Bühne. Das musste jemand anderes sein. Obwohl sich mein Körper danach sehnte, mit heißem Kaffee wiederbelebt zu werden, war ich zu neugierig, um das Gespräch zu unterbrechen. Also stellte ich mich weiterhin schlafend.
„Okay“, erwiderte Hannes leise.
„Ich habe mir das überlegt, weswegen Sie gestern hier waren. Und die Sache ist die – ich werde es nicht tun.“
„Ist es wegen der Summe, die ich genannt habe? Wollen Sie mehr?“
„Nein, es hat nichts damit zu tun.“ Die fremde Stimme hielt kurz inne, und ich dachte schon, das Gespräch wäre beendet, doch dann fuhr er fort:
„Seit wann sind Sie schon bei der Mordkommission?“
„Seit einem Jahr“, antwortete Hannes.
„Was wissen Sie über mich?“
Sogar ich spürte das Gewicht dieser Frage, obwohl ich die Augen geschlossen hatte. Ich konnte hören, wie Hannes schluckte, bevor er sagte: „Ich weißalles. Jeder in der Mordkommission kennt Ihre Geschichte.“
Die fremde Stimme lachte traurig auf. „Dann werden Sie meine Entscheidung verstehen. Ich kann Ihnen nicht helfen.“
„Aber das ist doch schon so lange her.“
„Es ist vielleicht lange her, aber es ist nicht vorbei. Es wird nie vorbei sein.“
„Was meinen Sie damit?“
Die fremde Stimme antwortete nicht.
„Sie haben die Suche nicht aufgegeben?“, fragte Hannes, so überrascht, als hätte er eben etwas begriffen, das er nicht glauben konnte. Ich fragte mich, von welcher Suche er sprach.
„Sie sollten jetzt gehen“, sagte die tiefe Stimme. Es klang mehr nach einer Drohung als nach einem Vorschlag.
Hannes drängte: „Wenn es wegen Krump ist, er hat nichts damit zu tun. Er weiß nicht einmal, dass ich hier bin. Ich versichere Ihnen, niemand von der Mordkommission außer mir weiß von der ganzen Angelegenheit. Ich brauche wirklich Ihre Hilfe.“
Einem erschöpften Seufzen folgte ein hölzernes Knarren – ich nahm an, dass sich einer der beiden gerade gesetzt hatte.
„Wir müssen davon ausgehen“, fuhr Hannes eilig fort, „dass die ganze Sache in der Oper eben erst begonnen hat. Und wir tappen völlig im Dunkeln!“
„Wie gehen Sie vor?“, fragte die fremde Männerstimme.
„Wir beruhigen erst einmal die Presse, indem wir alle Personen vorladen, die in den letzten fünf Jahren gegen ihren Willen nicht weiterbeschäftigt wurden.“
„Wieso nur in den letzten fünf Jahren?“
„Weil das Opernhaus vor fünf Jahren neu übernommen wurde. Es ist anscheinend üblich, dass auch Sängerinnen und Sänger ausgetauscht werden, wenn die Direktion wechselt.“
„Das heißt, ein neuer Chef kommt und man ist den Job los?“
„Ganz genau“, sagte Hannes.
„Aber Sie glauben nicht, dass das die richtige Spur ist, nicht wahr?“
„Ich glaube es nicht nur nicht, ich weiß es. Es wäre einer Person, die nicht mehr in dem Haus beschäftigt ist, unmöglich, sich so frei zu bewegen, ohne aufzufallen. Der Mörder kann die Oper ungehindert über den Bühneneingang betreten, der ständig von einem Portier besetzt ist. Er hat überall Zutritt, und kein Mensch wundert sich darüber. Und er kennt sich sehr genau aus.“
„Da haben Sie wahrscheinlich recht“, stellte die fremde Stimme fest. Sie schwiegen, und ich wagte es, mein linkes Auge ein klein wenig zu öffnen. Hannes stand mit dem Rücken zu mir, schräg vis-à-vis saß der Mann mit der fremden Stimme an dem Tischchen mit dem Schminkspiegel.
Das war doch der Clown!
Der Clown Foxi, der vorhin noch mit lautem Getöse seine Show abgezogen hatte. Da er zu Hannes hochsah, öffnete ich auch mein rechtes Auge einen ganz kleinen Spalt.
Ich schätzte ihn auf Mitte bis Ende fünfzig, die große rote Kappe hatte er abgesetzt, darunter kamen kurze schwarze Locken zum Vorschein. Ein kleiner Speckbauch ließ das Gilet in Höhe des Bauchnabels spannen. Trotz der Schminke und für jemanden, der sich vor Kindern zum Affen machte, hatte er etwas an sich, dass ich nicht aufhören konnte, ihn anzusehen.
„Gibt es einen Plan, wie lange jetzt keine Vorstellungen stattfinden?“, fragte der Clown.
„Was meinen Sie, keine Vorstellungen?“
„Ich meine, wie lange wird die Oper geschlossen?“
„Sie wird nicht geschlossen, darum ist der Undercovereinsatz ja so wichtig!“
„Moment! Ich dachte, es finden während der Ermittlungen keine Vorstellungen mehr statt, aber die nächsten Stücke werden geprobt und dafür brauchen Sie mich.“
„Nein, der Betrieb läuft unverändert, und daran wird sich, soweit ich das beurteilen kann, auch nichts ändern.“
„Trotz der beiden Morde?“
„Ja, es gab gestern eine Pressekonferenz von Kulturminister Schöndorfer. Mit einem Appell an den Mörder, die Kunst wird nicht der Gewalt weichen, nicht solange ich Kulturminister bin, bla, bla, bla …“
„Das ist verrückt …“
„Ich weiß. Aber wenigstens gibt es so eine reelle Chance, den Mörder so schnell wie möglich zu erwischen.“
„Na wunderbar, Sie planen eine Überführung in flagranti! Was ich aber noch nicht verstehe, wieso wollen Sie mich dafür?“, fragte der Clown und verengte die Augen zu schmalen Schlitzen.
„Liegt das nicht auf der Hand?“, entgegnete Hannes überrascht.
„Auf meiner jedenfalls nicht.“
„Sie haben als Clown Bühnenerfahrung. Also sind Sie für diesen Fall die perfekte Mischung von Darsteller und Ermittler.“
„Ich bitte Sie, Fischer, ich muss doch keine Oper singen. Sie könnten jeden dort einschleusen.“
„Ja, das stimmt, aber bei Ihnen kann ich sicher sein, dass Sie dem Druck einer Aufführung standhalten und dabei nicht Ihre Aufgabe als verdeckter Ermittler vernachlässigen. Sie waren schließlich einer der Besten in der Mordkommission … bevor es passiert ist.“ Die Stille, die daraufhin eintrat, war sogar mir peinlich. Und ich fragte mich, was denn wohl passiert war, das einen Ermittler auf Clown umsatteln hatte lassen? Hannes ließ den Clownmann nicht aus den Augen, als wäre er ein Rennpferd, auf dessen Zieleinlauf man wartet.
„Und was machen Sie wegen Krump?“
„Was meinen Sie?“
„Ich darf ihm dort nicht über den Weg laufen – Sie wissen, warum.“
„Das wird kein Problem sein. Die Ermittlungen leiten in erster Linie meine Kollegen und ich vor Ort. Sollte sich Krump in der Wiener Oper aufhalten, bekommen Sie rechtzeitig von mir Bescheid.“
„Was wissen Sie sonst noch, irgendwelche Streitigkeiten, Verdächtige, Eifersuchtsszenen?“, fragte der Clown, und Hannes atmete hörbar aus.
„Das ist es ja! Wir kommen einfach nicht durch, dieses Haus ist ein Mikrokosmos und jeder hält dicht. Ich bin nicht mal in der Nähe eines brauchbaren Hinweises …“
„Ich verstehe. Was ich noch wissen möchte: Wer hat Ihnen den Auftrag für diese Undercoveraktion gegeben? Wer hat Ihnen so viel Geld gegeben …?“
„Sie werden alles erfahren, was der Aufklärung dient, nur das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe mein Wort gegeben, und das werde ich halten.“
„Ist es Ihr Wort, das Sie hindert, oder die beträchtliche Summe, die Sie für Ihr Schweigen ausverhandelt haben?“
Als Hannes ihm keine Antwort gab, fuhr der Clown sich mit den Fingern über die Stirn, dann stützte er sein Kinn ab und zeigte mit dem Zeigefinger auf mich. „Und wer ist sie?“
Blitzschnell schloss ich die Augen, ich wusste nicht, ob er es bemerkt hatte, doch er sagte nichts.
„Sie ist Ihre Eintrittskarte – ihre Mutter war Maria Fiore.“
„Wer?“
„Maria Fiore, die Opernsängerin.“
„Die Maria Fiore? Ich wusste gar nicht, dass sie eine Tochter hat.“
„Ja, die Maria Fiore. Ihr Name ist Carlotta.“
Ich hörte, wie der Clownmann Luft ausblies, bevor Hannes weiterflüsterte: „Aber sie ähnelt ihrer Mutter nicht sehr. Na ja, sie hat es lange versucht, hat es aber nie als Opernsängerin geschafft.“ Hannes senkte seine Stimme so sehr, dass ich nicht mehr alles verstehen konnte: „… wollte zur Polizei … vor ein paar Jahren … ziemlich verkorkst …“
Ich musste nicht alles hören, um zu verstehen, was er meinte. Dann sagte er lauter, fast als wäre es Absicht, dass ich es hörte: „Ich glaube, sie kann Ihnen sehr nützlich sein. Nur tun Sie sich selber einen Gefallen und gehen Sie nie mit ihr ins Bett.“
„Ich gehe prinzipiell mit keiner Frau ins Bett, die meine Tochter sein könnte“, entgegnete der Clownmann.
„Großartig, ein heiliger Clown, dem man ein Denkmal errichten sollte, und ein Arschloch, aus dessen Mund nur Scheiße kommt. Ihr seid ein wunderbares Team“, sagte ich und öffnete die Augen.
Die beiden Männer hatten sich zu mir gedreht, ich erhob mich von der Sitzbank und versuchte, meine Stimme nicht zittern zu lassen, als ich zu Hannes sagte: „Du bist ein Arschloch. Und man hat mich schon viel in meinem Leben genannt, aber Eintrittskarte? E-I-NT-R-I-T-T-S-K-A-R-T-E?“
Der Clown lehnte sich in seinem Stuhl zurück, verschränkte die Arme vor der Brust und musterte mich mit seinen Kohleaugen, die so dunkel waren, dass ich nicht sehen konnte, wo die Iris in die Pupille überging. Er hatte nichts Überhebliches oder Herablassendes, trotzdem war da etwas in seinem Blick, das mich mit voller Wucht erwischte. Es war das erste Mal, dass sich unsere Blicke trafen, und ich wusste sofort: Türkis wie das Karibische Meer, Gulasch mit Nudeln und 57 Jahre.
Ich verschränkte ebenfalls die Arme. „Schiebt euch eure Eintrittskarte in den Arsch!“
Dann griff ich nach einem der Kaffeebecher, die auf dem Tisch standen. Hannes zuckte zurück, aus Angst, ich würde ihm den Kaffee ins Gesicht schütten.
„Du kannst mir gar nicht so viel zahlen, dass ich für dich auch nur einen Finger krümmen würde“, lachte ich ihn aus und verließ polternd den Wohnwagen.
Draußen stürzte ich den lauwarmen Kaffee in einem Zug hinunter, zerdrückte den leeren Becher und schleuderte ihn auf den Boden. Ich riss die Tür des Wohnwagens erneut auf und brüllte: „Und ich bereue jedes einzelne verdammte Mal, das ich mit dir gefickt habe, Hannes Fischer.“
Das Geschrei der Kinder, die wie ein Mantra „FOXI! FOXI! FOXI!“ brüllten, begleitete mich, bis ich beim Taxistand angekommen war.
3.
Als ich am Montagmorgen, um eine halbe Stunde zu spät, dafür aber völlig nüchtern und halbwegs ausgeruht, den Gang zu meinem Hausdetektivbüro betrat, erwartete mich bereits meine Ladendiebin Nummer eins: Henriette. Sie stand neben einer kleinen leichenblassen Verkäuferin und redete hektisch auf sie ein.
„Gott sei Dank“, begrüßte mich die Verkäuferin und suchte das Weite, kaum hatte ich den Schlüssel ins Schloss gesteckt, um die Bürotür aufzusperren.
Henriette hielt mir eine aufgerissene Packung mit einem dunkelbraunen Spannleintuch vor die Nase. „Ich war damit schon draußen“, sagte sie vorwurfsvoll. „Wäre ich nicht zurückgekommen und hätte mich selber gestellt …“
„Bitte“, unterbrach ich sie, „nicht dieses Drama vor dem ersten Kaffee. Wir wissen doch beide, dass Sie hier sind, weil es am Samstag nicht so gelaufen ist wie immer.“
„Wer war überhaupt dieser Kerl?“ Sie knallte die Verpackung auf den Schreibtisch und setzte sich auf einen der Stühle, die für die erwischten Ladendiebe gedacht waren.
Ich überging ihre Frage nach Hannes und schaltete die Espressomaschine ein. Als ich die Kaffeedose aus dem kleinen Kühlschrank nahm, murmelte Henriette etwas, das ich nicht verstehen konnte. Aber ich fragte nicht nach, sondern fing an, den Siebträger vom alten Kaffeesud zu reinigen. Sie murmelte weiter, aber erst als sie laut „Diesmal gehe ich nicht wieder“ sagte, schenkte ich ihr Beachtung.
„Was haben Sie gesagt?“, fragte ich und folgte ihrem Zeigefinger, der auf einen der Monitore gerichtet war. Darauf ging Hannes Fischer gerade zielstrebig durch das Möbelhaus, direkt in Richtung meines Büros.
„Nein, diesmal werden Sie sicher nicht gehen“, ließ ich sie wissen. Keine fünf Sekunden später klopfte er an die Bürotür und öffnete sie, ohne eine Aufforderung bekommen zu haben.
Er beachtete Henriette nicht und sagte nur: „Ich muss mit dir reden, Lotta.“
„Bitte tu dir keinen Zwang an“, gab ich seelenruhig zurück, während ich vorgab, damit beschäftigt zu sein, die Espressomaschine weiter zu reinigen. Ich konnte mir nicht verkneifen hinzuzufügen: „Wenn dir mein verkorkster Anblick nicht zu unangenehm ist.“
Er öffnete den Mund, doch dann wandte er sich an Henriette: „Würden Sie uns ein paar Minuten alleine lassen?“
„Wird sie nicht“, fuhr ich scharf dazwischen.
„Nein, werde ich nicht“, bestätigte Henriette und nickte Hannes freundlich zu.
Er stemmte die Hände in die Seiten: „Was soll das alles, Lotta?“
„Ich weiß nicht, was du meinst? Sie ist eine Ladendiebin, und es ist mein Job, ihre Daten aufzunehmen. Und ich muss doch froh sein, dass ich einen Job habe, so verkorkst, wie ich bin.“
„Verdammt“, entfuhr es ihm so laut und wütend, dass Henriette vor Schreck ein Quieken entfuhr.
„Ich glaube, ich warte doch draußen“, flüsterte sie und erhob sich.
„Wagen Sie es ja nicht“, drohte ich ihr, worauf sie gehorsam und mit hochgezogenen Schultern wieder Platz nahm. Ihr Gesichtsausdruck war so verängstigt, dass es mich einen Moment irritierte.
„Lotta, bitte …“, drängte Hannes und griff nach meiner Hand. Ich entwand mich seinem Griff und stieß ihn von mir weg, worauf er sein Gesicht zu einer wütenden Fratze verzog und brüllte: „Verdammt, du machst mich wahnsinnig!“
„Nicht …“, schrie Henriette auf und begann plötzlich hysterisch zu wimmern. „Nicht, nicht, nicht schlagen …“, wiederholte sie kreischend und wiegte dabei rasch ihren Oberkörper vor und zurück, wie ein Pendel. Sofort war unser begonnener Streit erloschen, und Hannes stotterte: „Aber … ich hätte sie doch nicht …“
Henriette sprang von ihrem Sitz hoch, grinste Hannes mit weit aufgerissenen Augen an, dann hob sie ihre Arme über den Kopf und machte etwas, das wohl eine Pirouette sein sollte. Ich hatte sie noch nie so erlebt, und in diesem Moment kam mir der Gedanke, dass sie in einer Nervenheilanstalt lebte, nicht mehr abwegig vor.
„Lass uns draußen reden“, sagte ich zu Hannes und bereitete Henriette noch wortlos einen Kaffee zu, bevor ich ihm folgte.
„Also?“, fragte ich ihn und lehnte mich lässig gegen die Gangmauer.
„Es tut mir leid, was ich gestern gesagt habe“, sagte er, ohne mich anzusehen. „Ich habe es nicht so gemeint, ich war einfach wütend auf dich. Was heißt war – ich bin es noch immer! Scheiße, Lotta, was denkst du eigentlich von mir? Glaubst du, es ist mir leichtgefallen, zu dir zu kommen, nach allem, was zwischen uns passiert ist?“
„Hannes, hör auf mit dem Gesülze! Was soll denn groß ‚zwischen uns passiert‘ sein?“, äffte ich ihn nach.
Wie ein sich entzündendes Streichholz flammte der Zorn erneut in seinen Augen auf. „Du verarschst mich, oder?“