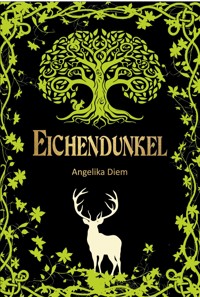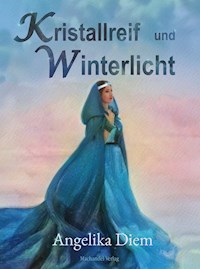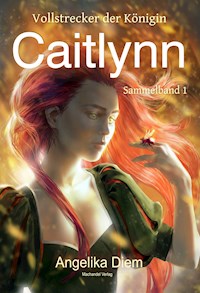Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Machandel Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Werde ich jemanden finden, bei dem ich beides sein kann, Mensch und Reh?" Rahel hat ein gut gehütetes Geheimnis: Sie kann sich in ein Reh verwandeln. Als sie trotz aller Vorsichtsmaßnahmen enttarnt wird, flieht Rahel aus ihrem Dorf und verdingt sich als Küchenhilfe am Königshof. Doch sie ahnt nicht, dass sie dort erst recht nicht im Verborgenen leben kann. Denn ihre außergewöhnliche Schönheit ist nicht unbemerkt geblieben: Rahel wird dazu auserkoren, an der Brautschau für den arroganten Prinzen Leonard teilzunehmen. Einfach märchenhafte Verwandlungen, finstere Intrigen und eine Liebe, die alles ändern könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Schattenthron I Das Mädchen mit den goldenen Augen
Angelika Diem
Märchenroman
Alle Personen sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen nicht beabsichtigt.
©Angelika Diem 2018
Erstauflage Oettinger Verlag
Coverdesign: Marie Braner
Alle Bilder von vimasi/depositphotos.com
ISBN 978-3-95959-458-5
Das Geheimnis
KÖNIGLICHER ERLASS ZUR
BRAUTSCHAU FÜR PRINZ LEONARD
Seine Majestät, König Gisir I., der Gütige und Gerechte, unumschränkter Herrscher des Reiches und Bewahrer des Friedens, veranstaltet in seiner Großzügigkeit Feste und Spiele aller Art im Vorfelde zur Feier des neunzehnten Jahrestages seines einzigen Sohnes und Erben, Prinz Leonard. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten wird seine Majestät König Gisir die zukünftige Gemahlin unseres Kronprinzen, und somit die zukünftige Königin des Reiches, erwählen. Zu diesem Zwecke mögen sich alle Jungfrauen des Königreichs zwischen sechzehn und achtzehn Jahren zwei Wochen vor dem achten Monde am Königsschloss einfinden, unbesehen ihrer Herkunft und ihres Standes, ob adelig oder bürgerlich. Eine vollständige Teilnahme wird erwartet.
Wenn das ein Scherz ist, dann wird jemand dafür hängen.
Ungläubig lese ich den Text ein zweites Mal. Doch, darunter prangt das offizielle Siegel des Königshauses aus schwarzem Wachs mit der glänzenden Krone in der Mitte. Ich trete ganz nah heran und fahre mit dem Finger über das Blattgold der Krone. Es ist echt. Kein Zweifel. Und so frisch, wie es aussieht, hängt das Plakat noch nicht lange da, auf der Bretterwand vor dem Dorfbrunnen.
Der Prinz … mir wird bewusst, dass ich noch nie ein Bild von ihm gesehen habe. Auf den wenigen Bildern in unseren Schulbüchern war immer nur König Gisir allein zu sehen: breit und kräftig, mit sehr hellen Haaren und einem leicht schiefen Kinn, in seinem goldenen Königsmantel. So habe ich ihn vor Augen.
Moment, ein Bild des Prinzen gibt es. Ich stelle meinen Korb hin, krame in meiner Schürzentasche und fische eine der kleinen Kupfermünzen heraus. Prinz Leonards Porträt ist daraufgeprägt, im Alter von drei Jahren. Weshalb gibt es nirgendwo Bilder der kompletten königlichen Familie? Auch von Königin Eugenia habe ich noch nie eins zu Gesicht bekommen. Solche Fragen stellt man hier am besten nicht laut. Was der König wünscht (oder nicht wünscht), wird nicht infrage gestellt. Das ist oberstes Gesetz. Für Ungehorsame und Tratschmäuler steht der Pranger gleich neben dem Galgen auf dem Hügel nördlich vom Dorf.
Also eine Brautschau. Dunkel erinnere ich mich, dass Mutter mir von einer solchen erzählt hat, damals, als König Enrik, der Befreier, eine Braut für seinen Sohn, unseren heutigen König Gisir, suchte. Zu jener Zeit durften natürlich nur Adelige teilnehmen. Und dieses Mal also alle. Weshalb sollte der König auch nur daran denken, seinen Sohn mit einem einfachen Dorfmädchen zu verheiraten? Da muss etwas anderes dahinterstecken, sicher nichts Gutes.
Dennoch … gedankenverloren blicke ich auf das schwarze Siegel. Vor meinen Augen erscheint das Königsschloss, ich male mir all die vornehm gekleideten Damen aus, wie sie dort stehen, in Samt und Seide gekleidet, kichernd und tuschelnd die Ankunft des Prinzen erwarten. Daneben sehe ich mich. In meinem geflickten Rock und der Bluse mit den zu kurzen Ärmeln und den Holzpantoffeln. Meine langen rotbraunen Haare zu einem schlichten Zopf geflochten, statt zu einem juwelengeschmückten Lockenturm hochgesteckt. Und da kommt er, eine schattenhafte Gestalt, fast so groß wie Vater, die goldene Krone des Siegels ziert sein Haupt. Die Damen halten die Luft an, klimpern mit den Wimpern, doch er geht an all diesen aufgeputzten Schönheiten vorbei, bleibt vor mir stehen, reicht mir die Hand und führt mich zum Tanz.
Ich seufze und schüttele den Kopf. Woher kommt dieser Blödsinn denn auf einmal? So etwas passiert vielleicht im Märchen, aber sicher nicht im wahren Leben. In meinem Leben. Wie auch? Nein, ich bin nicht auf der Suche. Nicht nach einem Mann, geschweige denn nach einem Prinzen. Vor allem nicht nach dem Sohn des Schattenkönigs, wie wir den König im Geheimen zu nennen pflegen. Gütig und gerecht? Von wegen! Und sein Sohn wird kaum besser sein.
In diesem Moment sehe ich Severin und seine Gesellen aus dem Heilerhaus kommen. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ich bin ohnehin schon zu spät dran. Noch haben sie mich nicht entdeckt. Ich halte instinktiv die Luft an, schnappe meinen Korb und laufe über den Platz zum Seiteneingang des Wirtshauses ,Zum Fetten Ochsen‘. Geschafft. Dieses Mal bin ich entkommen. Mein Atem beruhigt sich langsam wieder.
Kaum stoße ich die Türe auf, empfängt mich Meister Herkant.
»Gut, dass du da bist.« Die kurzen grauen Haare um sein rundes Gesicht glänzen vor Schweiß. »An die Arbeit! Alles wie gestern. Die Säcke mit den Karotten stehen beim Bottich, und die Zwiebeln sind in der Kiste.«
Ich stelle meinen Korb in die Ecke neben dem Tisch, binde die Schürze um, kremple die Ärmel hoch und greife nach der ersten Karotte.
Doch bevor ich noch das Messer ansetzen kann, spüre ich den Luftzug einer Bewegung hinter meiner linken Schulter und zucke unwillkürlich zusammen.
»Hallo, meine Schöne«, säuselt eine mir nur zu gut bekannte Stimme. Jerome.
Gleichzeitig knallt ein armlanger, blutiger Kadaver neben meinem Schneidebrett auf den Holztisch. Ein Kitz. Die Beine zusammengeschnürt, ausgeweidet, gehäutet bis auf den Kopf, starrt es mich aus leeren Augen an. Ich lasse das Messer fallen, verschlucke mich und huste. Rasch drehe ich mich weg vom Tisch und blicke geradewegs in Jeromes grinsendes Gesicht. Er steht so nah vor mir, dass ich die gelblichen Flecken auf seinen Zähnen zählen kann. Das helle Leinenhemd unter seiner braunen Weste hat er fast bis zur Mitte aufgeknöpft, sodass die blonden Brusthaare hervorquellen. Seine Augen saugen sich an der Stelle fest, wo die alte Bluse meiner Mutter sich über meinen Brüsten spannt. Mir schießt das Blut in die Wangen, instinktiv verschränke ich die Arme und funkle ihn wütend an, was ihn jedoch kein bisschen aus der Fassung bringt.
»Ich habe noch zwei davon erlegt. Ganz zartes Fleisch. Ich lade dich gern auf einen Bissen ein und auf ein Glas Rotwein dazu. Bei mir zu Hause, heute Abend?«
Es ist nicht das erste Mal, dass er solche Sprüche klopft. Das Angebot ist etwa so verlockend wie das blutige Tier neben meinen Karotten.
»Du bist doch mit Helene zusammen«, erinnere ich ihn.
Jerome macht eine wegwerfende Handbewegung. »Schon seit Tagen nicht mehr. Viel zu anstrengend. Du bist da ganz anders, mit dir könnte ich es glatt ein Leben lang aushalten, meine Schöne.«
Das sind neue Töne, und sie gefallen mir gar nicht. »Das meinst du nicht ernst, oder?«
Jerome reibt sich die kaum sichtbaren Brauen. »Rahel, Rahel … ich weiß, die Vorstellung, dass der beste und schönste Jäger der Grafschaft sich in eine Küchenmagd und Holzfällertochter verliebt, ist schwer zu begreifen.« Er legt eine Hand auf seine Brust. »Ich bin selbst überrascht, wie sehr du mein Herz bewegst.«
Hat er etwa ernsthafte Absichten? Das ist doch lachhaft. Lachhaft und gruselig gleichermaßen. Auf seine Art ist Jerome nicht weniger grausam als Severin. Ich hole tief Luft. Keine gute Idee. Sogleich steigt mir der Geruch von dem toten Kitz in die Nase. Es ist nicht nur das rohe Fleisch, ich rieche darin auch Tod, Verlust und Schmerz. Armes Kleines. Ob seine Mutter noch nach ihm sucht? »Jetzt bist du sprachlos, nicht wahr?«, deutet er mein Schweigen völlig falsch.
Ich kämpfe die Übelkeit nieder und zwinge mich, ihm direkt in die Augen zu schauen. Hatten sie schon immer diesen stumpfen Blick? »Jerome, ich kann dich nicht ausstehen. Such dir eine andere!« Das sollte deutlich genug sein.
Er wird nicht einmal wütend. Ganz nah tritt er an mich heran.
»Die Rosen mit den längsten Stacheln begehren am meisten, von starker Hand gepflückt zu werden.«
Wo hat er das denn her? Seine klobige Hand greift nach mir, an seinen Fingern klebt noch Blut. Entsetzt weiche ich zurück, bis ich mit der Hüfte so heftig gegen die Tischkante stoße, dass die Schüsseln aneinanderschlagen.
Meister Herkant drüben am Herd fährt herum. »Jerome, was machst du schon hier um diese Zeit?«
»Das hier bringen, Meister.« Mit einer lässigen Bewegung schnappt sich Jerome das Kitz vom Tisch und zeigt es ihm.
Der Meister runzelt die Stirn. »Ich hab keines bestellt. Und was hast du bei Rahel zu suchen?«
»Nur ein Pläuschchen mit meiner Zukünftigen.« Jerome legt den Arm um meine Schulter.
Ich reiße mich los, flüchte auf die andere Seite des Tisches. »Das … das stimmt nicht!« Im Stillen verfluche ich mein Gestammel, zwinge mich, Ruhe zu bewahren, und setze ein betont kühles Gesicht auf. Es ist der Ausdruck, den meine Mutter macht, wenn jemand auf dem Markt ihr gegenüber unverschämt wird oder sie übers Ohr hauen will. Zumindest hoffe ich, dass es dem irgendwie nahekommt.
»Jerome, wärst du so freundlich, mich jetzt in Ruhe zu lassen?« Ich greife nach dem Messer. »Ich habe zu tun.«
Meister Herkant verschränkt die Arme vor der Brust. Er reicht Jerome nur bis zu den Ohren, doch seine Stimme lässt keine Zweifel daran, wer hier das Sagen hat. »Du hast sie gehört, Jerome. Das Kitz kannst du in den Keller hängen. Der Wirt soll dir zwölf Silber dafür geben. Aber das nächste Mal nur auf Bestellung, hörst du? Und von Rahel lass gefälligst die Finger. Die ist viel zu gut für dich!«
Die drei jungen Hilfsköche auf der anderen Seite der Küche lachen. Jerome schiebt seinen kantigen Kiefer vor. Ich kann die Ader an seiner Schläfe pochen sehen.
»Das war nicht das letzte Wort, hörst du«, quetscht er drohend zwischen den Zähnen hervor, drückt die Schultern nach unten und stolziert aus der Küche, ohne Meister Herkant oder die anderen eines weiteren Blickes zu würdigen.
Ich lege das Messer hin. Der Tisch ist mit Blut beschmiert, und der Geruch nach Tod hängt in der Luft. Es ist noch nicht ausgestanden. Ich muss unbedingt verhindern, ihm allein zu begegnen.
»Hier!« Meister Herkant reicht mir ein feuchtes Tuch. »Tut mir leid, dass ich ihn nicht habe kommen hören. Verdammter Schleicher. Alles in Ordnung bei dir?«
Ich wische die Blutspritzer vom Tisch und zwinge ein Lächeln auf mein Gesicht. »Er kann mir nichts anhaben«, entgegne ich. Zumindest nicht hier.
Meister Herkant nickt und wendet sich erneut seinen Töpfen zu. Ich werfe das Tuch in den Putzeimer und reibe mir die Unterarme, während mir kalte Schauer über den Rücken laufen.
Ausgerechnet ein Reh!
Ich bemühe mich, ruhig zu atmen, nehme das Messer und beuge mich tiefer über die halbe Zwiebel. Grübeln bringt nichts. Ich werde künftig einfach noch vorsichtiger sein müssen.
Am Nachmittag, ich packe gerade die Schürze in den Korb, hämmert es plötzlich an die Hintertür.
»Dörfler zum Richthügel! Dörfler zum Richthügel!«, brüllt eine raue Stimme. Alle in der Küche zucken zusammen, mich eingeschlossen.
»Aber es hieß, erst in drei Tagen …«, platzt einer der Hilfsköche heraus, und mein eigenes Entsetzen spiegelt sich in seinen Augen wider.
Meister Herkant nickt düster. »Das ist ihre Art, uns zu zeigen, dass sie mit uns machen können, was sie wollen.« Er rammt das Messer in den Rindsrücken, der vor ihm liegt. Seine Lippen bewegen sich, ohne dass jemand hören kann, was er sagt, doch es ist nicht schwer, die Worte zu erraten: »Verdammte Mörder!«
Er atmet tief durch, zieht das Messer heraus und legt es auf das Brett. Seine Blicke wandern zu mir, er legt mir seine warme Hand auf die Schulter.
»Bleib einfach dicht neben mir.«
Mit zittrigen Fingern packe ich den Griff des Korbes und versuche mich an einem Lächeln, es misslingt jedoch.
»Wenn wir nur etwas tun könnten …«, flüstere ich. »Die arme Heidrun, die Kinder …« In meinem Magen liegt ein schwerer, kalter Stein. Herkant schaut kurz zum Fenster, sein Gesicht eine Maske grimmiger Entschlossenheit.
»Wir können etwas tun. Danach.«
Ich weiß, sie haben im Dorfrat abgesprochen, wer die drei ältesten Kinder bei sich aufnehmen kann, damit Heidrun sich und die zwei jüngsten durchbringen kann. Nur wird das nicht genug sein, sagt mein Gefühl. Nicht, wenn sie wirklich zusehen müssen, so wie es der Richter im Prozess angeordnet hat.
Wir bleiben alle eng zusammen, als wir die Küche verlassen. Das ganze Dorf ist unterwegs. Bis auf die Schwerkranken. Alle anderen müssen dabei sein, es sei denn, man steht gut mit den Soldaten und dem Richter. So wie Hertha, die Apothekerin, mit ihrem Mann Conrad, unserem Dorfheiler, und auch Jerome, der liebste Trinkkumpan des Hauptmanns. Severin könnte bestimmt ebenfalls zu Hause bleiben, aber er steht schon begierig in erster Reihe vor dem Galgen, seine Bande wie immer dicht um sich geschart. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn ich ihnen heute hätte entgehen können. Jerome hatte ich ebenfalls erwartet, doch ich kann ihn nicht entdecken. Merkwürdig, normalerweise lässt er sich keine öffentliche Bestrafung entgehen. Umso besser. Ich blicke mich weiter um, bis ich meine Eltern entdecke. Vater steht bei den anderen Holzfällern und den Leuten aus dem Sägewerk, Mutter bei den Frauen und größeren Kindern aus der Siedlung. Unsere Blicke treffen sich. Mutter sieht mich fragend an, Sorgenfalten auf der Stirn.
‚Ich halte durch‘, schicke ich ihr als stumme Botschaft mit einem Lächeln hinüber und nicke Vater zu. Und genau das habe ich vor. Wie alle hier. Für Heidrun, die Frau von Ulbert, dem verurteilten Köhler, der in dem kleinen Schuppen hinter dem Galgen warten muss, bis alle versammelt sind. Und vor allem für ihre Kinder.
Einer der Soldaten steht vor der Tür Wache, damit niemand auf dumme Gedanken kommt. Um und unter dem Galgen ist das Gras deutlich dunkler als auf dem Rest des Hügels. Dort wachsen die schönsten der gelben Löwenmäulchen, die sich in dieser Größe nur hier finden. Gerdas Blumen, nennen wir sie im Dorf. König Enriks Rachefeldzug nach der Ermordung der Königin hat damals auch vor unserem Dorf nicht haltgemacht. Gerda, eine wunderliche alte Frau, die von sich behauptete, dass sie mit Tieren sprechen und kranke Bäume gesunden lassen könne, wurde genau an dieser Stelle, wo jetzt der Galgen steht, vor aller Augen verbrannt. Auch König Gisir hält an der Jagd auf Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten fest. Eine offizielle Aufhebung des Gesetzes gegen die »Königsfeinde« gab es nie. Wobei damit außergewöhnliche Fähigkeiten ebenso gemeint sein können wie Widerspruch gegen die Krone oder deren Amtsträger.
»Zur Seite!«, erklingt es hinter uns.
Vier Soldaten führen Heidrun und die Kinder in die erste Reihe. Ausgerechnet dorthin, wo Severin und seine Freunde sich aufgebaut haben. Heidrun trägt bereits Witwenschwarz, ihr Gesicht ist bleich, doch ihre rot geschwollenen Augen blicken starr geradeaus. Den fünf Kindern hat sie schwarze Bänder um die Oberarme gebunden, und beim Blick in ihre blassen, verweinten Gesichter zieht sich mir das Herz zusammen. Die vier Jungs stehen dicht gedrängt bei ihrer Mutter. Einzig Sophie, mit zwölf Jahren die Älteste, hält einen halben Schritt Abstand, den Kopf gesenkt, die Arme um den Oberkörper geschlungen. Ich kann ihre Trauer und Verzweiflung fast körperlich spüren. Auch wenn es das Kommende nicht zu ändern vermag, würde ich sie am liebsten in die Arme nehmen und fest an mich drücken, doch zwischen uns stehen zwei Reihen Dörfler, Schulter an Schulter. Schweigend, wie wir alle.
Auf die Familie folgt der Richter in seinem tiefroten Mantel und dem schwarzen Hut, eine Schriftrolle unter dem Arm, eskortiert von zwei weiteren Soldaten. Er erklimmt als Erster den Galgen, zerrt am Strick, prüft die Schlinge. Dann huschen seine Augen über die Versammelten, als hake er in Gedanken eine Liste ab. Um mich herum spüre ich sowohl dumpfe Resignation als auch blanken Hass. Nicht wenige würden gern ihm selbst die Schlinge um den Hals legen. Der Richter meidet es, auf Heidrun und die Kinder zu blicken, stattdessen dreht er ihnen den Rücken zu und gibt dem Soldaten vor dem Schuppen ein Zeichen. Der öffnet die Tür, und zwei weitere Soldaten, einer davon der Hauptmann, zerren Ulbert heraus. Sie haben ihm die Arme auf dem Rücken festgebunden. Sein Gesicht ist voll blauer und grüner Flecken, ein Auge ist komplett zugeschwollen. Als er Heidrun und die Kinder erblickt, ruft er erstickt ihre Namen, reißt sich los und stolpert fahrig auf sie zu.
Noch ehe die Soldaten ihn eingeholt haben, hat Severin sich vor Ulbert aufgebaut und stellt ihm ein Bein, sodass er mit dem Gesicht voran zu Boden fällt. Grinsend tritt er ihm in die Seite, und seine widerwärtigen Kumpane grölen auch noch, als Ulbert schmerzerfüllt aufschreit. Ich balle die Hände zu Fäusten. Weshalb hilft ihm keiner? Eine Hand legt sich auf meinen Arm. Als ich hochblicke, sehe ich in Meister Herkants ernstes Gesicht. Er schüttelt den Kopf. Erst jetzt merke ich, dass ich einen halben Schritt nach vorn gemacht habe. Herkant deutet mit dem Kinn auf den Richter, der nicht auf Ulbert, sondern auf uns Zuschauer blickt. Ich senke den Kopf und presse die Zähne zusammen.
»Nein! Nicht!« Sophie will zu ihrem Vater laufen, doch ihre Mutter packt sie am Handgelenk und zieht sie zu sich.
Severin lacht und tritt noch einmal zu. Ulbert krümmt sich ächzend am Boden, dann zerren die Soldaten ihn in die Höhe.
Seine Nase steht merkwürdig schief, Blut läuft heraus und tropft auf den braunen, sackartigen Kittel, in den sie ihn gesteckt haben. Als sein Kopf und seine Schultern kraftlos herabsinken und er sich ohne Gegenwehr zum Galgen schleppen lässt, begreife ich, dass sie nicht nur seine Nase gebrochen haben. Von dem lustigen, herzensguten Mann, den ich kannte, ist nichts mehr übrig geblieben. Mit aller Macht dränge ich die Tränen zurück, während die Soldaten ihn die Treppe hinaufschleifen, bis er vor dem Richter steht. Seine Kraft ist gebrochen, so wie seine Hoffnung. Er wehrt sich nicht länger, als sie ihn zum Galgen schleppen, die Treppe hochzerren, bis er vor dem Richter steht. Es zerreißt mich innerlich, ihn so zu sehen und nichts tun zu können. Er hat immer so gern gesungen, besonders nach einem Humpen im ,Ochsen‘, zusammen mit den anderen Köhlern. Auch an dem unglückseligen Abend vor sechs Wochen, als Sophie ihn holen kam und der besoffene Hauptmann sie abgefangen hat. Und jetzt … jetzt ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Nicht mal das. Ein gebrochener Schatten.
Der Richter entrollt das Blatt Papier mit dem Urteil.
»Ulbert, Köhler in Weißrosen. Du hast einen Soldaten Seiner Majestät angegriffen und schwer verletzt.«
Schwer verletzt? Er hatte nur eine kleine Beule und ein blaues Auge. Hätte er einfach seine schmierigen Finger von Sophie gelassen, wäre nichts geschehen. Die Gesichter rings um uns werden grimmiger und härter.
Der Richter scheint es zu spüren, so wie er den Bogen fester packt und nach seinen Soldaten schielt, die einen losen Kreis um den Galgen gebildet haben und deren Hände locker auf den Knäufen ihrer Schwerter liegen. Dabei würde sowieso niemand hier und jetzt einen Aufstand wagen, nicht mit den Kindern, den Alten und all den Frauen in der Menge. Noch dazu völlig unbewaffnet.
Der Richter senkt seinen Blick wieder auf das Papier in seinen Händen.
»Ulbert, du wurdest als Königsfeind verurteilt, zum Tod durch den Strang. Siebzehn Tage diene dein Körper als Mahnung für jeden, der Hand oder Wort gegen Seine Majestät König Gisir I., den Gütigen und Gerechten, oder gegen dessen Vertreter erhebt.«
Ich muss schlucken. Siebzehn Tage und das bei der Hitze, jetzt, so kurz nach dem sechsten Mond. Noch nicht einmal im Tod lassen sie ihm seine Würde. Es werden auch nicht die Soldaten sein, die seinen Leichnam losschneiden und in ein Tuch schlagen, um ihn zum Aschenfels zu tragen, wo wir unsere Toten verbrennen. Ich bin so wütend, dass ich zu zittern beginne. Der Stein in mir hat sich in ein loderndes Feuer verwandelt, und in meinen Augen sammeln sich heiße Zornestränen.
»Hauptmann, vollzieht das Urteil!«
Einer der Soldaten hält Ulbert am Arm gepackt, während der Hauptmann ihm die Schlinge über den Kopf schiebt und festzieht. Ein letztes Mal hebt Ulbert den Kopf. Sein gutes Auge blickt geradeaus, über unsere Köpfe hinweg, so als sehe er etwas in der Ferne. Ohne dass ich es verhindern kann, klammert sich meine Hand an Meister Herkants Unterarm.
Der Hauptmann selbst greift zum Hebel, um die Klappe zu öffnen. Alle halten den Atem an.
Ich kann nicht hinschauen und schließe im letzten Moment die Augen, höre jedoch den Ruck und das Knacken, spüre, wie Ulberts Fühlen, sein Leben erlischt.
Heidrun ist in die Knie gegangen und hat die Arme um ihre weinenden Kinder geschlungen, auch um Sophie, die ihren toten Vater wimmernd und schluchzend um Verzeihung bittet.
Wir anderen schweigen. Kurz sehe ich zum Galgen, nur um gleich darauf den Kopf wegzudrehen. Zu furchtbar ist der Anblick.
Dabei fällt mein Blick auf Severin, der auf den Galgen starrt, ein breites Grinsen im Gesicht. Ein kalter Schauer läuft mir über den Rücken, als ich seine Gier nach mehr Nervenkitzel dieser Art spüre, wie ein dunkles Tier, das in seinem Inneren lauert und nur auf das passende Opfer wartet. Er tritt vor und streckt seine Faust in den Himmel. »Nieder mit den Königsfeinden! Ein Hoch auf Seine Majestät König Gisir und seine Gerechtigkeit!«
Die Soldaten, der Richter und einige der Jugendlichen stimmen mit ein. Auch Heidrun. Sie hat sich aus der Umklammerung der Kinder gelöst, schaut dem Richter direkt ins Gesicht und wiederholt den Ruf.
Mir steigen die Tränen in die Augen, weil ich fühlen kann, wie viel es sie kostet. Die Kleinen sprechen brav mit, selbst Sophie, und nach und nach fallen wir alle mit ein.
Severin und seine Speichellecker ziehen lange Gesichter, enttäuscht, dass sich niemand verweigert hat und verhaftet werden kann.
Auch als der Richter verkündet, dass wir entlassen sind, bleiben wir alle an Ort und Stelle. Heidrun ist noch nicht bereit zu gehen, und wir werden sie ganz sicher nicht alleine hier zurücklassen. Immer wieder blickt sie zum Galgen, als wolle sie nicht glauben, dass ihr Ulbert da hängt. Niemand wagt es, sie anzusprechen. Die Soldaten und der Richter haben sich vor dem Galgen versammelt und kehren der Familie den Rücken zu, während sie leise miteinander sprechen.
Ich löse mich von Meister Herkant und dränge mich durch die Leute, bis ich neben Heidrun stehe. »Heidrun …« Sie sieht mich an. Ich bücke mich und pflücke eines der gelben Löwenmäulchen. Mit zitternden Fingern stecke ich den Stängel durch ein Knopfloch meiner Bluse.
»Wir werden nicht vergessen.« Mehr brauche ich nicht zu sagen. Sie schließt kurz die Augen und nickt.
»Danke.«
Links und rechts von uns bücken sich die Menschen plötzlich ebenfalls nach den Löwenmäulchen. Heidrun sieht es und beginnt zu weinen. Die alte Amalia steht plötzlich neben mir. Auch sie trägt ein Löwenmäulchen und nimmt Heidrun in die Arme.
»Komm«, sagt sie sanft. »Wir gehen.« Der Krämer und seine Frau stoßen dazu, und zu dritt lotsen sie Ulberts Familie in Richtung Dorf.
Ich halte nach meinen Eltern Ausschau, da richten sich die Härchen an meinem Nacken auf, und ich spüre ein Brennen zwischen den Schulterblättern. Rasch werfe ich einen Blick über meine Schulter. Severin hat sich zu den Soldaten und dem Richter gesellt, redet auf diesen ein und zeigt dabei in meine Richtung. Mir ist, als drücke eine kalte Hand mein Herz zusammen. Ich fröstle. Meine Finger tasten nach dem Knopfloch. Die gelbe Blüte ist noch da.
»Das war verdammt leichtsinnig«, höre ich Meister Herkants Stimme hinter mir.
»Es ist doch nur eine Blume«, sage ich mit schwacher Stimme.
»Und sie hat dich möglicherweise auf die schwarze Liste des Richters gebracht.« Er stellt sich neben mich, nimmt mich am Arm und zieht mich mit sich.
Das ist doch lächerlich!, will ich einwenden, doch ich bekomme kein Wort heraus. Noch immer fühle ich die kalten Blicke in meinem Rücken.
»Sieh zu, dass du dem Richter aus den Augen kommst«, murmelt Meister Herkant. »Nicht dass er noch denkt, du sammelst die Leute um dich.«
»Ich … ich nehme den Weg durch den Wald«, stammle ich, während wir uns den ersten Häusern nähern.
»Gut. Ich werde es deinen Eltern sagen«, erwidert er und nimmt die Hand von meinem Arm. »Jetzt lauf!«
Und genau das tue ich.
Hier werden sie mich nicht finden. Hier, das ist meine ganz besondere Lichtung im Wald. Der ideale Platz, die Hinrichtung weit weg zu schieben und meine Gedanken auf anderes zu lenken. Dinge, die, verglichen mit den Geschehnissen auf dem Richterhügel, plötzlich weit weniger wichtig erscheinen, so wie Jeromes Aufdringlichkeiten in der Küche heute. Dennoch kocht bei dem Gedanken an ihn erneut Ärger in mir hoch. Nicht nur gegen Jerome, sondern auch gegen mich selbst. Warum habe ich ihm nicht deutlicher gezeigt, dass ich nie im Leben seine Freundin oder gar Frau sein werde? Lieber lasse ich mich in den Kerker sperren. Zugleich bekomme ich eine Gänsehaut, obwohl ich in der Sommersonne liege. Sprüche hat Jerome immer gern gerissen, schon als wir noch Kinder waren, er zwei Klassen über mir in der Dorfschule. Genau wie Severin.
Mich überfällt der Wunsch, die Zeit zurückdrehen zu können. Denn diese Tage sind lange vorbei. Ich weiß nicht, wie viele Male ich mich schon gefragt habe, was genau Jerome zu einem grausamen Tiermörder und Severin zu einem Menschenquäler werden ließ. Sicher, die Zeiten sind für uns alle viel härter geworden. Jedes Mal, wenn die Steuereintreiber durch das Land ziehen, stehen wir hilflos daneben, wenn sie immer mehr von unserer Ernte aus Scheunen, Kellern und Vorratskammern schleppen, und kratzen zähneknirschend unsere mühsam angesparten Silbermünzen zusammen, um sie in die schweren Truhen zu werfen. Wer nicht zahlen kann, wird ausgepeitscht. Wenn er Glück hat. Andere verlieren Haus und Vieh und müssen sich als Tagelöhner oder Bettler durchschlagen. Wer Einspruch erhebt oder sich wehrt, dem droht der Strick. So wie Ulbert.
Erneut sehe ich sein Gesicht vor mir, mit dem halb offenen Mund und dem milchigen, leeren Auge, das über uns hinweg in die Ferne starrt. Schaudernd wende ich mich zu den Heckenrosen und atme tief ihren Duft ein.
Vater meint, früher hätte es so etwas nicht gegeben, damals, bevor uns König Enrik befreit hat. Doch das sagt er nur, wenn wir allein sind, Mutter, er und ich. In den Geschichtsbüchern steht es anders, aber die beginnen ja erst mit König Enriks glorreichem Kampf um den Rosenthron.
Ich zupfe gedankenverloren eine Erdbeere vom Stiel und kehre zu Severin und Jerome zurück. Weshalb nur haben sie sich mit den Soldaten verbrüdert, statt zu uns, zum Dorf zu halten? Sehen sie denn nicht, was König Gisirs Gerechtigkeit schon angerichtet hat? ‚Wie der König, so das Land‘, hat Meister Herkant erst vor zehn Tagen vor sich hin gemurmelt, als auf dem Markt keine einzige Zwiebel ohne angefaultes Herz zu finden war.
Gedankenverloren zerdrücke ich eine weitere Erdbeere an meinem Gaumen. Langsam, damit ich den süßen Saft möglichst lange genießen kann. Wie jedes Mal, wenn ich verzweifelt, wütend oder traurig hier im Wald Zuflucht suche, wünsche ich, ich könnte bleiben. Im Moos liegen, die Sonne genießen, an nichts denken müssen und nur den Wald spüren. Pure Freiheit. Doch mehr als ein paar Atemzüge kann ich mir selten erlauben. Mutters Husten ist schlimmer geworden, und sie weigert sich immer noch, Hilfe zu suchen. Heiler Conrad würde ihr sicher Bettruhe verordnen und ihr eine Tinktur verschreiben, die wir uns doch nicht leisten können. Es reicht so schon kaum für die Heilsalbe für Vaters Rücken. Und wenn Mutters Verdienst für ihre Näh- und Stickkünste wegfällt, werden wir uns bald nur noch von dem ernähren können, was im Wald zu finden ist. Einen Winter könnten wir vielleicht überstehen, aber es würde nicht mehr für die Steuern reichen. Ich zwinge mich, den Kloß in meinem Hals hinunterzuschlucken. So weit wird es nicht kommen, schwöre ich mir im Stillen, und wenn ich mir die Hände blutig spinnen muss!
Von der Buche hinter mir stößt der Eichelhäher seinen rauen, krächzenden Ruf aus und holt mich vollends in die Gegenwart zurück. Es wird Zeit.
Während ich mich auf die Beine kämpfe, teilen sich plötzlich die Büsche, und ein mir nur zu gut bekanntes Reh tritt auf die Lichtung. Auf sie habe ich gewartet – Ricke. Den Namen habe ich ihr gegeben, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Vor rund drei Jahren schätze ich. Genau hier. Sie ist spät dran heute, zu spät, sodass uns keine gemeinsame Zeit mehr bleibt. Ricke bemerkt, dass ich schon aufbrechen will, da ich sie im Vorbeigehen nur kurz begrüße. Sie beginnt, wie ein Kitz zu fiepen, und sieht mich bettelnd an, doch heute geht es wirklich nicht mehr, leider. Ich werfe ihr noch einen bedauernden Blick zu, zwänge mich zwischen den Zweigen der jungen Fichten hindurch und mache mich auf den Heimweg.
Eine gespenstische Stille lag über dem Thronsaal. Selbst die Wachsoldaten in ihren blank polierten Rüstungen schienen den Atem anzuhalten, als Ivald vom Haushofmeister bis zu den Stufen am Kopfende des Saales geleitet wurde. Sir Bertold, sonst die steife Förmlichkeit in Person, unnahbar wie ein Klumpen Granit, trippelte über den goldfarbenen Teppich, statt zu stolzieren.
Beim Blick auf das Gesicht des Monarchen verstand Ivald Sir Bertolds Vorsicht nur allzu gut. Tiefe Falten hatten sich in Enriks Stirn gegraben, seine Mund war nicht mehr als ein schmaler Bogen, dessen Enden grimmig nach unten wiesen, und seine buschigen Brauen bildeten eine einzige Linie. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt stapfte er hinter den Lehnen der beiden Throne hin und her, als gelte es, mit seinen Ledersohlen Löcher in den Stein zu treten.
»Sire«, Sir Bertold räusperte sich und klopfte mit dem Zeremonienstab auf den Stein der ersten Treppenstufe. »Sire!«
»Was will Er?« Der König machte sich nicht die Mühe, den Kopf zu drehen. »Haben Wir Ihm nicht gesagt, dass Er alle Besucher abweisen möge? Ist Er nicht fähig, Unserem Wunsch Folge zu leisten?«
Bei jedem Wort sackten Sir Bertolds Schultern tiefer. »Sire, es ist Meister Ivald«, sagte er mit verzweifeltem Unterton. »Ihr hattet verlangt, dass er sofort zu Euch geführt würde.«
»Ivald!« Der König unterbrach seine Wanderung, schnellte herum und fixierte den Neuankömmling mit eisigem Blick. »Er ist tatsächlich zurückgekehrt.«
»Ich habe Euch mein Wort gegeben, Majestät«, entgegnete Ivald und verbeugte sich langsam, die Hände nach hinten gestreckt, um den Korb auf seinem Rücken festzuhalten. »Und hier bin ich, gerade rechtzeitig, um Euch zur Geburt Eures Sohnes zu gratulieren.«
»Rechtzeitig?« Der König spie das Wort förmlich in den Saal. »Rechtzeitig wäre bei seiner Geburt gewesen! Ehe die Unfähigkeit dieser elenden Stümper meine Königin die Gesundheit, ja vielleicht gar das Leben kostet.«
Enrik fuhr sich mit beiden Händen durch die ergraute Mähne. »Wenn ich sie zu Grabe tragen muss, wird das Kind ihr sicher bald folgen.« Die letzten Worte hingen wie ein Donnergrollen in der Luft, während sich der König an der Lehne seines Thrones abstützte, sein Gesicht eine aschgraue Maske.
»Mein König«, der Zwerg senkte den Kopf tiefer, um seine Betroffenheit kundzutun, »mein König, ich ahnte nicht … ich wusste nicht …« Die gelbbraunen Augen unter dem Gestrüpp seiner Brauen schossen hin und her, als ringe er mit sich selbst, wäge eines gegen das andere ab. Seine Hand zupfte an den braunen Bartzöpfen, während sein Unterkiefer nervös mahlte, vielleicht drei Atemzüge lang. Dann richtete er sich auf. »Mein König, lasst nicht alle Hoffnung fahren! Es könnte sein, dass mir auf meiner Reise etwas untergekommen ist, das die Königin zu retten vermag.«
»Die rote Wunderblume?« Mit neuer Kraft erfüllt, sprang der König die Stufen hinab und schloss seine Hand um Ivalds Oberarm. »Er hat die Blume aus den Legenden gefunden?«
»Nein, nein!« Ivald hob beschwichtigend die Arme und wand sich geschickt aus des Königs Griff. »Etwas anderes, unerprobt, ist es. Ein Wunder kann und will ich nicht versprechen. Gewährt mir einen Blick auf die Königin und Euren Erben, damit ich abwägen kann, ob ich zu helfen vermag.«
»Den soll Er haben und was immer Er sonst noch braucht.« Der König winkte einem Diener. »Er da, nehme Er Unserem gelehrten Gast das Gepäck ab!«
Der Angesprochene wieselte herbei und griff nach dem Korb auf Ivalds Rücken. »Lasst mich das für Euch tragen, Meister Ivald.«
»Rühr ihn nicht an!« Ivald drehte sich blitzschnell zur Seite und stieß die ausgestreckte Hand des Dieners rüde beiseite. Der sog erschrocken die Luft ein, und die Falten auf der Stirn des Königs vertieften sich, woraufhin sich Ivald räusperte und zu ihm sprach: »Mein König, vieles habe ich auf meiner Reise gesammelt und notiert. Wenn mir dort jemand Unordnung bereitet, finde ich am Ende gar das richtige Mittelchen nicht. Ich trage mein Eigentum daher lieber selbst.« Er packte die schwere Ledertasche.
Der König nickte und scheuchte den Diener mit einer Handbewegung zurück zu den anderen. »Genug! Er bekomme seinen Willen. Jetzt folge Er mir, es darf nicht noch mehr Zeit verstreichen!«
Mit langen Schritten durchmaß er den Thronsaal, stürmte in die Empfangshalle, die breite Treppenflucht hinauf, den Gang hinab, um eine Ecke, wieder ein langer Gang, dann um eine zweite Ecke. Ivald hatte alle Mühe, mit ihm Schritt zu halten.
Als er die mit Schnitzereien und goldenen Beschlägen verzierte Tür erreichte, hatte der König die beiden Wachsoldaten davor bereits angewiesen, diese zu öffnen. Das Gemach dahinter lag in dämmrigem Licht. Die weißen Leinenvorhänge vor den Fensterbögen flatterten leicht im Sommerwind. Der prachtvolle Baldachin über dem Himmelbett war gerafft und an die kunstvoll geschnitzten Bettpfosten geschnürt worden, sodass Ivald einen guten Blick auf die Königin werfen konnte.
Ihr verschwitztes rotes Gesicht hob sich deutlich von den blassblonden Haaren ab, die über die Kissen ausgebreitet worden waren. Ihr Atem ging schwer, und sie schien in unruhigen Schlaf gefallen zu sein. Rechts und links von ihr erhoben sich zwei in grüne Heilerroben gewandete Männer und verbeugten sich nun hastig vor dem König. Ihr weißes Haar und ihre Falten sprachen von Erfahrung, doch die Blicke, die sie tauschten, von Angst. Von Todesangst.
»Nun?« König Enrik stemmte die Hände in die Hüften und rückte mit der Rechten sein Schwert zurecht. »Hat Er Neuigkeiten für Uns?« Die Frage galt dem älteren der beiden Heiler.
Dieser klappte vor dem König zusammen, dass sein Bart den Boden streifte. Seine geflüsterten Worte waren kaum zu verstehen. »Majestät, wir haben getan, was wir konnten. Doch Kindbettfieber ist unheilbar.«
Enriks Hand legte sich um den Schwertgriff. »Was will Er Uns damit sagen? Spreche Er hörbar mit Uns!«
Die Stimme des Heilers bebte, als er den Kopf etwas anhob und mit kräftigerer Stimme antwortete. Dabei hielt er den Blick immer noch nicht auf den König, sondern auf den Boden vor ihm gerichtet: »Mein König, wir können nicht mehr für die Königin tun, als wir bereits getan haben. Entweder eine Frau überwindet das Geburtsgift aus eigener Kraft, oder es fordert ihr Leben. Es liegt nicht in andrer Menschen Hand.«
»Nicht in Seiner, meint Er wohl!«, donnerte der König. Mit einer unwilligen Geste entließ er den Heiler, welcher entkräftet und geknickt an die Seite seines Kollegen zurückschlich, der aussah, als müsse er sich gleich übergeben. Der König jedoch kümmerte sich nicht weiter um die beiden verängstigten Männer, sondern deutete Ivald, an seine Seite zu treten. »Unser Glück, dass der Gelehrte Ivald hier kein solcher Stümper ist wie Er. Er stammt vom edlen … wie war das noch?«
»Vom edlen ‚Volk unterm Berge‘«, half Ivald bereitwillig aus. »Mit Eurer Erlaubnis, Majestät.«
Schweigend deutete Enrik mit dem Kinn zum Podest. Ivald verbeugte sich und schritt zum Kopfteil der Bettstatt. »Ihr entschuldigt.« Er drängte sich an dem bärtigen Heiler vorbei, stellte die Ledertasche ab und beugte sich vorsichtig über das vor Fieber glühende Gesicht der Königin. Die Hand auf ihre Stirn gelegt, schloss er die Augen.
Die beiden Heiler wechselten einen ratlosen Blick.
»Mein König«, hob der bärtige an, »Herr Ivald mag ein belesener Mann vom … ähm … Unterberg sein, aber …«
»Ihr dürft mich auch ‚Zwerg‘ nennen, wenn Euch der Name meines Volkes die Zunge verknotet«, unterbrach ihn Ivald, ohne die Augen zu öffnen, »und ‚Meister Ivald‘ für Euch, wenn es genehm ist. Doch wenn Euch das Leben der Königin lieb ist, stört mich nicht mit Euren nichtigen Zweifeln.«
Ehe die Heiler protestieren konnten, befahl Enrik den beiden Wachen, sie aus dem Gemach zu entfernen. »Bewache Er sie gut! Sollte Unsere Gemahlin sterben, sind ihre Stricke schon geknüpft.«
Der Schultern der beiden Heiler sackten herab. Kreidebleich, die zitternden Hände tief in den weiten Ärmeln ihrer Roben vergraben, verließen sie unter dem Geleit der Wachen das Gemach. Währenddessen ließ Ivald den Korb von den Schultern gleiten und stellte ihn behutsam neben dem Podest auf den Boden.
»Kann Er helfen?« Die Stimme des Königs klang angespannt und rau.
»Das vermag ich noch nicht zu versprechen. Euer Sohn, mein König?«
»Dort im Erker.«
Ivalds Blick folgte der ausgestreckten Hand des Königs, bis er die geschnitzte Wiege gewahrte, welche halb hinter einem bunt bemalten Raumteiler verborgen war.
Wie auf ein Stichwort ertönte ein leises Wimmern aus der Wiege.
»Seine Amme?«
»Unsere Gemahlin wollte ihn selber nähren. Sie konnte ihn nur ein Mal an die Brust legen, ehe das Fieber kam. Seitdem hat er geschlafen. Wir werden nach einer Amme schicken lassen, wenn … wenn es nötig ist.« Der König räusperte sich.
Ivald sprang vom Podest und ging zur Wiege hinüber. Sinnend betrachtete er den Säugling, blickte dann erneut zur Königin und nickte. »Ich sehe Hoffnung.«
Die tiefen Furchen auf der Stirn des Königs milderten sich. »Dann handle Er!«
Ivald verbeugte sich in Richtung der offenen Türe.
»Wenn Ihr solange draußen warten würdet, Majestät. Die Behandlung verlangt, dass nichts das Gemüt der Kranken stört. Ganz sicher spürt und hört die Königin Eure Sorge um ihr Befinden.«
Die Zornesader an Enriks Stirn schwoll an, und für einen Wimpernschlag sah es so aus, als würde König Enrik endgültig die Beherrschung verlieren und den Zwerg umgehend in den Kerker werfen lassen. Doch mit einem Blick auf seine leidende Gattin riss er sich zusammen und nahm die Hand vom Schwertknauf. »Wenn Er dies für nötig erachtet. Doch hüte Er sich, mit Unserer Hoffnung zu spielen. Für einen dritten Strick finden Wir noch Platz.«
Mit diesen Worten stapfte er durch die Türe auf den Gang. Aus den Augenwinkeln sah er noch, wie Ivald zum Podest zurückkehrte und seine Ledertasche öffnete.
Draußen warteten die beiden Heiler in einer Nische, nur einen Schritt entfernt von den beiden Wachen, die sie grimmig beäugten.
»Wir sind des Todes«, seufzte der Jüngere leise. »Was weiß dieser sonderbare kleine Mann schon von der Heilkunst? Zwei Jahre ist es her, seitdem er seinen Bückling vor dem König gemacht hat, zwei Jahre mit der Nase vergraben im Staub der Bibliothek. Hat er je einen Körper von innen betrachtet? Sich in Alchemie versucht? Heilpflanzen studiert?«
»Psst!«, zischte der Ältere mit Blick auf den König, der vor der Tür hin und her marschierte. »Wenn die Königin stirbt, wird dieser ‚Meister Ivald‘ neben uns baumeln«, flüsterte er mit grimmigem Lächeln. »Ist dies auch kein Trost, so doch zumindest eine kleine Genugtuung.«
Die beiden versanken in bitterem Schweigen, während die Minuten verrannen wie Honig im Sand. Der Glockenschlag zur vollen Stunde erklang.
»Genug!«, grollte König Enrik und langte nach dem Türknauf.
In diesem Augenblick flog die Türe auf, und ein sichtlich erschöpfter Ivald verneigte sich vor ihm.
»Es ist vollbracht, Majestät.«
Der König stürmte an ihm vorbei zu seiner Gemahlin, die aufgerichtet im Bette saß, das Gesicht blass, doch die Augen klar.
»Mein Gemahl, habt Ihr schon Euren Stammhalter bewundert?«, fragte sie lächelnd.
Doch König Enrik hatte nur Blicke für seine Gemahlin, strich ihr die schweißfeuchten Haare aus der Stirn, und ein Lächeln breitete sich auch auf seinem Gesicht aus. Ivald jedoch schritt hinüber zur Wiege.
»Mir scheint, Euren Erstgeborenen verlangt es nach Nahrung, meine Königin«, sagte er, hob den in blaue Tücher gewickelten Säugling heraus und trug ihn zum Himmelbett hinüber, wo er ihn der Königin in die Arme legte.
»Ist er nicht wunderschön, unser Gisir?«, murmelte sie und strich über die hellen Härchen, die das gelbliche, verrunzelte Gesicht umgaben. Der König sah zu Ivald hinüber. »Ist es üblich, dass sie so gelb sind?«
»Die ersten Tage immer«, gab die Königin selbst die Antwort. »Meine Mutter hat mich schon beizeiten vorgewarnt. Doch das geht vorüber.«
Derweil hatte sich Ivald gebückt und seinen Korb wieder huckepack genommen. »Darf ich mich zurückziehen, mein König?«, fragte er und hob die Ledertasche vom Boden auf. »Mein Werk ist getan.«
»Was war es?«, verlangte der König zu wissen. »Was hatte die Macht, Unsere Königin zu retten? Hat Er mehr davon?«
Ivald rückte den Korb zurecht. »Es ist verbraucht, mein König. Es war ein uralter Heiltrank, der durch Zufall in meine Hände fiel. Doch da ich seine Rezeptur nicht kenne, kann ich kein weiteres Wunder damit wirken.«
Der König öffnete den Mund, um zu protestieren, doch seine Gattin fasste ihn am Arm. »Seien wir dankbar, Enrik. Dankbar und nicht gierig. Es gibt Mächte, die könnt selbst Ihr nicht herausfordern, mein Gemahl.«
Einige Atemzüge lang rang der König mit sich. Doch dann glätteten sich seine Züge. Langsam erhob er sich und nickte. »Ihm gebührt Dank«, sagte er zu Ivald. »Was ist Sein Begehr? Gold und Edelsteine? Eine Grafschaft? Was immer es ist, es sei Ihm gewährt.«
Ivald hob die Hände. »Nichts von alledem, mein König. Gewährt mir nur weiterhin, in der königlichen Bibliothek zu studieren und diese zu erweitern. Und«, er neigte den Kopf in Richtung der Königin und des Säuglings, »es wäre die allergrößte Ehre, wenn ich mein Wissen an Prinz Gisir weitergeben dürfte.«
Der König nickte. »Dieser Wunsch sei Ihm gewährt. Sobald Unser Sohn alt genug ist, eine Feder zu halten, sei Er sein Lehrmeister in allem, was aus Schriften gelernt werden kann.«
Ivald verbeugte sich noch tiefer. Dabei stieß der Korb hart gegen einen der Bettpfosten, was ihn jedoch nicht zu stören schien.
»Sind damit alle Seine Wünsche gewährt?«, fragte der König.
»Eure Großzügigkeit überwältigt mich, mein König«, murmelte Ivald und zog sich Schritt um Schritt zurück zur Tür. »Wenn ich noch um eines bitten dürfte?« Abwartend sah er den König an, der ihm jedoch mit einem Nicken befahl, weiterzusprechen.
»Die beiden Heiler, nehmt ihnen nicht das Leben. Unfähig, wie sie sind, gehören sie natürlich nicht an den Hof, vielleicht in ein Bauerndorf weit weg von Ruhm und Behaglichkeit?«
Der König stutzte kurz, dann warf er den Kopf in den Nacken und lachte. »Er überrascht Uns. Statt Gold für Ihn selbst erbittet Er Gnade ausgerechnet für diese beiden Schlangenzungen. Sein Wunsch gefällt Uns. Er sei gewährt! Nun gehe Er in den Thronsaal und lasse Er sich vom Haushofmeister neue Gemächer zuweisen, wie sie sich für den Lehrmeister des Prinzen geziemen.«
Mit einer letzten Verbeugung drehte sich Ivald um und hastete hinaus. Wenig später gab die Königin einen unterdrückten Schmerzenslaut von sich.
Sogleich beugte sich König Enrik über Mutter und Kind.
»Es ist nichts, mein Gemahl«, beruhigte ihn die Königin. »Nur, der Hunger Eures Sohnes übertrifft, was ich zu geben vermag.« Sie schloss ihr Nachtgewand. Sogleich begann der Prinz zu schreien. Sein runzeliges Gesicht war krebsrot angelaufen, und seine kleinen Fäuste hieben kraftvoll durch die Luft.
»Er hat Euer Temperament, wie mir scheint«, scherzte die Königin und schaukelte den Säugling in den Armen, um ihn zu beruhigen.
»Ich schicke nach einer Amme.« Enrik richtete sich auf.
»Besser nach zweien. Ich fürchte, ich werde ihn nicht lange nähren können. Wenn er so schnell wächst, wie er trinkt, wird er Euch bald überragen.«
Ein stolzes Lächeln spielte um des Königs Lippen, als er in den Gang trat, wo die beiden Heiler die Hände rangen und sich tief verbeugten, kaum dass sie seiner ansichtig wurden.
»Er da!« Enrik deutete auf einen der Wachsoldaten. »Begleite Er die beiden zu ihren Gemächern. Dort mögen sie auf Unser Urteil warten. Danach befrage Er das Gesinde, den Prinzen verlangt es nach der Milch zweier Ammen. Wer Uns diese heute noch beschaffen kann, wird mit Gold belohnt werden.« Den zweiten Soldaten hieß er, die Mitglieder des Thronrates zu wecken.
»Unsere Arbeit hat lange genug geruht. Es mögen sich alle umgehend in der großen Ratskammer einfinden. Wir haben noch längst nicht alle Getreuen und Günstlinge meines willensschwachen Vorgängers aus ihren Löchern getrieben. Die Jagd geht weiter.«
Gerade als ich aus dem Schatten des Waldes heraus auf den Karrenweg trete, ruft hinter mir eine wohlbekannte Stimme meinen Namen. »Rahel, bist du das?«
Kann das sein? Ich drehe mich um, und da, eine Kehre vor unserer Hütte, steht sie tatsächlich. Mitten auf dem Weg. Meine beste Freundin. Sie lächelt breit, sodass die Grübchen in ihren Wangen gut zu sehen sind. Lachend falle ich ihr in die Arme und drücke sie fest an mich. Giselas weiches Haar duftet nach Lavendel und Kamille. Wie sehr ich sie vermisst habe!
»Ich hatte ja keine Ahnung, dass du jetzt schon Ferien hast! Wie lange kannst du bleiben? Wie ist es dir ergangen? Ich freue mich so, dass du da bist!«, sprudelt es aus mir heraus. »Lass dich ansehen!« Rasch trete ich einen Schritt zurück, um sie besser betrachten zu können. Gisela lächelt und dreht sich im Kreis. Ihre kunstvoll eingedrehten, karamellbraunen Locken fliegen um ihr herzförmiges Gesicht. »Wie gefalle ich dir? Das Kleid ist unglaublich, oder?«, fragt sie, ein verschmitztes Funkeln in den goldbraunen Augen. »Tante Ella hat mir gleich fünf von den besten Schneidern in Sturmhafen nähen lassen.«
Das Kleid ist wirklich prachtvoll. Allein der Glanz des dunkelrosa Stoffes mit dem hellen Blattmuster, einfach wunderbar. Und sicher extrem teuer.
»Seidendamast?«, frage ich fast ehrfürchtig, und sie nickt. »Wie sehe ich aus?«, fragt sie.
»Du wirkst älter«, sage ich zögernd.
Und das liegt nicht nur an dem Kleid, dem tiefen Ausschnitt oder daran, dass sie mich inzwischen fast um eine Handbreite überragt. Ein breiter Streifen rosa Puder betont ihre Backenknochen, farblich perfekt abgestimmt auf den Stoff ihres Kleides, die Brauen hat sie mit Kohle nachgezogen und die Lippen mit himbeerfarbenem Balsam bemalt.
Das ist nicht mehr die Gisela, die ich kenne. Sie gleicht einer dieser reichen Kaufmannstöchter aus den Städten. Mir ist, als stünde eine völlig Fremde vor mir, eine, die sich nur zufällig in unser Dorf Weißrosen verirrt hat, aber gar nicht hierher gehört. Außerdem sterbe ich fast vor Neugier: »Erzähl, wie ist es in der Heilerschule?«
»Stinklangweilig, kann ich dir sagen.« Gisela verdreht genervt die Augen und lacht, als sie mein überraschtes Gesicht sieht. »Ob du’s glaubst oder nicht, es gibt nur Schülerinnen. Auch in diesem Jahr hat kein einziger männlicher Schüler die Aufnahmeprüfung geschafft. Die Lehrer sind allesamt Greise und so was von öde.«
Das hatte ich jetzt nicht erwartet.
»Hast du«, ich räuspere mich, »hast du denn gar nichts Neues lernen können? Keine Prüfungen gemacht und so? Neue Rezepte, die wir ausprobieren könnten?«
Sie winkt ab. »Nicht mehr von Bedeutung.« Ehe ich nachhaken kann, deutet sie auf den Korb, der neben ihr steht. Einige Brombeerblätter liegen darin, dicke Stoffhandschuhe und eine kleine Sichel.
»Mutter hat mich Kräuter sammeln geschickt. Ihr ist der Huflattich ausgegangen, die Schafgarbe und so weiter. Du kennst ja ihre lange Liste.« Sie stöhnt. »Gleich nach dem Nachmittagstee hat sie mich losgeschickt. Ich habe noch nicht mal alles auspacken dürfen.«
Wenigstens etwas, das sich nicht geändert hat. Bevor Gisela vor gut einem Jahr nach Sturmhafen zu ihrer Tante gezogen ist, haben wir zusammen mindestens einmal die Woche den Wald nach Kräutern abgesucht und auch sonst jede freie Minute miteinander verbracht, ohne dass sie es zu Hause erzählte. Als Holzfällertochter war ich ihrer Mutter Hertha, der Apothekerin, nie gut genug. Gisela durfte mich noch nicht einmal zum Tee einladen. Nicht dass es uns beide gestört hat, wir hatten ja den Wald, um ungestört zu träumen. Damals sahen wir uns schon beide in der eigenen Apotheke, die wir gemeinsam führen wollten. Gisela trieb mich an, allen Mut zusammenzunehmen und in meinem besten Kleid vor ihre Mutter zu treten, um sie zu fragen, ob sie mich ebenfalls ausbilden würde.
Herthas Worte brennen noch heute in mir. »Was soll ich mit einer Holzfällertochter? Du riechst nach Harz, hast ständig Dreck unter den Nägeln und willst in diesen Lumpen vor meine Kundschaft treten? Ich wette, du kannst dir nicht mal die Phiolen leisten oder eine Waage. Und wovon wollen deine Eltern die zehn Gold Lehrgeld pro Jahr bezahlen?«
Niemals zuvor habe ich mich so schäbig gefühlt. Ich schiebe die Erinnerung beiseite und wende mich wieder Gisela zu. »Bist du zum Kräutersammeln nicht viel zu fein angezogen?«, hake ich vorsichtig nach.
Sie zwinkert mir zu. »Das weiß ich doch. Aber ich musste dir dieses Kleid einfach zeigen.« Sie hebt den Rocksaum und zieht eine Grimasse. »Jetzt, wo du es sagst … Mutter bringt mich um, wenn ich voller Grasflecken heimkomme.«
»Soll ich dir helfen?« Sobald ich die Frage ausgesprochen habe, meldet sich mein schlechtes Gewissen. Ich müsste längst zu Hause sein. Doch da ist dieser bittende Blick in Giselas Augen, dem ich auch früher nur schwer widerstehen konnte. Ich werde heute einfach länger in die Nacht hinein arbeiten.
»Komm, wir gehen zu unserer Lichtung. Viel Zeit haben wir nicht, die Sonne geht gleich unter«, versuche ich Gisela zur Eile anzutreiben. Als ich mich nach dem Korb bücke, sehe ich aus den Augenwinkeln, wie sie mich mustert, meinen geflickten Rock, die Bluse, die mir zu etwas zu klein ist, und die Holzpantoffeln. Ist das Mitleid in ihrem Blick? Kaum sehe ich sie direkt an, lächelt sie wieder.
»Eine gute Idee. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen.«
Zusammen schlendern wir den Trampelpfad entlang. Während Gisela über das Leben in Sturmhafen plaudert, sich über ihre viel zu strenge Tante beschwert und an den anderen Schülerinnen der Heilerschule kein gutes Haar lässt, bücke ich mich alle paar Schritte nach Kräutern. Gisela hingegen greift nicht einmal nach der Sichel, obwohl sie die Kräuter genauso gut kennt wie ich, wenn nicht besser. Fast alles, was ich über Kräuter weiß, habe ich von ihr gelernt.
Als wir unsere kleine Lichtung nahe dem Waldweg erreichen, liegen schon einige Kräuterbündel im Korb. Ich streife mir die Handschuhe über und beginne Brennnesseln zu schneiden. »Wie kommst du mit Severin klar?«, frage ich wie beiläufig.
»Gar nicht. Ich habe ihn nur kurz gesehen, das hat gereicht« Gisela zuckt die Schultern. »Vater hätte ihn längst aus dem Haus jagen sollen, aber du kennst ja Mutter. Sie stellt sich jedes Mal aufs Neue vor ihren Liebling. Egal, was er angestellt hat. Nur gut, dass er in ein paar Wochen zum Militär muss. Vater hat ordentlich tief in die Tasche gegriffen, um alles auf der Ausrüstungsliste kaufen zu können. Das Beste ist gerade gut genug. Er sagt es nicht laut, aber ich glaube, er ist dankbar, dass der König dieses Jahr alle Jugendlichen in Severins Alter einberufen hat. So haben wir ein halbes Jahr lang Ruhe vor ihm.«
Das ist auch mein erster Gedanke gewesen, als ich Severins Namen auf der Liste der Einberufenen gelesen habe. Doch was, wenn er zurückkommt und sich sein Charakter nicht verändert hat? Wenn er Soldat bleibt, weil ihm das Töten so gefällt? Endet dann jeder, der sich im Dorf gegen ihn stellt, als ‚Königsfeind‘ am Galgen? Bei dem Gedanken wird mir ganz anders.
Ich streife die Handschuhe ab und reibe mir die Stirn. »Gisela …«, es fällt mir nicht leicht, die Frage zu stellen, auch wenn sie mir auf der Seele brennt, »Gisela, hast du meine Briefe bekommen?«
Sie schaut mich ein wenig schuldbewusst an. »Oh ja, stimmt. Tut mir echt leid, Rahel, ich hatte sooo schrecklich viel zu tun in den letzten Tagen.«
Den letzten Brief habe ich ihr vor drei Wochen geschrieben. Und schon davor hatte ich lange nichts mehr von ihr gehört. »Und hast du deine Mutter gefragt?«
Sie winkt ab. »Bei der dreht sich alles nur noch um Severin und seine Einberufung. Sie tut, als würde er direkt von zu Hause in die Schlacht ziehen. Dabei haben wir Frieden, seit König Enrik damals den Thronkampf gewonnen hat. Ich weiß ohnehin nicht, wozu dieser Erlass gut sein soll. Warum brauchen wir all diese Soldaten? Für die paar Kämpfe mit Rebellen oder Räuberbanden?« Sie zögert kurz, ehe sie mir einen entschuldigenden Blick zuwirft. »Mutter will noch immer den Platz für ihn freihalten. Falls er doch noch zur Vernunft kommt irgendwann.«
Ich lächle, obwohl mir danach eigentlich gar nicht ist. »Schon gut. Ich gebe nicht auf. Vielleicht überlegt es sich deine Mutter ja noch, wenn Severin auch nach dem Militärdienst nicht bei ihr lernen will. Und bis du fertige Heilerin bist …«
»Hast du den Aushang auf der schwarzen Wand nicht gesehen?«, unterbricht mich Gisela.
Ich nicke zögernd. »Das mit der Brautschau? Was hat das mit unseren Zukunftsplänen zu tun?«
Mit einem Schlag ist Giselas freundliches Lächeln wie weggewischt. Mit einer affektierten Bewegung wirft sie ihre Lockenmähne zurück und schürzt abfällig die Lippen. »Du meinst jetzt nicht wirklich diesen kindischen Traum von der Apotheke, oder? Vor dir steht Prinz Leonards künftige Braut!« Sie hebt einen Handrücken vor den Mund und lacht. Hart und heiser. »Glaubst du wirklich, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Leben in Luxus auf dem Schloss und einem Raum voller Dörfler mit Husten, Ausschlägen und eitrigen Geschwüren, würde ich das Zweite wählen?«
Ich nicke stumm. Genau das würde Gisela tun. Die Gisela, die ich bis eben noch glaubte so gut zu kennen, dass ich ihr alles anvertrauen kann. Nun ja, alles bis auf eins vielleicht. Doch diese Gisela hier … sie blickt mich plötzlich mit stechendem Blick an. Ein Blick, der mich erschreckend an Severins kalte Augen erinnert.
Aber so schnell gebe ich nicht auf. »König Gisir wird seinen Sohn niemals mit einem Dorfmädchen verheiraten, egal, was auf dem Plakat steht. Und selbst wenn, ist dir schon einmal aufgefallen, dass es nicht ein einziges Bild von Prinz Leonard in unseren Büchern gibt? Auch keine Anekdoten, keine Lieder, gar nichts. Wer weiß, vielleicht ist er genauso abstoßend und grausam wie sein Vater? Oder sogar schlimmer?«
Sie zuckt die Achseln. »Und wenn? Er ist der Prinz. Jedes Mädchen im Reich will ihn haben.«
»Ich nicht.«
Gisela mustert mich, als wäre ich ein Stück Dreck unter ihren Nägeln. »Ist auch besser so. Du wärst die absolute Witzfigur am Hof.«
Das lasse ich nicht auf mir sitzen. »Ach ja? Meine Manieren sind nicht schlechter als deine«, kontere ich.
»Was bildest du dir eigentlich ein, du … du Nichts!«, zischt sie und schürzt die Lippen. »Wie lange trägst du diesen Haufen Flicken schon? Zwei Jahre, drei? Willst du so etwa vor den Prinzen treten? Ganz zu schweigen davon, dass du keine Ahnung hast, welche Gabel man für welchen Gang benutzt, wie man einen Fächer richtig hält, wie man als Königin spricht und …« Dann lacht sie erneut. Höhnisch und kalt.