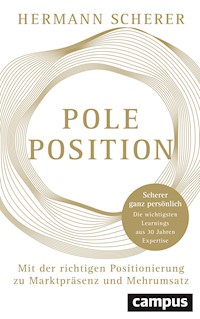Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Buch erhalten Sie das E-Book inklusive! Vielleicht sind Sie viel besser, als Sie denken. Vielleicht schlummern ungeahnte Schätze und Talente in Ihnen. Vielleicht sollten Sie einfach mal dieses Buch lesen, um es herauszufinden. Hermann Scherer zeigt Ihnen, wie Sie sich aus festgefahrenen Strukturen lösen und mehr aus Ihrem Leben machen. Es ist ganz einfach: Seien Sie anders als der Durchschnitt. Werden Sie Regelbrecher und geben Sie Ihrem Leben wieder mehr Lebendigkeit. Machen Sie gute Deals und tauschen Sie dabei das Wertvollste, was Sie haben: Ihre Zeit. Entwickeln Sie eine konkrete Vorstellung von sich in der Zukunft. Zum Beispiel so: Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem gemütlichen Sessel und lesen. Es ist das Buch "Schatzfinder" von Hermann Scherer. Sie lächeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:1 Std. 50 min
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sprecher:Sonngard DresslerHelmut WinkelmannOliver PreuscheAndreas LiebethalSteffen WilhelmMichael DecknerRegine Vergeen
Ähnliche
Hermann Scherer
SCHATZFINDER
Warum manche das Leben ihrer Träume suchen – und andere es längst leben
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Es gibt ein Leben vor dem Tod – nur leider verpassen es zu viele Menschen. Sie lassen ein durchschnittliches Leben geschehen, versäumen ihre besten Chancen und nehmen ihre Träume ungelebt mit ins Grab. Fast jeder Mensch träumt davon, ein erfülltes Leben zu führen, jemand Besonderes zu sein und Außergewöhnliches zu leisten. Aber warum gelingt es nur den wenigsten, das wirklich zu tun? Lassen Sie sich von diesem Buch Mut machen, die Mittelmäßigkeit zu überwinden und ein vollkommenes, erfülltes Leben zu führen!
Über den Autor
Über 2000 Vorträge vor rund 500 000 Menschen, 30 Bücher in 18 Sprachen, erfolgreiche Firmengründungen, Vorlesungen, eine anhaltende Beratertätigkeit und immer neue Ziele — das ist Hermann Scherer. Er lebt in Zürich und ist in der Welt zu Hause, wo er mit seinen mitreißenden Auftritten Säle füllt. Der Autor von Bestsellern wie Glückskinder. Warum manche lebenslang Chancen suchen – und andere sie täglich nutzen ist ausgewiesener Business-Experte und zählt als solcher »zu den Besten seines Faches« (Süddeutsche Zeitung).
Inhalt
»Er war ein guter Mensch«
Die Verleumdung des Lebens
Ein guter Deal
Nichts ist weder gut noch böse
Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Umstandslos
Pay the bill – zahle den Preis
Unser größter Feind
Warum Zusammenbrüche Durchbrüche sind
Die Freiheit des Robinson
Be the party, not the part
Es gibt ein Leben vor dem Tod
Register
»ER WAR EIN GUTER MENSCH«
Es war heiter bis wolkig. Die Trauergemeinde musste bei 7,9 Grad Celsius weder frieren noch schwitzen.
In der Aussegnungshalle wartete der Sarg aus Kiefernholz (Modell 135HK, 1045,00 Euro) neben einem recht geschmackvollen, hellen Blumengebinde (»In tiefer Verbundenheit«, 74,00 Euro zzgl. Lieferkosten) mit weißen Gerbera und Rosen und einem etwas kitschigen, tiefroten Gesteck (»Aufrichtige Anteilnahme«, 95,00 Euro zzgl. Lieferkosten) mit roten Gerbera und Rosen.
Leises Flüstern, hier und da ein Schluchzen oder ein Schnäuzen und die Schritte der ankommenden Trauergäste füllten den halbhohen Raum. Die dunkel gekleideten Freunde und Verwandten des Toten nahmen ihre Plätze ein und warteten auf den Beginn der Trauerfeier. Es waren nicht viele gekommen. Aber es blieben auch nicht viele Plätze frei. 77 Jahre alt war Peter Müller geworden. Seine Witwe saß stumm in der Mitte der ersten Reihe.
Dann setzte die kleine Orgel ein, und die drei Damen aus dem Kirchenchor sangen:
»Jesus, meine Zuversicht und mein Heiland ist im Leben. Dieses weiß ich; sollt ich nicht darum mich zufrieden geben, Was die lange Todesnacht mir auch für Gedanken macht.« Während des Trauerlieds betrat der Pfarrer den Raum, und nach dem Verklingen der letzten Note begann er den Trauergottesdienst: »Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.« Alle: »Und mit deinem Geiste.«
Es folgten eine Bibelstelle (»Jesus Christus spricht: ›Lass dir an meiner Gnade genügen …‹«) und ein weiteres Trauerlied (»Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr …«), dann das Eingangsgebet (»Herr, unser Gott, die Wege, die du mit uns gehst, sind uns verborgen …«). Schließlich sprach der Pfarrer zur versammelten Trauergemeinde:
Liebe Angehörige.
Sie haben einen wichtigen Menschen verloren. Und Ihr Herz ist schwer.
Wir verabschieden heute unseren geliebten Freund, Vater, Bruder und Ehemann Michael Müller.
Ein Abschied, der uns schmerzt. Gewiss, der bittere Schmerz wird im Laufe der Zeit nachlassen, doch der Verlust bleibt ein Leben lang.
Michael Müller hat eine Schwelle überschritten, einen Weg angetreten, auf dem wir ihn nicht begleiten können. Heute wollen wir der Trauer eine Stimme geben. Wer war er, dieser liebe Mensch? Unvergessen, wie er lächelte, wenn seine Enkel ihn besuchen kamen. Seine unbeschwerte Liebenswürdigkeit beim Gespräch mit den Nachbarn oder im Ladengeschäft. Wir erinnern uns gerne an ihn. An die Güte und Hilfsbereitschaft. An seine Treue und Verlässlichkeit als Ehemann und Familienvater über so lange Jahre, über die Höhen und Tiefen des Lebens hinweg. Wir sind dankbar für manches gute Wort, für ein Lächeln, für einen Mut machenden Rat. Jede und jeder von Ihnen wird wohl solch einen Satz aussprechen können.
Viele seiner Arbeitskollegen werden sich auch heute noch, fast 15 Jahre nach seinem Ausscheiden aus dem Berufsleben, an ihn erinnern als anerkannten und geschätzten Fachmann, als verantwortungsvollen Elektromeister, der in seiner Laufbahn viel Gutes tat und stets mit Fleiß und Tugend ein echtes Vorbild war.
Er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war.
Uns alle bewegt in dieser Stunde auch der Dank, einen ganz besonderen Menschen gekannt zu haben. Wie gern hätten wir mehr Zeit mit ihm verbracht. Lassen Sie uns einen Augenblick schweigen – zur Erinnerung an Michael Müller. Er lebte still und unscheinbar, er starb, weil es so üblich war. Ein Mensch ist nicht vergessen, solange er in unserem Herzen wohnt.
Alles im Leben hat seine Zeit, die der Liebe, des Glücks und der Freude, die Zeit des Leidens und der alltäglichen Sorgen.
Ist es vorbei … bleibt doch die Liebe beständig.« Die Rede klang wie ein ausgefüllter, schablonierter Lückentext eines Download-Formulars von www.beileid.de, und das Schluchzen einiger der Anwesenden wurde lauter. Dann setzte die Orgel wieder ein: »Wer Gott vertraut, hat wohlgebaut …«
Ein paar Lieder und Gebete später erhoben sich die Trauergäste und schlossen sich dem kurzen Trauerzug hinter dem Sarg an, der von den ehrenamtlichen Friedhofsdienern zur offenen Begräbnisstelle getragen wurde.
Eine Dame mittleren Alters raunte der neben ihr schreitenden Dame mittleren Alters leise zu: »Hast du das gemerkt? Er hat den falschen Namen gesagt.«
Die andere Dame nickte und flüsterte hinter vorgehaltener Hand: »Ja, er hat Michael Müller gesagt. Statt Peter Müller. Peinlich. Aber bei so vielen Menschen, die so ein Pfarrer heute betreuen muss – ich meine, das ist doch verständlich, dass er nicht jeden persönlich kennt …«
»Stimmt«, raunte die erste Dame, »aber sonst war das wirklich sehr geschmackvoll, nicht?«
»Ja, das hat er sehr taktvoll gemacht, aber man weiß ja nie, ob sie um den Verstorbenen trauern oder um ihre Erwartungen, die der Verstorbene nicht mehr erfüllen kann.«
Jemand fragte, ob jeder Mensch ein guter Mensch ist, wenn er beerdigt wird.
Ein paar Meter weiter vorne im Trauerzug beugte sich ein junger Mann zu einer jungen Dame vor, die zwar rotgeweinte Augen hatte, aber gefasst wirkte. Er fragte sie leise: »Elektromeister? War er nicht Dachdecker gewesen?«
Sie nickte, zuckte mit den Schultern und bedeutete ihm mit einer kleinen, wegwerfenden Handbewegung: Ist doch egal …
DIE VERLEUMDUNG DES LEBENS
Helmut Schmidt und Daniela Katzenberger haben viel gemeinsam. Doch, wirklich. Zumindest aus meiner Perspektive. Denn beide kann ich aufrichtig dafür bewundern, dass sie ohne Schnörkel sagen, was sie denken. Der eine denkt dabei vorzugsweise einen langen Lungenzug lang nach. Die andere braucht dazu nicht einmal Luft zu holen.
Und erfolgreich sind beide. Und wie! Helmut Schmidt sitzt ganz offensichtlich auf dem unsichtbaren Thron des weisesten Deutschen, der größten Autorität unseres Landes in diesen Tagen. Ein wahrhaft bedeutender Mann: Er bezwang als Senator in Hamburg die 62er-Sturmflut, war einer der besten Bundeskanzler, seit es Bundeskanzler gibt, und ist seit Jahrzehnten Mitherausgeber einer der angesehensten Zeitungen des Landes. Er war fast 60 Jahre lang glücklich verheiratet, ist wieder verliebt, zählt einige der mächtigsten und klügsten Männer der Welt zu seinen Freunden. Er malt, spielte Klavier, so lange er konnte, nahm sogar eigene Schallplatten auf. Er ist sechsfacher Ehrenbürger, dreißigfacher Ehrendoktor an den bedeutendsten Hochschulen der Welt, erhielt nicht nur unzählige Preise, sondern ist selbst Namensgeber des Helmut-Schmidt-Preises für Deutsch-Amerikanische Wirtschaftsgeschichte. Erfolgreicher geht es nicht.
Glücklich ist, wer vergisst, dass er nicht mehr zu retten ist.
Und Daniela Katzenberger? Die hat maximal Spaß, wird darüber Millionärin, und keiner weiß warum. Glücklich ist, wer vergisst, dass er nicht mehr zu retten ist. Von Beruf Reality-Show-Teilnehmerin, machte sie nicht Kettenrauchen zu ihrem Markenzeichen wie der Herr Schmidt, sondern ihre abrasierten, an zu hoher Position auftätowierten Augenbrauen, die sie immer aussehen lassen, als sei sie selbst darüber erstaunt, dass sie gleichzeitig angriffslustig, naiv, den Tränen nah und zu allem bereit aussehen kann. Sie taucht regelmäßig in Artikeln mit prallen Fotos und kleinen Texten in der Boulevardpresse auf, ist fast täglich irgendwo im Fernsehen zu sehen, spricht fließend Denglisch und Pfälzisch, schreibt mit 24 Jahren ihre erste Biografie, mit der sie Bestsellerplatz 1 stürmt, bespaßt über eine Million Facebook-Fans im Internet und sorgt überall, wo sie auftaucht, wasserstoffblond für gute Laune. Bald wird sie uns erklären, warum Frauen mit geschlossenem Mund keine Wimperntusche auftragen können.
Daniela Katzenberger ist womöglich noch gar nicht am Ende ihrer Karriere angelangt. Bei ihr weiß man nicht, wozu sie noch fähig ist. Es kann morgen vorbei sein, und keiner erinnert sich mehr an sie, oder aber sie ulknudelt sich durch die Medien bis ins hohe Alter. Es ist alles drin. Aber wahrscheinlich wird es auch bei ihr zum Schluss naheliegend sein zu sagen: Erfolgreicher geht es nicht.
Beide jedenfalls werden definitiv bei ihrem Begräbnis, wann immer das sein wird, keine mittelmäßige Trauerfeier bekommen. Es wird vermutlich nicht Jahresdurchschnittstemperatur herrschen, der Blumenschmuck wird nicht mittelmäßig teuer sein, die Trauerlieder werden nicht die üblichen sein, der Pfarrer wird die Trauerpredigt nicht verwechseln. Die Nachrufe auf sie, egal ob öffentlich oder im privaten Kreise, werden ganz sicher nicht sein: langweilig, mittelmäßig, durchschnittlich, gewöhnlich, normal. Keiner wird den Eindruck haben, dass die beiden ihr Leben vergeudet haben; beide wird man bewundern dafür, dass sie grandios viel herausgeholt haben aus der Zeit, die sie auf diesem Planeten geschenkt bekommen hatten. Beide sind auf ihre Weise der Beweis für meine These, dass es ein Leben vor dem Tod gibt, dass sie die eigenen Träume gelebt, den Schatz gefunden haben.
Stümperhaft gemalt
Meine Frage an Sie ist: Warum nur leben die meisten Menschen ihr Leben eher so ähnlich wie der Dachdecker Peter Müller oder der Elektromeister Michael Müller und so gar nicht wie Helmut Schmidt oder Daniela Katzenberger? Und kommen Sie mir jetzt nicht damit, die einen hätten Pech und die anderen Glück gehabt!
… als würden sie im Wartesaal die Zeit bis zum Leben nach dem Tod absitzen.
Warum leben beinahe alle Menschen in unserer Gesellschaft ihre durchschnittlich 28 770 Lebenstage, die sie auf dieser Erde verbringen, so, als lebten sie nur mal so zum Ausprobieren? Als würden sie im Wartesaal die Zeit bis zum Leben nach dem Tod absitzen, an das nach einer aktuellen Umfrage nur etwas mehr als ein Drittel der Deutschen glaubt? Warum sind fast alle Menschen nur mittelmäßig glücklich, mittelmäßig stolz, mittelmäßig erfolgreich, mittelmäßig gut in fast allem, was sie tun? Warum drängen sich fast alle auf allen Skalen in der Mitte, sodass die Glückskurve in unserer Gesellschaft über alle Menschen hinweg eine Glockenkurve ergibt? Der Durchschnitt wäre ja gar nicht das Problem, der Durchschnitt von 2 und 98 ist genauso 50 wie der Durchschnitt von 49 und 51 … aber warum nur sind fast alle Lebenswege dem Durchschnitt so nah? Lauter 48er-, 50er- und 53er-Leben, kaum 94er- oder 12er-Leben. Lauter Peter Müllers und kaum Daniela Katzenbergers. Ist es das, was wir wollen, wenn wir noch jung sind: ein durchschnittliches, langweiliges Leben führen? Warten, bis es rum ist, ohne Herausragendes getan zu haben?
Natürlich, die meisten von uns finden Daniela Katzenberger furchtbar peinlich, so wie wir vor 40 Jahren schon Ingrid Steeger oder vor 15 Jahren Verona Feldbusch peinlich fanden, die ungefähr dieselbe Rolle in der Öffentlichkeit ausfüllten. Es gibt so viele Möglichkeiten, einen guten Eindruck zu machen. Warum lassen sie alle ungenutzt?
Die Voluminösität von Solanum Tuberosum steht in quantitativer Disproportionalität zur Intelligenz des Produzenten.
Wir fremdschämen uns ganz wohlig über diese nuttig-frivolen Hupfdohlen, die mehr Silikon und Schminke als Textilien am Körper tragen und sich dermaßen dreist dumm stellen (»Da werden Sie geholfen …«), dass es uns schaudert und wir gerade deswegen einen überdurchschnittlichen Cleverness-Quotienten vermuten. Ich vermute das übrigens auch. Manche dagegen beschreiben das mit anderen Worten: Die Voluminösität von Solanum Tuberosum steht in quantitativer Disproportionalität zur Intelligenz des Produzenten. Oder auf deutsch: Der dümmste Bauer hat die dicksten Kartoffeln.
Und viele von uns können sich herrlich empören über den qualmenden Helmut Schmidt (»Unverantwortlich! Der Mann will ein Vorbild sein!«) oder den prollenden Dieter Bohlen oder zu seinen Lebzeiten den rücksichtslos polternden Franz Josef Strauß oder heute den rücksichtslos polternden Uli Hoeneß. Wir bewundern insgeheim die Dreistigkeit, vermuten dahinter eine Form von Freiheit, wollen aber dann doch lieber diejenigen sein, die peinlich berührt sind, als diejenigen, die den Grund dazu liefern. Vielleicht ist es ja nur eine Sache von Mut oder Feigheit, auf welcher Seite wir am Ende stehen. Wenn das so ist, dann ist mir meine eigene Feigheit dann aber doch wieder peinlich …
Denn eigentlich sind wir doch mächtig. Nur weil die in Gutmenschenkreisen so verpönte Kaste der »Persönlichkeitsentwickler« es in den Seminarräumen und von den Bühnen herunter immer wieder proklamiert, muss es ja nicht falsch sein. Ich bin überzeugt: Wir können unser Leben jederzeit so gestalten, wie wir es möchten. Wenn wir noch Kinder sind, ist das Blatt fast leer, wir haben riesige Flächen zu gestalten, wir können alles reinmalen, was wir wollen. Später werden die Flächen kleiner, aber es bleiben immer noch weiße Flächen übrig. Selbst an unserem letzten Tag haben wir immer noch eine kleine weiße Ecke, die wir frei gestalten können.
Wir lassen uns den Pinsel führen und malen mittelmäßige Durchschnittsbilder, von denen jedes aussieht wie das andere.
Einen Beruf zu haben bedeutet für viele, wieder und wieder dasselbe zu tun – so lange, bis man es am liebsten gar nicht mehr tun möchte.
Aber welches Werk liefern wir am Ende ab? Wir lassen uns den Pinsel führen und malen mittelmäßige Durchschnittsbilder, von denen jedes aussieht wie das andere. Wir versuchen nicht einmal, mit großen Strichen ein grandioses Bild zu entwerfen, eigene Farben anzurühren, das Bild unserer Träume zu malen. Nein, wir kritzeln nur so vor uns hin und teilen uns dieselben grauen Farben mit unseren Lebensnachbarn links und rechts von uns. Der Galerist unserer Lebenswerke könnte unsere Bilder vermutlich genauso wenig auseinanderhalten wie der Durchschnittsarbeitnehmer seine Arbeitstage: einer wie der andere. Einen Beruf zu haben bedeutet für viele, wieder und wieder dasselbe zu tun – so lange, bis man es am liebsten gar nicht mehr tun möchte.
Wie wäre es, wenn jeder Tag unseres Lebens katalogisiert werden würde? Facebook macht das ja schon ein wenig mit der »Chronik« genannten chronologischen Übersicht über die Lebensereignisse und Postings der Nutzer. Wenn alles aus unserem Leben festgehalten würde – unsere Gefühle, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, zusammenleben, die Dinge, die wir tun –, wenn einfach alles aufgezeichnet werden würde und dann am Ende unseres Lebens sämtliche Aufzeichnungen in ein Museum gestellt werden würden, in dem all das – unser Leben – zu sehen ist. Wie sähe dann dieses Museum aus? Wäre es einen Besuch wert?
Wenn wir einen Großteil unseres Lebens damit verbringen, einen Job zu machen, der uns nicht gefällt, dann wäre auch ein Großteil unseres Museums mit Bildern und anderen Fragmenten eines Jobs ausgestattet, den wir nicht haben wollten. Wäre das also ein interessantes Exponat?
Wenn wir freundliche, glückliche, optimistische, lebensbejahende Menschen wären, dann wäre unser Museum auch voll von freundlichen, glücklichen, optimistischen, lebensbejahenden Bildern. Wenn wir aber missmutig, traurig, depressiv und frustriert wären, dann würde auch die Ausstellung in unserem Museum diese Wirkung beim Betrachter erzielen.
Wie würden wir uns fühlen, wenn wir am Ende unseres Lebens in ein solches Museum gehen würden, von dem viele auch behaupten, dass es als eine Art schnell durchlaufender Film im Moment unseres Todes (falls wir ihn im Wachzustand erleben) tatsächlich in gewisser Hinsicht existiert?
So ein Museum würde uns so präsentieren, wie wir wirklich sind. Die Erinnerungen würden nicht auf dem Leben basieren, das wir uns erträumt hätten oder an das wir uns beschönigend, zensierend, retuschierend erinnern, sondern die Erinnerung wäre genauso, wie wir tatsächlich gelebt haben. Und wenn wir nicht richtig gelebt haben, dann wären die Exponate unserer Lebenstage: langweilig!
Die beste Ausrede
Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht dazu geboren werden, das Leben zu verleumden, sondern um es zu feiern.
Also, warum ist das so? Diese Frage hat mich umgetrieben, denn wenn ich darauf die richtigen Antworten finde, halte ich damit den Schlüssel in der Hand, um die richtige Tür zu öffnen, anstatt weiter im Wartesaal zu hocken. Mein Instinkt sagt mir, dass es eine Sünde wäre, diesen Schlüssel nicht zu benutzen und nicht weiterzugeben. Ich bin davon überzeugt, dass wir nicht dazu geboren werden, das Leben zu verleumden, sondern um es zu feiern. Warum nur tun wir es nicht – oder zumindest so selten?
Die erste oberflächliche Antwort ist die Feigheit, sich zu blamieren. Natürlich, die zweite oberflächliche Antwort liegt auch gleich auf der Hand: Wir werden von der Welt, die uns umgibt, schon als Heranwachsende zu Kleingeistern gemacht. Es liegt klar vor unseren Augen, dass unsere Eltern, die Schule und die Gesellschaft uns insgesamt im Laufe der Jahre zurechtstutzen, kappen, rundfeilen.
Denn wenn ein Kind begeistert davon schwärmt, einmal Oscar-Preisträger, Wetten-dass-Moderator oder Mondfahrer werden zu wollen, lächeln die Eltern müde und fragen, ob das Kind seine Hausaufgaben schon gemacht hat. Kinder lernen überraschend schnell, dass ihr Leben nach offenbar übereinstimmender Meinung der Erwachsenen nicht dazu da ist, Träume zu verwirklichen. Wie schrecklich.
Das Grundprinzip der Mittelmäßigkeit, das mit Einverständnis der Eltern in allen Lehrplänen und Beschlüssen der Kultusministerkonferenz codiert ist, lautet: Das herkömmliche Verfahren ist auch das sicherste Verfahren. Es ist bereits getestet, es liegen Erfahrungswerte vor, und wenn es einmal funktioniert hat, wird es auch ein weiteres Mal funktionieren.
Muss ein hervorragender Gehirnchirurg wirklich in der Lage sein, gute Erdkundeaufsätze zu schreiben, und die römische Geschichte auswendig gelernt haben?
Ein Schulsystem, das die Schüler anhält, dort am meisten zu lernen, wo sie die schlechtesten Noten haben – und das auf Kosten jener Zeit, die sie eigentlich damit verbringen könnten, ihre Stärken zu stärken –, fördert den Durchschnitt und macht damit Starke nicht stärker, sondern durchschnittlicher. Unser Schulsystem meint, dass es gut ist, wenn wir alle das Gleiche können. Universitäten suchen ihre Schüler danach aus, wie gut ihr Notendurchschnitt in der Schule war. Dabei spielt der Notendurchschnitt doch gar keine Rolle für bestimmte Befähigungen. Wer Arzt werden will, kann möglicherweise in manchen Dingen sogar schlecht und dafür in anderen gut sein. Muss ein hervorragender Gehirnchirurg wirklich in der Lage sein, gute Erdkundeaufsätze zu schreiben, und die römische Geschichte auswendig gelernt haben?
»Schenken Sie Ihren Kindern schlaue Eltern« ist der Werbespot der Süddeutschen Zeitung. Schon einige Jahre vor PISA hat eine Hamburger Studie gezeigt, dass man den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen in deutschen Schulen geradewegs anhand der Zahl der Bücher vorhersagen kann, die im Elternhaus stehen: Wo es viele Bücher gibt, da werden aus den Kindern erfolgreiche Abiturienten; wo das Lesen keine oder nur eine geringe Rolle spielt, da reicht es oft nicht einmal zum Hauptschulabschluss. Ein ganz anderer Ansatz.
Universitäten haben von ihrer Grundstruktur her das Ziel, möglichst viele Studenten möglichst schnell, möglichst kostengünstig und unter möglichst geringen Verlusten, also mit möglichst niedriger Dropout-Quote, möglichst durchschnittlich auszubilden. Das ist die Bildungspolitik, die wir haben. Ein weiteres Ziel dieser Politik ist es, auch bildungsferne Schichten zur Bildung zu bringen, um den Durchschnitt zu heben. Das ist wunderbar. Aber gleichzeitig steht keineswegs im Fokus, bildungsnahe Schichten so zu fördern, dass unsere Top-Talente, schrägen Vögel und Ausnahmekönner lernen, Außergewöhnliches zu bewegen. Das soll anscheinend irgendwie von selbst passieren. Oder soll es das lieber gar nicht?
Der Durchschnitt ist hilflos, und der Durchschnitt wird niemals besondere Leistungen bringen.
Der Durchschnitt ist hilflos, und der Durchschnitt wird niemals besondere Leistungen bringen. Der Durchschnitt erbringt keine wissenschaftliche Spitzenleistung, die wir für eine erfolgreiche Zukunft so bitter nötig haben werden. Der Durchschnitt erbringt keine sportlichen Spitzenleistungen, keine künstlerischen Ausnahmeleistungen und natürlich auch keine Innovationen, egal in welchem Bereich. Der Durchschnitt ist oft geradezu sinnlos und gefährlich. Anders sein ist besser. Es geht manchmal sogar gar nicht nur darum, besser zu sein, es geht nicht um Elitenbildung, sondern darum, eben auch mal komplett anders sein zu dürfen, ohne dann sofort durch alle Bildungsraster zu fallen. Mit dem Durchschnittsdogma setzen wir auch unsere Individualität und Diversität aufs Spiel. Und das ist wirklich, wirklich schlimm!
Wenn die anderen aus dem Fenster springen, springen Sie dann auch aus dem Fenster? Das sollten Sie nicht tun. Aber wenn es um die Durchschnittsbildung geht, wird genau das von uns gefordert: Die Bildung des Durchschnitts ist ein Sprung aus dem Fenster. Und wir sollen bitteschön alle hinterherspringen!
Die Sehnsucht, sich hinter einer Gruppe Gleichgesinnter zu verstecken, war wohl noch nie so groß wie heute. Wir – die Briefmarkensammler, die Gartenzwergsammler, die Linken, die Rechten, die Katholiken, die Protestanten, die Studenten, die Arbeitnehmer, die Zinnsoldatensammler, die Weißwurstesser – wir versammeln uns und beschließen, was für uns gut ist. In Wirklichkeit sollten wir alles daransetzen, eine Ansammlung von völlig unterschiedlichen Menschen zu werden, mit dem höchstmöglichen Grad an Individualität. Das würde unsere Gesellschaft reich machen! Rotary und all die anderen Service-Clubs leben Diversity zumindest in einem gewissen Rahmen.
Dass wir alle schön beieinander bleiben und das Rad nicht jedes Mal neu erfinden, sondern sicherer ans Ziel kommen, weil wir auf bestehende Muster zurückgreifen, dafür sorgen in unserer Gesellschaft die Institutionen. Uns systematisch das Schubladendenken einzubimsen, von dem Beamte, Akademiker und Berufspolitiker glauben, dass wir es brauchen, um nützliche Arbeitsplatzbesitzer und Krankenkassenbeitragszahler zu werden, ist eine der Hauptaufgaben der Schule, der ersten großen öffentlichen Institution in unserem Leben.
Vielleicht erinnern Sie sich: Sie sitzen im Matheunterricht, und der Lehrer stellt eine Frage. Sie kommen nicht sofort auf die Antwort, Ihr Adrenalinspiegel steigt. Sie wissen ja, dass der Lehrer bereits die richtige Antwort im Kopf hat. Wenn Sie sagen, was er im Kopf hat, bekommen Sie die volle Punktzahl. Wenn nicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Sechs. So lauten die Regeln dieses Spiels.
Also überlegen Sie nicht gemeinsam mit dem Lehrer und den anderen Schülern, wie man die Aufgabe lösen könnte, sondern Sie bemühen sich, auf diese eine Antwort aus dem Kopf des Lehrers zu kommen. Denn Ihr Gehirn hat gespeichert: Der Lehrer hat immer recht. Spätestens, wenn Sie mal ernsthaft über eine selbst gemachte Antwort nachgedacht haben, einen kreativen Vorschlag gemacht haben und dafür ein Sechs bekommen haben, weil Ihre Antwort nicht der richtigen Schublade entsprach, sind Sie konditioniert: Der Lehrer ist eine Institution. Institutionen haben immer recht. Und wenn Sie heil durchkommen wollen, müssen Sie alles tun, um sich unterzuordnen und es ihnen recht zu machen.
Institutionen werden sehr böse, wenn die von ihnen Abhängigen andere Schubladen als die offiziellen aufmachen.
Und dabei geht es überhaupt nicht um die richtige Antwort, sondern nur um die richtige Schublade. Wenn ein Schüler in der Klassenarbeit 21 mit 13 multiplizieren soll und dies nicht nach der im Unterricht erlernten Methode »schriftliche Multiplikation« macht, sondern viel schneller, cleverer und kreativer mithilfe von Linien, so wie es in China üblich und auf You Tube zu sehen ist, oder mit typisch indischem Pragmatismus, einem Ruck-zuck-Verfahren wie es Ranga Yogeshwar einmal im Fernsehen demonstriert hat, dann nützt es nichts, dass als Ergebnis 273 dasteht. Denn das Ergebnis zählt ja nicht, wenn der Rechenweg ein anderer ist als der, den der Lehrplan vorschreibt. Ein unüblicher, im Internet gefundener Lösungsweg lässt den Schüler dastehen, als hätte er das Ergebnis von jemand anderem als der Institution eingeflüstert bekommen – und darauf steht die Höchststrafe! Institutionen werden sehr böse, wenn die von ihnen Abhängigen andere Schubladen als die offiziellen aufmachen.
Regelbrecher erreichen ihre eigenen Ziele, Regelkonformisten erreichen die Ziele der anderen.
So lernen wir, dass wir am besten lernen, wenn wir regelkonform lernen, ja überhaupt regelkonform sind und die Verfahren anwenden, die alle anwenden. So werden wir in das Leben entlassen und wissen eines ganz genau: dass wir uns an die Regeln halten müssen. Das tun wir auch brav! Und dann gibt es noch diejenigen, die die Regeln nicht beachtet haben, die falsche Antworten gegeben hatten, die Fragen stellten, die infrage gestellt haben, die infrage gestellt wurden. Sie fallen aus dem Durchschnitt und zu einem großen Teil komplett aus dem System raus. Sie fallen entweder weit unter den Durchschnitt, oder und das ist ein großer Teil der Regelbrecher – sie werden extrem erfolgreich und leisten Großartiges. Das sind diejenigen, die Außergewöhnliches erreichen, weil sie neue Optionen außerhalb des Durchschnitts gesucht und gefunden haben. Sie gründen Firmen, erfinden ganze Branchen neu, entwickeln außergewöhnliche Produkte, werden Führungspersönlichkeiten, werden Vorbilder, werden reich, verändern die Welt. Regelbrecher erreichen ihre eigenen Ziele, Regelkonformisten erreichen die Ziele der anderen. Ein Schüler, der staunend die Biografien der zehn reichsten Menschen der Welt studiert hatte, machte anschließend seinem Vater einen Vorschlag für eine neue Notenskala: »sehr gut – gut – befriedigend – ausreichend – wohlhabend.«
Unser Bildungssystem hat versagt! Schon allein deshalb, weil wir immer andere dafür verantwortlich machen, uns weiterzuentwickeln. Die Soziologin Annette Lareau von der University of Maryland führte vor einigen Jahren mit einer Gruppe von Drittklässlern eine faszinierende Untersuchung durch. Sie wählte schwarze und weiße, wohlhabende und arme Kinder aus und konzentrierte sich schließlich auf zwölf Familien. Lareau und ihr Team besuchten jede Familie mindestens 20-mal für jeweils mehrere Stunden. Sie und ihre Mitarbeiter baten die Testpersonen, sie einfach wie den Haushund zu behandeln, und begleiteten sie mit dem Kassettenrekorder in der einen Hand und dem Notizblock in der anderen in die Kirche, zum Fußballspielen und zum Arzt. Man würde erwarten, dass sich nach einer derart ausführlichen Untersuchung von zwölf verschiedenen Haushalten zwölf vollkommen unterschiedliche Erziehungsstile herauskristallisieren würden: strenge und nachsichtige Eltern, solche, die sich in alles einmischen, andere, die ihren Kindern viele Freiräume lassen, und so weiter. Lareau fand jedoch etwas ganz anderes heraus: Es gibt nur zwei Erziehungsphilosophien. Und die lassen sich ganz eindeutig nach Klassenzugehörigkeit unterscheiden. Eltern der Ober- und Mittelschicht sind bei der Freizeitgestaltung ihrer Kinder stark involviert. Sie fahren sie von einem Termin zum nächsten, fragen sie nach Lehrern, Trainern und Mitschülern aus und versuchen, positiven Einfluss auf die Gestaltung des Lebens zu übernehmen. Die Kinder aus den Familien der Unterschicht kannten diese intensive Terminplanung nicht. Sie waren mehr sich selbst überlassen.
Das mit der Planung und Begleitung wollte ich dann auch übernehmen. Irgendwann kam der Entschluss, dass unsere zweijährige Tochter in diverse Kindergruppen zum Basteln, Singen, Tanzen und derlei Beschäftigungen gehen soll. So kam sie auch ins Sagadula-Land in meinem Wohnort Zürich. Ich war natürlich sehr neugierig, als ich erfuhr, dass ich mitgehen kann. Ich dachte nach der Beschreibung dieses fantastischen Fantasielands, dass das die ganz große Nummer ist, mit größtem Spaßfaktor, ein kindgerechtes Paradies. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte die möglicherweise unberechtigte Vorstellung, dass die Zeit dort für meine Tochter eine geniale Partyzeit sein müsste. Immerhin waren pro Singstunde, die nur 45 Minuten lang war, zwölf Kinder anwesend, deren Eltern dafür alle einen Preis von umgerechnet 33 Euro zahlten. Also lagen immerhin circa 400 Euro im Topf. Da kann man ja was anstellen!, dachte ich.
Also war ich darauf gefasst, dass wir herzlich und mit Begeisterung, mit »Give-me-five« und allem drum und dran begrüßt werden und meine Tochter wie auch all die anderen Kinder gleich als Star der Stunde gefeiert werden, um dann so viel Spaß zu haben, dass diese Knirpse mit Tränen in den Augen und lautem Geschrei nur unter größtem Widerstand dazu gebracht werden müssen, die Stunde am Ende zu verlassen, weil es das Größte, Beste und Tollste war, was sie je erlebt haben.
Statt eine Party zu feiern, haben wir an einem Versteifungsprozess teilgenommen.
Natürlich kam es ganz anders: Statt eine Party zu feiern, haben wir an einem Versteifungsprozess teilgenommen. Die Kinder kamen in ein liebloses altes Zimmer oberhalb der Feuerwehrhalle. Ein lieblos hingeschmiertes Schild »Schuhe bitte reinigen« war die Begrüßung. Dass auf Sauberkeit Wert gelegt wird und die Schuhe sauber sein sollen, kann ich verstehen. Nur warum Schuhe reinigen, wenn das ganze Haus ein einziges Loch war? Aber das wäre ja noch nicht mal der Punkt gewesen. Die Kinder kamen rein, zogen sich in einem Raum um, und so standen plötzlich zwölf Kinder mit Müttern und einem Vater schweigend im Kreis. Weder die Kinder noch die Mütter zeigten untereinander irgendeine Herzlichkeit, irgendeine Art von »Schön, dass wir jetzt gemeinsam hier sind«. Wie auch, wenn die Vorbilder es schon nicht tun? Und so kniete man regelbewusst, angestrengt und unkommunikativ im Kreis, eine alternde Dame hing Plakate mit Kinderliedern an die Wand, die wir dann nacheinander im wahrsten Sinne des Wortes »abgesungen« haben. Der Höhepunkt lag darin, dass wir bei dem Lied »Backe, backe Kuchen« tatsächlich eine Kochmütze aufziehen durften sowie einen Rührbesen bekamen und nach 30 Minuten eine Rutsche und drei Plastikteile als Kletterparcours aufgebaut wurden.
Selten habe ich mehr Einsamkeit in einer Gemeinschaft erlebt als in diesen 45 Minuten, und selten habe ich mehr Freudlosigkeit erlebt als in diesen 45 Minuten. Wenn wir zu Hause Musik machen, dann tanzen wir wie die Verrückten, spielen rum, machen Faxen, schreien. Wir haben sogar ein Spiel, das »Schreien« heißt und bei dem wir lauthals schreiend im Wohnzimmer rumlaufen. Die einzige Sorge, die wir haben, ist, dass unser Nachbar den Lärm nicht erträgt. Das mit den Nachbarn war hier kein Problem, denn es gab keinen Lärm. Stellen Sie sich das mal vor: zwölf Kinder in einem Raum und kein Lärm. Das ist doch krank!
Hätte man nicht wenigstens ein Kasperletheater, einen toten Frosch, einen Zaubertrick, Kostüme oder ein paar Knallfrösche oder ich weiß nicht was machen können, um Kindern den Zauber der Kindheit zu zeigen?
Ich Trottel war alles andere als ein gutes Vorbild für meine Tochter und habe mich zuerst einfach angepasst, so wie alle. Ich habe regelbewusst, brav darauf geachtet, keine Strophe falsch zu singen. Man kam sich vor wie in der Kirche, bei der man immer noch schnell die Liednummer von der Anzeige abliest, in der Hoffnung, das richtige Lied mitzusingen oder das entsprechende Gebet zu finden. Es war ein Trauerspiel. Hätte man für 400 Euro nicht einmal fünf Luftballons aufblasen können? Oder vielleicht eine klitzekleine Party machen können? Oder einen Kinder-Drink ausgeben können? Oder wenigstens ein Kasperletheater, einen toten Frosch, einen Zaubertrick, Kostüme oder ein paar Knallfrösche oder ich weiß nicht was machen können, um Kindern den Zauber der Kindheit zu zeigen?
Meine Tochter ist cool. Sie stand irgendwann auf, ging zur Garderobe, zog sich die Schuhe an und schaute mich fordernd an. Ihr Blick sagte: Auf geht’s, Papa, hier ist’s langweilig, wir gehen! Ich kapierte es. Wir gingen. Sie hätten die Blicke der Mütter und der Vorsängerin sehen sollen! Reinste Mordlust!
Ich lebe an Zürichs Goldküste, sicherlich eine der schönsten und reichsten Gegenden Europas, direkt am Zürichsee. Dort war auch dieses »Event« für Kleinkinder angeboten worden. Und dort, wo es alle, wirklich alle Möglichkeiten der Welt gäbe, dort werden kleine Kinder schon im Alter von zwei Jahren zu regelbewussten, unkommunikativen, einsamen Menschen gemacht und erleben in der Singgruppe die Vorboten einer Sklavenschaft des Reglements. Warum? Weil die Eltern Institutionen vertrauen.
Es ist ein großes Risiko, selber zu denken und dem Herzen zu folgen.
Es kostet viel mehr Mut und Energie, sich nicht unterzuordnen. Es ist furchtbar anstrengend, den eigenen Weg zu suchen. Und es ist auch ein großes Risiko, selber zu denken und dem Herzen zu folgen. Das Einzige, was dann sicher ist: Es wird Ärger geben! Also kapitulieren wir schon früh im Leben und werden regelkonform. So werden Kinder zu institutionalisierten Leibeigenen des Gemeinwesens abgerichtet, Menschen, die gegen ihren ursprünglichen Willen angepasst und geradezu sediert werden durch permanente Konditionierung.
Ich habe schon etliche Geschichten dieser Art gehört. Jeder, der Kinder hat, weiß irgendeine zu erzählen. Da ist der Junge, der sich in der Grundschule weigerte, im Deutschunterricht Blümchen rund um den Brief zu malen, der ihm als Hausaufgabe aufgegeben war. Er schrieb zwar den besten Brief von allen, bekam aber trotzdem eine Fünf, weil der Brief nicht so schön verziert war wie die anderen, er sich also nach Meinung der Lehrerin keine Mühe gegeben hat. Nach dieser Episode hat er gelernt: Im Deutschunterricht geht es nicht um die deutsche Sprache, sondern um die ästhetischen Erwartungen der Institution Lehrerin.
Und so lernt man im Kindergarten das Bienchenheft oder die Seepferdchen, in der Schule sammelt man Blümchen und dann als Manager Meilen bei der Lufthansa.
Nun werden die Blümchen besser und die Aufsätze schlechter. Und so lernt man im Kindergarten das Bienchenheft oder die Seepferdchen, in der Schule sammelt man Blümchen und dann als Manager Meilen bei der Lufthansa.
Oder die Erstklässlerin, die von der Lehrerin wissen wollte, wie man »Ball« schreibt. »Vertraue auf deine Ohren« antwortete die Lehrerin. Das Mädchen hatte aber bereits den Verdacht, dass das Wort sich anders schreibt, als es ihm die Ohren sagten. Die Ohren sagten »B – A – L«. Das Wort sah in seiner Erinnerung aber irgendwie anders aus: »Nein, nicht wie die Ohren sagen. Welche Buchstaben sind richtig?« Die Lehrerin verweigerte: »Nein, das ist falsch, du musst genauer hinhören.« Als das Mädchen wütend wurde, weil es merkte, dass es hier veräppelt wurde, bekam es erst recht keine Antwort auf seine Frage, sondern einen strengen Verweis, und die Eltern wurden zum Gespräch einbestellt, weil das Sozialverhalten des Mädchens nicht in Ordnung sei. Sehr richtig: Dem Lehrer zu widersprechen ist schlechtes Sozialverhalten – jedenfalls aus der Perspektive der Institution Schule. Eltern und Lehrer müssen dann an einem Strang ziehen und dem Mädchen beibringen, sich unterzuordnen. Sonst wird nie was aus ihm!
Ich könnte seitenweise solche Beispiele erzählen, wohl wissend, dass es auch engagierte, wohlwollende, herzliche und ihren Beruf liebende Lehrer gibt. Es gibt aber auch die beschriebene Sorte Lehrer oder Erzieher – jedenfalls bekomme ich ständig davon erzählt. Und ich habe es ja auch selbst erlebt. Ich weiß, warum ich damals von der Schule geflogen bin, und heute bin ich froh darum, mir meine Renitenz von damals halbwegs bewahrt zu haben.
Der Marsch durch die Institutionen
Menschen, die außergewöhnliche Resultate erzielen, weil sie außergewöhnliche Chancen erkennen und nutzen.
Wenn wir es dann mit angelegten Ohren durch die Schule und bis ins Teenager-Alter geschafft haben, stehen wir vor dem Berufsberater. Nach einer Kurzanalyse (»In welchem Fach waren die Noten denn nicht ganz so schlecht?«, »Na, was macht Ihnen denn ein bisschen Spaß?«) bekommt der Jugendliche ein paar Ausbildungsplätze angeboten. Natürlich von der Standardpalette der »offiziell anerkannten und vermittlungsrelevanten Berufe«: Altenpfleger, Einzelhandelskaufmann, Friseur, Elektronikfachverkäufer, Automechaniker, Installateur und so weiter. Ich frage Sie: Sind das wirklich Chancen zum Glück? Chancen sind Gelegenheiten, die von Menschen genutzt werden. Menschen, die außergewöhnliche Resultate erzielen, weil sie außergewöhnliche Chancen erkennen und nutzen. Oder sind das nur die sicheren Wege, als funktionierende Arbeitsdrohne das Leben anderer zu führen?
»Sei froh, dass es überhaupt was gibt!«, mahnt die Institution Vater. »Sei nicht so undankbar!«, mahnt die Institution Mutter. »Lebensmittelhändler oder Friseur – damit kannst du gar nicht falsch liegen. Gegessen wird immer. Und Haare wachsen auch immer!«, bestärkt die Institution Lehrer den Rat der Institution Arbeitsagentur. Scheinbar wollen alle Institutionen in unserer Gesellschaft chancensuchende Jugendliche schnell und sicher zu funktionierenden Festangestellten machen. An den Berufen ist nichts Schlechtes, nur die Art, wie sie gewählt werden, macht mich wütend oder traurig oder beides.
Darf ein junger Mensch überhaupt auf die Institutionen hören, wenn er sein Glück machen will?
Jetzt bitte ich Sie, mich nicht falsch zu verstehen: Ich will gar nichts an der Agentur für Arbeit aussetzen. Und obwohl ich so meine liebe Mühe mit der real existierenden Schule habe, will ich auch keine Lehrer kritisieren. Im Gegenteil: Ich schreibe nicht gegen Lehrer, sondern unter anderem auch für sie, die so wichtig sind für unsere Gesellschaft. Und ganz bestimmt will ich nicht gegen das Handwerk schreiben, das ich gut kenne und schätze. Was wäre diese Welt ohne unser Handwerk? Nichts! Ich will auf etwas anderes hinaus: Darf ein junger Mensch überhaupt auf die Institutionen hören, wenn er sein Glück machen will? Oder ist er dann verraten und verkauft?
Wie war es bei mir? Keine Institution hat mir auf meinem Lebensweg Orientierung geben können. Die Leute im Arbeitsamt oder meine Lehrer hätten den Kopf geschüttelt oder mir einen Vogel gezeigt, wenn sie gesehen hätten, was ich mit meinem Leben angestellt habe. Zu allen beruflichen Rollen, in denen ich bisher erfolgreich war – Gründer, Unternehmer, Vorstand, Trainer, Berater, Redner, Autor –, hätte ich mir anhören müssen: »So etwas gibt’s nicht!«, »Dafür gibt’s keine Ausbildung, das ist kein Beruf!«, »Das ist nicht solide, das ist Glücksrittertum!«
Das stimmt. Das sind keine offiziellen Berufe. Aber ich frage Sie: Bei welcher Institution haben die Albrecht-Brüder gelernt, Aldi zu gründen und zu einem genialen Geschäftskonzept zu entwickeln? Welche Institution hat Reinhold Würth geraten, den im Alter von 19 Jahren vom Vater geerbten Schraubenhandel zu einem weltweiten Handelsimperium mit über 60 000 Mitarbeitern auszubauen? Welche Institution stand dahinter, als Steve Jobs die Schule schmiss und begann, mit seinem Kumpel Woz zu Hause Computer zusammenzulöten? Welcher Berufsliste konnte Marcel Reich-Ranicki »Literaturkritik-Papst« entnehmen? Welche Institution hat Stefan Raab gemahnt, TV-Entertainer zu werden? Brauchte Dietrich Mateschitz eine Institution, um in Thailand den Roten Stier zu entdecken?
Das ist leider in der Spitze der Bildungslandschaft, nämlich in der Wissenschaft und an der Uni, kaum besser. Oder kennen unsere Gelehrten und Professoren die Antwort? Der Bildungsauftrag der Wissenschaft und der Universitäten ist wohl eher, das Geschehene zu kategorisieren statt Zukünftiges zu revolutionieren. Einige meiner Dozenten-Kollegen an den Hochschulen beginnen ihre Vorlesungen über neue Themen wie beispielsweise Guerilla-Marketing oder revolutionäre Managementmethoden mit der Feststellung, dass es über diese Themen noch wenig Literatur gibt. Zweifelsohne richtig, doch die Frage ist ja nicht allein, welches Wissen wir haben, sondern welches Wissen wir erschaffen! Heute ist es egal, an welcher Uni du studierst, du lernst überall die gleichen Cases, obwohl wir wissen, dass die Wirtschaft über Regelbruch funktioniert.
MBA-Anbieter sind – und ich weiß, wovon ich rede, ich habe ja selbst auch so einen MBA – austauschbare Case-Studies-Verteiler. Egal, wo Sie auf der Welt studieren, Sie bekommen immer die gleiche Aufgabe. Gleichmacherei: Jeder Manager lernt die gleichen Probleme und die gleichen Lösungen. Katastrophal: Die Menschen, die eigentlich zu den Problemlösern unserer Gesellschaft ausgebildet werden sollten, bekommen beigebracht, wie man angelt – nicht wie man eine Angel baut.
Und die Regeln, an denen entlanggelehrt wird, sind auch noch veraltet. Selbst die künftige Elite der Wirtschaft lernt immer nur die Vergangenheit kennen, nicht die Prinzipien, mit denen sie die Zukunft gestalten könnte. Unter anderem Harvard beginnt andere Wege zu gehen, nachdem eine Studie gezeigt hat, dass einer der entscheidendsten Punkte im Leadership die Intuition ist. Letztlich sind wir doch nur in der Lage, besser zu werden, wenn wir an den Dingen zweifeln. In der Schule dürfen wir aber nicht zweifeln, das ist dort streng verboten. Wir müssen lernen, dass das, was der Lehrer sagt, immer stimmt. Selbst wenn es nicht stimmt. Wenn ein Lehrer sagt, Milch ist gesund, dann hat Milch gefälligst gesund zu sein. Und wehe, ein Schüler meldet sich und meldet Zweifel an, weil er ganz andere Erfahrungen gemacht hat!
Nicht nur die Wirtschaft, die ganze Welt entwickelt sich durch Regelbruch weiter, und im Rückblick sehen wir deutlicher, was wir dadurch erreicht haben. Nicht jeder Regelbruch bringt Fortschritt, jedoch Veränderung. Ein schönes Beispiel ist die Badepolizeiverordnung vom 18. August 1932. Da die gebrauchte Formulierung »anstößige Badekleidung« sehr unterschiedlich interpretiert wurde und der Erlass damit das angestrebte Ziel verfehlte und die Badebekleidung der Frauen in den 1920er-Jahren zunehmend knapper wurde, gab das Ministerium am 28. September 1932 eine Polizeiverordnung zur Ergänzung der Badepolizeiverordnung heraus, in der vorgegeben wurde, wie die Badebekleidung von Männern und Frauen auszusehen hatte. Darin stand unter anderem »§ 1. (1) Das öffentliche Nacktbaden ist untersagt. (2) Frauen dürfen öffentlich nur baden, falls sie einen Badeanzug tragen, der Brust und Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedeckt, unter den Armen fest anliegt sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. Der Rückenausschnitt des Badeanzugs darf nicht über das untere Ende der Schulterblätter hinausgehen. (3) Männer dürfen öffentlich nur baden, falls sie wenigstens eine Badehose tragen, die mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. In sogenannten Familienbädern haben Männer einen Badeanzug zu tragen.« Übrigens: Ein Zwickel ist der Stoffeinsatz im Schritt. Die Bundespolizei ist eine Institution, an die wir glauben.
»Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin, und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen«, sagte schon der Schriftsteller Kurt Marti.
Zeitungen sind auch so eine Institution. Journalisten sprechen gerne von Flauten, Wirtschaftskrisen und anderen bösen Geistern. Die Leser glauben an die beschriebenen Schwierigkeiten und entwickeln schon allein durch das Lesen Mutlosigkeit und Resignation. Wenn Institutionen sagen, wir haben eine Flaute, dann haben wir auch eine Flaute. Wo kämen wir denn sonst hin? »Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin, und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen«, sagte schon der Schriftsteller Kurt Marti. Und tatsächlich, die sich selbst erfüllende Prophezeiung funktioniert meistens perfekt. Intelligente Menschen behaupten, dass die zurückliegende große Finanz- und Wirtschaftskrise nicht wirklich begründet war. Wenn man die Vertrauenskrise in der Bank- und Finanzwelt einmal ausklammert, dann gab es in den anderen Branchen gar keine Krise. Aber es gab Angst, und diese Angst hat in vielen Branchen eine große Zurückhaltung verursacht – und schon war sie da, die Krise. Hätte sie sonst stattgefunden?
Viele Führungskräfte sind deswegen auf der Karriereleiter so gut unterwegs, weil sie sich den Regeln des Unternehmens anpassen. Je regelbewusster, desto seriöser, je konservativer, desto eher entsprechen sie den Regeln und Vorgaben der bestehenden Führungsmannschaft. Je steifer, desto eher kommen sie nach oben. Anstatt zu sagen, man sei erfolgreich, kann man auch sagen: Man hat sich nach oben versteift. Ob die wirklich erfolgreich sind? Wer strebt denn nach Erfolg? Immer die Erfolglosen. Also wenn Ihr Chef auf der Bühne steht und darüber spricht, Erfolg haben zu wollen, dann wissen Sie, wer oben steht. Und dass Erfolg Glückssache ist, kann jeder Versager bestätigen, aber eben auch nur dieser. Erfolg ist niemals das Ziel, sondern etwas, das sich einstellt, wenn das Ziel erreicht ist.
Dass Erfolg Glückssache ist, kann jeder Versager bestätigen. Erfolg ist niemals das Ziel, sondern etwas, das sich einstellt, wenn das Ziel erreicht ist.
Und warum sitzen oftmals diejenigen schlussendlich am längeren Hebel, die ursprünglich den Kürzeren gezogen haben?
Gibt es irgendeine Institution, die uns rät, die bestehenden Regeln zu brechen? Das wäre ein Paradoxon. Aber alle wirklich erfolgreichen Menschen sind Regelbrecher. Überraschend viele von ihnen sind Schul- oder Studienabbrecher. Und warum sitzen oftmals diejenigen schlussendlich am längeren Hebel, die ursprünglich den Kürzeren gezogen haben? Die meisten haben ihre Branche auf den Kopf gestellt. Keiner von ihnen hat gemacht, was andere ihnen vorgegeben haben. Wer Chancen im Leben nutzen will, wer an seinen Träumen festhalten will, muss seinen persönlichen Weg finden, sich den Institutionen zu widersetzen. Das schaffen offenbar leider nur die wenigsten.
Die schlimmste, weil prägendste Institution sind die Eltern. Sich ihnen zu widersetzen ist am allerschwierigsten, denn wir lieben sie ja. Wenn die Eltern sagen: »Das ist nichts für dich!«, dann hören wir auf, davon zu träumen, Kontrabass spielen zu lernen, denn wir wollen Mutti nicht traurig und Papi nicht wütend sehen. Wenn Eltern sagen, dass Kinder etwas nicht können, dann ist das eine institutionelle Aussage. Ein Kind hört bis zu seinem 18. Geburtstag circa 150 000-mal Aussagen wie »Das kannst du nicht!«, »Das ist nichts für dich!« und so weiter. Das Schlimme daran ist weniger, dass Menschen diese Aussagen treffen. Das Verheerende daran ist: Unsere Kinder glauben es!
Kritisieren kann jeder Depp – und die tun es auch noch.
Solche Kritik kann zerstören, auch wenn sie konstruktiv gemeint ist. Mir sträuben sich bei dem Begriff »konstruktive Kritik« immer die Haare. Bei mir bleibt einfach das Gefühl, dass ich immer noch die Bratpfanne auf den Kopf bekomme – jedoch wird sie vorher in Geschenkpapier eingewickelt. Kritisieren kann jeder Depp – und die tun es auch noch.
Und dabei handeln die Eltern, die Lehrer, die Berufsberater, Lehrherren, Chefs, Banker und Pfarrer, die uns den rechten Weg durchs Leben zeigen wollen, ja gar nicht böswillig, sondern nur realistisch und »erwachsen«. Sie wollen nur das Beste für uns: nur ja kein Risiko eingehen! So wie Chris Gardner, bevor er merkt, wie beschränkt das ist.
»Du wirst es unterm Strich nicht weit bringen …«
Chris Gardner versucht alles, um den Lebensunterhalt für sich und seinen kleinen Sohn Christopher zu verdienen. Als selbstständiger Handelsvertreter, der klinkenputzend im San Francisco der 80er-Jahre von Arztpraxis zu Arztpraxis tingelt, ist das ein hartes Stück Brot. Die Knochendichtemessgeräte, die er verkaufen muss, sind so angesagt wie warmes Bier zum doppelten Preis an einem Regentag.
Ihm ist klar, dass sein Einkommen hinten und vorne nicht reicht. Er kann schon bald die Miete nicht mehr bezahlen, und das Finanzamt bucht gnadenlos die Steuern ab. Zu der handfesten Angst, sich und seinen Sohn finanziell nicht mehr durchzubringen, gesellt sich die Scham, kein guter Vater zu sein. Ein Vater, dem die Frau davongelaufen ist, einer, der nie Zeit hat für seinen Sohn, weil er Tag und Nacht arbeiten muss, um am Ende doch nicht über die Runden zu kommen. Ein Versager.
Als er mit seinem Sohn zwischen zwei Arztpraxisbesuchen eine Runde Basketball spielt, sagt er zu ihm: »Du wirst wohl mal so gut spielen wie ich früher. So läuft das meistens. Und …«
Sein Sohn hört auf zu werfen und schaut ihn an.
»… und ich war nur unterer Durchschnitt. Das heißt, du wirst es unterm Strich auch nicht so weit bringen. Du hast sicher viele andere Talente. Nur das hier nicht.«
Chris schaut seinen Sohn streng an: »Ich will nicht, dass du Tag und Nacht mit dem Ball durch die Gegend rennst. Verstanden?«
Die Begeisterung des kleinen Christopher ist auf einen Schlag verflogen. Er kann sich zu keinem einzigen Wurf mehr aufraffen.
So zerstört man Träume. Chris Gardner scheint nicht nur finanziell arm, sondern auch noch charakterlich minderbemittelt zu sein. Wie kommt er nur auf die Idee, seinen Frust an einem Sechsjährigen auszulassen? Seine Minderwertigkeitskomplexe auf seinen eigenen Sohn zu projizieren? Fühlt er sich ein kleines Stück größer, wenn er ein Kind ein kleines Stück kleiner macht? Wie armselig.
Als ich Will Smith als Chris Gardner in dieser Szene des Hollywood-Streifens Das Streben nach Glück von 2006 sah, wollte ich schon aufstehen und das Kino verlassen. So ein depressiver Jammerlappen, das war ja nicht zum Aushalten. Selbstzweifel habe ich selbst schon genug. Musste ich mir das antun? – Doch dann kam die Wende.
Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen.
Chris sieht seinen Sohn an und weiß mit einem Schlag, was er angerichtet hat. Anstatt in sich zusammenzusinken und in Selbstmitleid zu vergehen, statt sich wie alle vorzumachen, dass man eben realistisch bleiben muss, klammert er sich an den Maschendrahtzaun hinter dem Spielfeld, zieht sich hoch und schaut in die Ferne. In seinem Gesicht zieht eine wilde Entschlossenheit auf, ein aufrechter Wille, ein verletzter, aber noch nicht gebrochener Stolz: »Hey«, sagt er leise zu seinem Sohn. »Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir! Okay? Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, versuchen sie dir immer einzureden, dass du’s auch nicht kannst … Wenn du was willst, dann mach es! Basta!«
Und natürlich meint er damit sich selbst genauso wie seinen Sohn. Er schnappt sich das blöde Knochendichtemessgerät und stürmt los, er will sich einfach nicht unterkriegen lassen. Er sieht auf der Straße einen Mann aus einem roten Ferrari aussteigen und fragt ihn zwei einfache Fragen: »Was tun Sie beruflich?« und »Wie tun Sie es?« Chris hört gut zu und sucht dann seine Chance: Bei einer Investmentbank bekommt er ein sechsmonatiges Praktikum angeboten. Unbezahlt. Das bedeutet, er muss nebenher weiter Klinken putzen, noch mehr arbeiten, hat noch weniger Zeit für sein Kind. Er arbeitet bis zur totalen Erschöpfung. Und dann treibt das Finanzamt seine Schulden ein, und der Vermieter schmeißt ihn raus. Chris und Christopher landen auf der Straße und müssen im Müll schlafen. Aber Chris gibt nicht auf.
Die Abschlussprüfung des Praktikums nach sechs beinharten Monaten ist wie ein Symbol für die große Lebensprüfung, die Chris durchlitten hat – er besteht beide. Die Investmentbank stellt ihn ein. Am Ende wird er ein erfolgreicher Börsenmakler, und das ist noch nicht einmal Fiktion, sondern eine wahre Geschichte. Und später wird er mit seiner eigenen Firma zum Millionär und unterstützt heute zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen, darunter die Kirche, in der er damals mit seinem Sohn Unterschlupf gefunden hatte. In der Stadt, in der er einst obdachlos war, finanzierte er ein Wohn- und Beschäftigungsprojekt für armutsbedrohte und obdachlose Menschen, und er berät und unterrichtet ehrenamtlich Obdachlose.
Er hatte sich nicht zufriedengegeben mit den kleinen grauen Kritzeleien auf seiner Lebensleinwand.
Wow. Er hat es wirklich geschafft. Er hatte sich nicht zufriedengegeben mit den kleinen grauen Kritzeleien auf seiner Lebensleinwand. Er setzte zum großen Strich an. Und weil er eine Vorstellung von einem größeren Leben hatte, weil er eine Skizze im Kopf hatte, erkannte er seine Chance, als sie sich ihm bot. Und nutzte sie.
Hundeleben
Wenn gar ein kleiner Handelsvertreter ohne Geld, Glück und Geschick es schaffen kann, dann ist es mir zu einfach, die Schuld auf Eltern, Schule und Gesellschaft zu schieben. Um glücklich zu sein, müssen wir nur das aufgeben, was uns unglücklich macht.