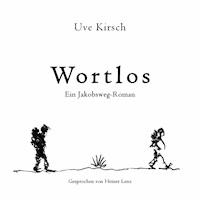Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
West-Berlin 1988, die Insel im Roten Meer schwimmt in Subventionsgeldern. In der Mauerstadt feiert man sich selbst, doch mit Gorbatschows Glasnost-Politik bläst ein frischer Wind durch die alten Strukturen. Berlin wird zur Drehscheibe zwischen Ost und West. Der Hype um die Russen nimmt groteske Züge an und jeder will mit den Russen reden und sich mit ihnen schmücken. Ein Kulturklub aus Politikprominenz springt auf diesen Zug auf und soll ein Kunstprojekt veranstalten, eine Ausstellung über sowjetische Kunst und Architektur. Geld fließt im Überfluss, doch die Sache hat einen Haken: Es gibt niemanden, der Ahnung von der Materie hat. Ulf König ist zwar unbelastet von Fachwissen, doch er weiß wie man Kompetenz simuliert. Er soll das Projekt managen. Ein Abenteuer beginnt, das in den Dschungel der Berliner Kulturszene und hinter den Eisernen Vorhang in Russland führt. Mit von der Partie sind Parteivorsitzende, Senatoren, führende Kirchenleute, Universitätspräsidenten und Museumsdirektoren, die alle ein Stück vom Ruhm abhaben wollen. Überall knallen die Krim-Sektkorken und glühen die Mikrofone, doch dann kommt die Wende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uve Kirsch
Schaum
Die Geschichte vom ersten westdeutschen Wendeopfer
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Niemandsland
Plötzensee, Ende August 1988
Lübeck
Bibliothek
Senatsbibliothek
Cafeteria
Mittag
Kunsthalle
Ein russischer Abend
Finale
Days After
Samstag
Morgengrauen
TU Berlin, LABA – Institut
Rybkov
Restaurant Elsass
Präsidialbüro der TU Berlin
Hinterzimmerdiplomaten
Vorarbeit
Sabotage
Büro Team Stadtmarketing
Sowjetische Botschaft
Schönefeld
Scheremetjewo II
Später, Vormittag
Nachtfahrt nach Moskau
Frühstück
Nachttanz
Gefreut
Hotelbar Hotel Rossija
Roter Platz
Rückfahrt Scheremetjewo
09.11.89 morgens
Home, sweet Home
Helden für einen Tag
Es geht los
Kleine Gefallen
Lange Tage
Rybkov Riva.
State of Art Design
Zeichenknechte
Schrankwand
Back in USSR
Schnell Reich
Kunst und Vision
Wahlverlierer
Team
Die Probe
Müggelsee
Die Preview
Neid
09.11.89 abends
Stress
Katalog
Kopenhagen
Exponate
Endspurt
Kataloge
10.11.1989 morgens
Pressekonferenz
D-Day
Hinter den Hochhäusern
Parkschranke
Nachfeier Cedelius Club
Interhotel Stadt Berlin
Impressum neobooks
Niemandsland
Uve Kirsch
Schaum
Die Geschichte vom ersten
westdeutschen Wendeopfer
Es hat Frost gegeben in der Nacht. An der Außenseite der Fenster sitzen Eiskristalle und verzerren die Sicht auf die Außenwelt. Alles ist verschwommen. Ich schäle mich aus meinem Schlafsack und setze Kaffeewasser auf. Ich warte und rauche. Kalter Wind zieht durch den Spalt der geöffneten Tür. Die Scheiben meines Wagens sind mit einer dünnen Schicht aus Eis überzogen, an den Kotflügeln und an der Dachkante sitzt weißer Reif und taucht meinen braunen Passat in einen cremigen changierenden Pastellton. Am Horizont, bei den alten Eichen, steigt ein Schwarm Krähen auf. Eine Möwe ist von der Ostsee herüber geflogen und landet auf der Grasböschung des kleinen Teiches, dessen Ränder ebenfalls gefroren sind. Ein Entenpärchen schwimmt darin seine Runden und hält so die Mitte des Gewässers eisfrei.
Das Kaffeewasser kocht und ich lasse es durch den Filter laufen. Während ich warte lege ich ein paar Holzscheite in den Ofen. Als sie Feuer fangen wird es augenblicklich wärmer. Neben dem Ofen hängt ein feucht stinkender, sandiger Trenchcoat. Ich schenke mir einen Kaffee ein, rauche und denke an nichts Bestimmtes. Ich beobachte die Möwe bei ihrem Versuch, meine Mülltüte zu öffnen. Die hatte ich gestern Abend aus dem Eimer genommen, die Öffnung zusammengebunden und draußen neben den Vorderreifen meines Wagens gestellt. Das musste ich gemacht haben, bevor ich mich mit dem Buch und der Wodkaflasche ins Bett gelegt hatte. Mit ihrem Schnabel hackt sie seitlich ein Loch in die Plastiktüte. Sie stößt auf Aluminium, die Verpackung meines Imbisses vom China-Grill. Er war der einzige Laden, der überhaupt noch geöffnet hatte, als ich gestern am frühen Abend aufbrach, weil ich es vor Hunger nicht mehr aushielt. Ich hatte den gesamten Tag die Hütte nicht verlassen. Was ich genau getan hatte, weiß ich nicht mehr. Der Aschenbecher war am Ende des Tages übervoll und mein Tabaksbeutel leer. Also hatte ich geraucht. Mehr nicht.
Mit dem Trinken und Lesen hatte ich erst später angefangen, daran erinnere ich mich noch. Ich konzentriere mich. Was geschah nach dem Essen? Der China – Mann brauchte lange für sein Chop-Suey mit Huhn und Reis. Ein Bier durfte er mir nicht verkaufen. Es war Sonntag. Ich war der letzte Gast. Entsprechend lecker waren die vorgekochten Speisen. Er schloss hinter mir ab, kaum dass ich seinen Laden verließ. Ich nahm mein Essen, fuhr durch die leere, verlassene Stadt, die aufgegeben hatte, sich gegen die Herbstnacht zu wehren und überquerte den Sund in Richtung des Campingplatzes. So war es gestern Abend.
Dort bin ich allein mit den Enten und Möwen. Der Besitzer kommt alle paar Tage kurz vorbei und schaut nach dem Rechten, kontrolliert die Warmwasserboiler und die Stromversorgung, bringt den Müll weg. Er respektiert meine selbstgewählte Isolation und drängt mir kein Gespräch auf. Genau so will ich es.
Ich bin hierher geflohen, von Berlin, ein paar Tage nach der Eröffnung der Ausstellung, nachdem die Verhandlungen mit den Russen und den Investoren aus der Wirtschaft zu einem guten Ende gebracht waren. Hohl, leer, ausgelaugt, von zwanzig-Stunden-Tagen, von monatelangem Stress, vom Doktor. Eines Morgens wache ich auf, starre die Decke an, bin unwillig aufzustehen. Alles ist sinnlos. Alles ist unendlich anstrengend. Ich bleibe liegen, ignoriere das klingelnde Telefon. Mittags liege ich immer noch im Bett, unfähig zu jeder anderen Handlung. Allein Kaffee zu kochen kostet Kraft. So schleppe ich mich bis zum Abend. Nachts liege ich wach. Der nächste Tag streicht vorbei und ich erinnere mich an gar nichts. Appetitlos, antriebsschwach, kraftlos trudele ich durch die Zeit, einem schwarzen Loch entgegen. Zwischen mir und der Welt eine drei Meter dicke Betonmauer, die alles Licht schluckt. In ein paar Tagen soll ich Irina in Kopenhagen abholen. Ich habe ihr einen Job verschafft. Sie wartet nur noch auf die Ausreiseerlaubnis, das Ticket ist schon reserviert. Nach ein paar Monaten in Dänemark soll sie nach Berlin kommen. So ist unser Plan. Aber ich liege nur angezogen auf meinem Bett und starre die Risse in der Zimmerdecke an.
Henning ruft an als ich zwei Tage nacheinander nicht im Büro auftauche. Ich gehe ran. Eine Stunde später ist er bei mir in meiner Wohnung. Wir reden drei Stunden lang. Am nächsten Morgen packt er mir meine Sachen und ich fahre Richtung Norden, in Richtung Kopenhagen, bis ich hier strande. Zufällig. Ohne Karte habe ich mich auf meinem Orientierungssinn verlassen, befinde mich am Ende einer Irrfahrt auf dieser langweiligen Insel zwischen Fünen und Langeland, deren Namen ich nicht einmal weiß. Leere Dörfer, keine Menschen. Kein Hotel. Schließlich stehe ich vor dem geschlossenen Tor dieses Campingplatzes, minutenlang umklammere ich das Lenkrad, der Wagen tuckert und ich bin unfähig, einen Entschluss zu fassen. Dann kommt ein alter Volvo, jemand steigt aus, schließt die kleinere Tür auf und öffnet den Briefkasten. Seit dem bin ich hier. Und verlasse die Hütte seit drei Tagen kaum.
Die Möwe zerrt an dem Aluminium und zerhackt die Schale in mehrere Teile. Etwas Reis hängt an der Innenseite und sie versucht, es mit ihrem Schnabel zu fassen. Ich breche etwas von dem chinesischen Reisbrot ab, öffne die Tür und werfe es einige Meter weit in die andere Richtung. Die Möwe erschrickt erst kurz, hüpft einige Zentimeter in die Luft, wendet sich dann aber interessiert dem Brot zu.
Als sie es zu fassen bekommt, öffne ich die Tür, gehe zum Wagen und lade die Tüte in den Kofferraum. Die Möwe trägt das Brotstück zwischen ihrem Schnabel und hüpft von mir weg in Richtung der Hecke. Ein zerknülltes Stück Papier fällt aus dem Schlitz in der Tüte und rollt auf dem Rasen, die Spitzen der Grashalme sind von Raureif überzogen. Hatte ich den Brief gestern Nacht geschrieben und dann – weil er mir nicht gefiel – zusammengeknüllt und in den Müll gefeuert? Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt einen Brief geschrieben habe. Ich saß am Ofen, da bin ich mir sicher. Aber habe ich zu Papier und Stift gegriffen? Den Abend davor, da habe ich geschrieben, ja daran erinnere ich mich. Aber gestern? Ich habe geraucht, vor dem Ofen gesessen und bin dann abends in die Stadt gefahren. Dann habe ich gegessen. Aber dann?
Der Wind fährt in das Papier und treibt es vor sich her, bis zur Kante des kleinen Teiches. An einem hochstehenden Grasbüschel bleibt es hängen, gehalten von einigen wenigen Grashalmen. Die aber stärker wirken als der übrige Rasen. Ist es eine andere Sorte? Wann hatte ich das letzte Mal etwas über verschiedene Rasensorten gehört? In den siebziger Jahren, als es Blaukorn gab, und Compo. Weidelgras, Schwingel und Straußgras kenne ich, da ich als Kind mal die falsche Sorte gekauft und von meinen Eltern entsprechend ausgeschimpft wurde. Aber das hier ist ein anderes Gras, feste, kräftige Stängel, hochgewachsene Halme, die unten von einem ockerfarbigen Schaft gehalten werden. Ich kenne es nicht. Ich werde mich erkundigen müssen. Vielleicht weiß der Besitzer Bescheid.
Ich fasse einen Entschluss. Heute werde ich einkaufen fahren. Dann werde ich das Postamt suchen und von dort ein paar Faxe nach Berlin senden.
Papier, wieder brauche ich Papier. Für den Abbauplan, die Exponatliste, die Liste mit den Notfallnummern.
Henning wird sie bearbeiten. Henning vertritt mich in dieser Zeit. Von meinem Partner kann ich das nicht erwarten und tue es auch nicht. Er hat sich nach Rom verzogen, vor Wochen schon, kaum dass das Händeschütteln, Interview-Geben und Redehalten vorbei waren. Die Restarbeiten sind unter seiner Würde. Das Nachverhandeln mit den Russen und den Dänen überlässt er ebenso mir, wie er den Projektabrechnungen keine Minute seiner Zeit widmet. Und der Abbau und die Sicherung der Kunstwerke fallen auch nicht in sein Ressort – seiner Meinung nach. Er geht dann einfach und entspannt seinen geplagten Geist im Angesicht von Piranesi, Michelangelo und Bramante.
Soll er. Das ist gar nicht so schlecht. Seine Abwesenheit verschafft mir Raum. Dann muss ich wenigstens nicht noch gegen ihn ankämpfen. Mit seiner ewigen Diskutiererei kann er einem mächtig auf die Nerven gehen. Meist geht es gar nicht so sehr um die Sache an sich, sondern einfach nur darum, Recht zu behalten. Am Ende hat er immer Recht, weil seine Gesprächspartner einfach aufgeben und sich erschöpft in sicheres argumentatives Niemandsland schleppen. Dort bleiben sie dann, unlustig, demotiviert, genervt. Und er behält in der Diskussion wieder mal die Oberhand. Das ist ihm wichtig. Die Deutungshoheit zu besitzen, klüger zu sein, mehr zu wissen, Zusammenhänge zu erfassen und zu vermitteln. Thesen zu postulieren. Nur ist damit für die konkrete Sache, um die es geht, noch nichts gewonnen. Im Gegenteil. Das Problem besteht immer noch. Nur das jetzt die Kraft fehlt, sich darum zu kümmern. Er ist ein Krafträuber. Aber wenigstens hat er Recht bekommen. Wie jedes Mal.
So sitze ich jetzt hier, auf diesem Niemandsland von einer Insel, entkräftet, müde, deprimiert. Nicht allein er hat Schuld an meiner Situation, nein, das nicht, andere waren auch involviert. Doch er steht dabei ganz weit vorn. Zur Strafe habe ich seinen Teil der Beute aus unserem gemeinsamen Projekt behalten, ein historisches Skizzenheft, aber er weiß es noch nicht. Es ist wertvoll, sehr wertvoll sogar, mal sehen, was ich damit anfangen werde. Oder ist das nur meine bitterböse Abrechnung am Ende einer langen, schwierigen Beziehung?
Dabei hatte es eigentlich ganz vielversprechend angefangen.
Plötzensee, Ende August 1988
Der Holzsteg war warm unter meinen Füßen und schwankte leicht, als der Doktor sich aufrichtete, um seinen Kaffee in Empfang zu nehmen. Ich reichte ihm den Pappbecher und setzte mich. Er stellte den Becher neben sich ab und legte sich wieder auf den Bauch. Der Kaffee war ihm zu heiß. Das war einer seiner Macken. Er ließ Kaffee prinzipiell erst einmal abkühlen, bevor er einen Schluck nahm. Er hielt das für kultiviert. Er hatte einen Doktorgrad in Kunstgeschichte und ebenfalls einen in Philosophie. Aber wenn ich ihn „Doppel-Doktor“ nannte, war ihm das nicht ehrfürchtig genug. Aber das zweifache „Dr.“ vor seinem Namen gab ihm den Anstrich eines Adelstitels. Er zählte sich zu den intellektuell Unantastbaren, bekam aber in der Realität keinen Nagel in die Wand. Aber über‘s Kaffeetrinken wusste er Bescheid, meinte er jedenfalls.
Eine lustlose Augustsonne beschien träge den See, bereit, sich bald ganz dem Herbst zuzuwenden. Ein Restsommer, der uns noch unverhofft gegönnt wurde, nach einem Sommer, der so ganz anders verlaufen war, als ich es zu Beginn erwartet hatte. Am Anfang versprach er ein großer Erfolg zu werden. Unsere kleine Firma war mit einer guten Idee und einem schönen Projekt gestartet und es sah danach aus, als käme noch einiges nach. Am Beginn des Junis war ich frisch verliebt. Jetzt war die letzte Augustwoche, ich war Illusionen und Freundin los und die Aufträge waren auch abgearbeitet. Unser kleines Unternehmen steckte fest im Nichts. Es gab wenig zu tun, wir waren so gut wie arbeitslos. Deshalb saßen wir hier, an einem Dienstagmittag am Ende des Sommers. „Wenn nichts zu tun ist, kann man auch schwimmen gehen“, war Doktors Meinung und wie so oft war sie nicht ganz falsch. Unser großer Auftraggeber, die Universität, hatte ebenfalls noch Ferien. Genau dort hatte ich ihn vor ein paar Jahren kennen gelernt. Er war Dozent für Kunst- und Architekturgeschichte und ein brillanter Redner. Ich war sein begeisterter Student. Daraus entstand die Idee zu unserer kleinen und zurzeit erfolgfreien Firma.
Da war ich also, Mitte Zwanzig, seit einem Jahr selbstständig, ohne feste Freundin und ohne konkrete Arbeit und übte mich in Geduld. 1987 war vorbei, ein Kleinprojekt im Rahmen der 750Jahr – Feier konnte nicht mehr abfallen. 1988 war Berlin zwar Kulturstadt Europas, aber alle größeren Projekte und Ausstellungen waren schon vor langer Zeit verplant und vergeben – der Zug war seit langem abgefahren.
Keine Chance, an die Fleischtöpfe heranzukommen. Ich hatte keine guten Kontakte. Und was noch viel schlimmer war, ich hatte auch keine Idee. Der Doktor wirkte auch nicht gerade motiviert. Aber er war halbwegs auf der sicheren Seite. Als freier Unidozent hatte er zumindest während der Semester ein geregeltes Einkommen. Das hatte ich nicht. Dafür waren meine Hobbys nicht so kostspielig wie seine.
Die Situation war besorgniserregend, aber das Holz des Steges war angenehm warm, das Wasser erfrischend und der Kaffee lecker und anregend. Außerdem schien die Sonne.
Der Doktor wälzte sich von der Bauchlage auf den Rücken und richtete sich dann langsam auf. Er griff sich den Kaffeebecher, der jetzt nur noch lauwarm sein konnte.
„Am Freitag könnten wir nach Lübeck“, meinte er. Lübeck war die Stadt unseres ersten ernst zu nehmenden Auftrags, den wir dort vor einigen Monaten absolviert hatten. Das Projekt war beendet, aber Lübeck klang nie schlecht.
„Was sollen wir da?“ An Städtetouren hatte ich eigentlich wenig Interesse.
„Uns neu einkleiden“, erklärte er.
„Aha. Sonst geht’s?“, entgegnete ich.
„Dir fehlt jedes Verständnis für Stil, das muss ich jetzt mal sagen. Ob wir hier rumhängen oder nach Lübeck fahren, ist völlig egal. Wenn wir schon pleite sind, dann sollten wir es wenigstens vorher mal so richtig krachen lassen. Und hinterher gut dabei aussehen. Lass uns nochmal zu Bogart’s gehen und richtig was auf den Kopf hauen. Und neue Schuhe brauchst du auch.“ Er hasste meine robusten Treter.
„Aha. Und das ist finanziell sinnvoll?“ Mir war es einigermaßen egal, ob ich gut dabei aussah, wenn ich untätig zu Hause saß.
„Nee. Macht aber Spaß.“ Er fuhr sich durch seinen Scheitel und grinste wissend. „Und außerdem gibt es Sonderangebote bei Bogart‘s.“ So war er, der Doktor. Ich war modemäßig eher puristisch eingestellt. Jeans, T-Shirt, Jackett, das ging bei mir immer.
Bei ihm nicht. Teuer, wenig und exklusiv. Das war sein Motto. Was er bereit war für ein T-Shirt mit dem richtigen Label auf den Tisch zu legen, entsprach meinen Ausgaben für Nahrungsmittel für eine ganze Woche. Dafür war er aber stets und ständig besser gekleidet. Er verbrachte mehr Zeit vor dem Badezimmerspiegel als meine frische Ex. Das war an sich schon schwierig, denn der Inhalt ihres Schminkschrankes verhielt sich umgekehrt proportional zum Inhalt ihres Kopfes und das war auf Dauer nicht zu ertragen. Doch der Doktor schlug sie um Längen, denn sein Badezimmerregal war so breit wie ein mittlerer Bücherschrank und bis oben hin gefüllt mit Wässerchen, Duftflakons, Haarpflegemittel und Hautreinigern. Die Badezusätze füllten ein ganzes Regalfach. Dafür gab er sehr viel Geld aus. Zugegeben, die Mittelchen rochen gut, waren aber nichts als flüchtiger, warmer, teurer Schaum.
Ich benutzte noch nicht einmal ein Deo. Ich war bekennender Nassrasier und nahm dazu Kernseife. Ok, das war nicht jedermanns Sache, aber ich verbreitete so eine Camel-Trophy-Aura um mich herum.
Das tat der Doktor nicht. Das hatte er nicht nötig, denn er war nicht dumm, im Gegenteil. Zog man seine Eitelkeit, seine aufgesetzte Manieriertheit und seine Grundarroganz von seinem Auftreten ab, war er einer der gebildetsten Menschen, denen ich je begegnet war. Unter seinem Robert-Palmer –Scheitel saß ein ganz ordentlich funktionierender Denkapparat. Deshalb hatten wir auch in eine gemeinsame Firma. Weil wir uns ergänzten. Davon waren wir zwar überzeugt, die restliche Welt aber offensichtlich nicht, denn wir standen derzeit ohne Auftrag da. Wir hatten Eisen im Feuer, aber keines war heiß. Also hatten wir Zeit.
Lübeck, die Mittelalterstadt par excellence. Der Doktor war verliebt in Lübeck, das wusste ich. Ein kleines bisschen war ich das auch. Ich war auch nicht so pleite wie er, da ich kaum Kosten hatte und eigentlich sehr sparsam lebte. Ich hatte noch nicht einmal ein eigenes Auto. Doktors Liebe für diese Stadt und ihre Geschäfte ging so weit, dass wir damals unsere Projektbesprechungen mit regelmäßigen Boutiquebesuchen verbanden. In der Regel verschwand er stundenlang in den Ankleidebereichen, während ich mir, hatte ich mir ein Hemd oder ein Shirt zugelegt, die Beine in den Bauch stand und vor dem Laden wartete. Damals lernte ich eine Menge über Mode. Der Doktor hätte sich jederzeit als Stil- und Geschmacksberater selbstständig machen können. Für ihn war ich eine style-mäßige Diaspora. Er meinte, zum Erfolg einer Firma gehört auch stilvolles modisches Auftreten. Dem konnte ich nur eingeschränkt und widerwillig zustimmen, behielt aber dennoch die Wranglers im Schrank und die Lederjacke am Garderobenhaken.
„Ok. Meinetwegen. Aber wieso am Freitag?“, fragte ich.
„Morgen ist der Wagen zur Inspektion, am Donnerstag muss Karen auf eine komische Veranstaltung in Potsdam mit dem Leiter ihres Instituts. Da weiß sie nicht, wann sie wieder zurück kommt. Also bleibt nur der Freitag. Am Samstag soll das Wetter schlechter werden und die Läden schließen am Mittag“, erklärte der Doktor.
„Logisch.“
Karen war seine Lebensgefährtin und die Mutter seines Sohnes, um den sich alles drehte in seiner Kleinfamilie. Karen war die stabile Säule der Familienfinanzierung, denn sie hatte eine feste Stelle als Dozentin im Institut für Stadtsoziologie. Ihr stand sogar eine eigene Sekretärin zu, die wir gelegentlich dafür einspannten, unsere Projektpapiere abzutippen.
„Weiß Karen davon?“
„ Die will auch mit. Eigentlich war das auch ihre Idee“, gab er zu und das war selten, dass er jemanden freiwillig den Vortritt ließ, wenn es um Ideen ging.
Der Plan klang bescheuert genug, um mich zu überzeugen. Da konnte ich nicht nein sagen.
„Okay.“
Ich stand auf und sprang in den See und hoffte, die aufspritzende Wasserfontäne würde seinen wohl gecremten Rücken bespritzen.
Ich blieb lang unter Wasser und drehte mich beim Auftauchen auf den Rücken. Ein Entenpärchen erschreckte sich bei meinem Sprung und es flüchtete empört in sichere Gefilde. Der Doktor hatte einige Spritzer abbekommen und tupfte seine gerötete, mit Sommersprossen gesprenkelte Brust wieder trocken.
„Hey, du Held, komm rein!“, rief ich ihm zu.
Er wusste nicht, ob er die spöttische Bemerkung auf sich sitzen lassen sollte, entschied sich nach einigem Zögern dann aber doch dafür, ein Badeheld zu sein.
Mit betont vorsichtigen Bewegungen begab er sich an die Stegleiter und stieg sie hinab, jeder Schritt ein Akt bewusster, kontrollierter Handlung. Als er bis zum Ansatz seiner Badehose hinab gestiegen war, prüfte er noch mit seiner linken Hand den stabilen Sitz seiner Robert Palmer Frisur und stürzte sich in die trüben Fluten. Beim Schwimmen behielt er den Kopf über Wasser und sah dabei aus wie ein Badeentchen kurz vor dem Ertrinken. Aber die kurzen Härchen seiner ausrasierten Pop-Star-Frisur blieben trocken. Leider begrüßten uns keine tanzenden Models am Steg, die so taten, als könnten sie Musikinstrumente bedienen. Auch räkelte sich niemand lasziv auf dem Badetuch, als er, jeden Muskel bewusst und kontrolliert angespannt, den Bauch eingezogen, die Leiter wieder hoch stieg. Das war seine größte Fantasie, so begehrt zu sein, wie Robert Palmer immer tat. Der Doktor ging nicht Baden. Der Doktor nahm ein Bad. Und die Frisur blieb trocken.
Lübeck
Über mir dehnte sich ein blauer, rechteckiger Spätsommer-himmel, der von einem kleinen Passagierjet durchschnitten wurde und dessen Kondensstreifen ihn in zwei ungleiche Dreiecke zerteilte. Unter mir lag ein mittelalterlicher Pflasterbelag und vor mir die Arbeitslosigkeit. Der Konsumrausch erschöpfte mich und spülte mich schließlich auf den mittelalterlichen Marktplatz der Hansestadt, wo ich mich bei einer Tasse Kaffee erholte.
Ich hatte irrsinnige tausend Mark verschleudert und neben mir standen nun drei prall gefüllte Plastiktüten mit einem Designertrenchcoat, ein paar Seidenhemden und einem Paar Schuhe, deren Preis allein einer Monatsmiete entsprach. Hinter mir lagen eine zweistündige Anprobe unterschiedlicher Textilien und eine ausführliche Geschmacksberatung durch Karen. Ich hatte mich geschlagen gegeben – die Schuhe hatte der Doktor ausgesucht und ich hatte mich kampflos ergeben - und würde mich für kurze Zeit so verpacken, wie sie es sich vorstellten. Nachdem sie mich adäquat eingekleidet hatten, kümmerten sie sich ausgiebig um ihre Kostümierungsbelange. Eine Weile stand ich gelangweilt daneben und gab auf Nachfrage meine sachunkundige Meinung zur Anprobe kund, aber im Grunde ging es mir am Arsch vorbei.
Ich trank meinen Kaffee und betrachtete die geballte Ladung Backsteinpracht, die mich umgab. Eigentlich ging es mir gar nicht so schlecht. Ich hatte noch Rücklagen und ein abgeschlossenes Studium - auch wenn mir Berufspraxis fehlte. Dafür hatte ich einige respektableProjekte realisiert, die sich in meinem Bewerbungsbogen als sehr präsentabel erweisen würden. Die Zukunft war ungewiss, ja klar, aber nicht düster. Ich war ungebunden. Ich war mobil. Ich konnte machen was ich wollte. Ich müsste mich nur aufraffen. Wir hatten noch Eisen im Feuer, unser Pulver war noch nicht verschossen. Und wenn das nicht zündete, war ich jetzt vorbereitet auf die Jobsuche, denn ich würde gut dabei aussehen. Für ein Bewerbungsgespräch wären die Sachen sicherlich hilfreich. Immerhin.
Ein Lachen holte mich aus meinen Gedanken, der Doktor kam, beladen mit Tüten aus hellbraunem Papier und grauen Kunststoff. Karen trug zwei bedruckte Kartons. Sie waren fröhlich wie Kinder, berauschten sich am Glanz ihrer Beute. Gut gelaunt zählten sie mir ihre Eroberungen auf.
Sie hatten jeder gerade ein Monatseinkommen auf den Kopf gehauen. Es hätten aber auch zwei sein können. So genau wusste ich das nicht.
Mit meinem Tausend-Mark-Einkauf war ich in den Augen des Doktors knauserig. Karen und er kannten keine Grenze, wenn es um Klamotten ging. Gut auszusehen bedeutete alles, das war wichtiger als alles andere. Dann kam gut essen. Dann die Einrichtung. Gespart wurde in umgekehrter Reihenfolge. Ein anders geartetes Konsumverhalten ließen sie nicht gelten, das hatte für sie keine Relevanz. Jemand, der sich nicht bei Kenzo oder Yamamoto einkleidete, war für sie ein Prolet, ein niederes Wesen. Ihre Verachtung war denen sicher. Wie das mit ihrem links-liberalen Weltbild zusammen ging, erschloss sich mir nicht. Man musste nicht abgerissen aussehen, um sich mit der arbeitenden Klasse solidarisch zu fühlen. Doch trug das Tragen von Designermode in der Preisklasse eines durchschnittlichen Arbeitereinkommens durchaus dazu bei, Grenzen aufzuzeigen. In Jeans und T-Shirt, in denen ich manchmal auflief, allein um sie zu provozieren, belastete ich ihren Geschmackssinn. Mir machte es Spaß zu sehen, wenn sie sich ärgerten.
Der Doktor fuhr. Apathisch ließ ich die eintönige Landschaft Schleswig-Holsteins an mir vorbeiziehen und fiel in einen kurzen flachen Schlaf. Der Halt an der Grenze holte mich zurück in die Wirklichkeit. Karen rüttelte mich wach. „Deinen Pass!“ Ich fummelte meinen provisorischen Personalausweis aus meinem Portemonnaie und gab ihn dem Doktor. Er reichte die Personaldokumente durch das Fahrerfenster weiter in das Kontrollhäuschen und der emotionslose Grenzkontrollbeamte winkte sie mit einer knappen Handbewegung weiter. Links von uns lief ein Förderband in einem ummantelten Gehäuse, auf dem unsere Papiere gerade transportiert wurden. Dann verschwanden sie in einer Art fensterlosem Vorbau, wo sie näher durchleuchtet wurden, um dann in einem anderen Kontrollhäuschen wieder aufzutauchen. Wir standen in der Zone dazwischen, gefangen von Förderbändern, abgeriegelt von Wachhäuschen und Aussichtstürmen. Karen stöhnte. „Langsam gehen mir die Kontrollen auf den Geist, sage ich euch.“ Ich wusste erst nicht was sie meinte. Dann fiel mir ihr Termin in Potsdam wieder ein. „Wie war es denn gestern Abend? Um was ging es eigentlich?“, wollte ich wissen. Der Doktor gab kurz Gas und wir rollten in unserer Schlange eine Wagenlänge weiter. „Und was ist das für ein Verein?“ Das klang alles ein wenig seltsam.
„Der Cedelius Club? Das ist so ein deutsch-deutscher Kulturverein, der von der Politik vorgeschoben wird und kulturelle Events zum Thema Ost-West veranstaltet. Das gibt den hohen Tieren aus der Politik die Gelegenheit, sich unverfänglich auf dieser Bühne zu treffen und wichtige politische Initiativen vorzubereiten. Dafür ist dieser Kulturquatsch gut“, erklärte sie mir. „Was es nicht alles gibt!“, kommentierte ich, ohne sie wirklich zu verstehen.
„Und wie kommst du dazu?“, fragte ich sie und im Hintergrund stöhnte der Doktor leise und schüttelte den Kopf.
Karen holte Luft. „Der Leiter meines Fachbereiches heißt Hügelzwerg und ist Mitglied im Cedelius Club. Er hat für den Verein einen Antrag bei der Lotto-Stiftung gestellt. Dabei ging es entfernt um Architektur. Er hatte selber keinen genauen Plan und dachte, ich als Stadtsoziologin hätte ein Thema parat.“
„Was für ein Thema?“
„Das wussten die eigentlich selber nicht, das war echt skurril. Es sollte um sowjetische Architektur gehen, aber eine genaue Idee hatten sie nicht. Das ist ein Verein mit einem Haufen Prominenz aus Kultur, Kirche und Politik, aber richtig rausgekommen bei dem Termin ist so gut wie nichts.“
„Sowjetische Architektur? Das klingt schrecklich. Etwa so was wie „Neue Gesellschaftsformen in neuen Wohnsiedlungen?“ Die neue Gesellschaft wird formiert durch den urbanen Siedlungsbau?“
„Ja, genau so’n Zeug wird dabei rauskommen. Und weil die jetzt Geld von der Stiftung Klassenlotterie bewilligt bekommen haben, stehen die unter Zugzwang. Was sie nicht ausgeben, müssen sie wieder zurückgeben.“
„Das war das ganze Ergebnis von diesem Termin?“ Ich war erstaunt. So viele Teilnehmer und kein Ergebnis. Wozu gingen die dann in eine Sitzung?
„Eigentlich wissen sie bis jetzt nur, dass niemand Plattenbau in Nowosibirsk mit schönen neuen Komsomolzen zeigen will und keiner eine bessere Idee hat“, sagte Karen und der Wagen rollte wieder ein paar Meter vor. Der Doktor schüttelte immer noch seinen Kopf.
„Das ist ein echtes Problem: da beantragt Hügelzwerg für den Club die Mittel bei der Lottostiftung auf der Grundlage eines bestenfalls schwachsinnigen Konzeptes und dann bekommen die das auch noch bewilligt. Wahrscheinlich kennt der jemanden im Stiftungsbeirat. Normal ist so etwas jedenfalls nicht.“ Sie schüttelte den Kopf und verzog ihr Gesicht zu einem spöttischen Grinsen.
„Jetzt müssen die Mittel innerhalb des nächsten Jahres ausgegeben werden, sonst verfallen sie und müssen wieder zurück gegeben werden. Das wäre dann der totale Gesichtsverlust für den Cedelius- Club. Also werden sie irgendetwas machen. Was, weiß der Himmel.“
Wir rollten vor das letzte Kontrollhäuschen. „Dieser Hügelzwerg, ist der an deinem Institut?“
„Ja, eigentlich ist er auf dem Papier auch mein Chef. Er soll die Weiterbildung von berufsfernen Absolventen an der Universität weiter bringen. Aber in Wirklichkeit benutzt er sein Büro nur noch dafür, überflüssige Bücher zu schreiben, in denen er die Welt erklärt.
„Ein eitler Wichtigtuer.“
Der Doktor prustete los vor Lachen. Karen kommentierte: „Er kennt ihn.“ Der Grenzposten musterte uns kurz, Karen stupste den Doktor an, der sich langsam wieder beruhigte und sich dem Grenzbeamten in seinem Schalter zuwendete. Er strich eine Strähne, die aus der Robert-Palmer-Frisur gefallen war, sorgfältig zurück an ihren angestammten Platz, nahm die Pässe entgegen und gab Gas. Vor mir lagen zwei Stunden langweiliges Mecklenburg. Viel Zeit zum Nachdenken.
Bibliothek
Es könne später werden, das ergab der morgendliche Anruf beim Doktor. Es sei eh nicht viel zu tun, Fitnessstudio und Friseur waren seine weiteren Stichpunkte. „Jaja, klar!“, sagte ich, frühstückte in Ruhe zu Ende und freute mich auf einen konzentrierten Morgen im Büro.
Die Adresse „Hardenbergplatz Nr. 2“ klang repräsentativ, aber dahinter verbarg sich ein schmuckloses Büro schräg über einem McDonalds-Restaurant im Zentrum am Zoo, einem Hochhaus aus den Fünfzigern, das als städtebauliche Antwort auf die hohen Plattenbauten am Alexanderplatz im Westteil der Stadt am Bahnhof Zoo errichtet wurde. Dabei war das gar nicht unser Büro. Wir hatten zwar unser Firmenschild auf die Stahlzwischentür im Flur geklebt, aber das hatte Magnetstreifen und war einfach und schnell zu entfernen. Das Büro gehörte offiziell der TU Berlin, die es freundlicherweise dem Fachbereich Stadtsoziologie – dem Institut, an dem Karen unterrichtete, überließ, das es wiederum der Studiengruppe „Denkmal, Wirtschaft und Gesellschaft“ zur Verfügung gestellt hatte.
Und diese Studiengruppe bestand genau aus zwei Personen, dem Doktor und mir.
Okay, das war deutlich mehr „Schein als Sein“, aber wir mussten als junge kleine Firma schließlich sehen, wo wir blieben. Also blieben wir hier.
Wir teilten uns die gleiche Telefonvorwahl mit der TU Berlin, die postwendend darauf verzichtete, die Kosten an uns weiterzugeben. Die fielen innerhalb der Institutsetats gar nicht auf. An der Tür prangte zwar das Schild „Team Stadtmarketing“, doch das irritierte niemanden und lästige Nachfragen wurden nicht gestellt. Kontrolliert wurden wir nie. Der Reinigungsservice betrachtete uns als eine Art Unterinstitut und versah routiniert seinen kostenlosen Dienst. Das hielt den Doktor jedoch nicht davon ab, sich gelegentlich über schlechte gesaugte Teppichböden in der Servicezentrale zu beschweren. Den Mut hatte ich nicht.
Ich sah die Post durch und entdeckte nichts von Belang.
Ich kochte mir einen Kaffee – das einzige Betriebsmittel, das wir aus eigener Tasche zahlten, aber man kann nicht alles haben. Aber fast alles, denn auch unser Bedarf an Papier, Schreibwaren und Aktenordnern entstammte dem Materialfundus der Technischen Universität. Ich legte meine Füße auf der Fensterbank ab und beobachtete den wuseligen Verkehr auf dem Hardenbergplatz. Eine Gruppe von BVG-Fahrscheinkontrolleuren stand rauchend bei einem der postmodernen Häuschen, die im Rahmen der neuen Modernisierung am Eingang des Platzes zur Hardenbergstraße gestellt wurden. Einige Jahre zuvor hatte ich mit zwei ähnlich spaßorientierten Kommilitonen an diesem Wettbewerb teilgenommen. Der von uns investierte Zeitaufwand war äußerst überschaubar und wir belegten mit einem zwar visionären jedoch einigermaßen schlampig gestalteten Entwurf einen respektablen dritten Platz. Das brachte uns sowohl eine lobende Erwähnung in der Laudatio des Jurysprechers als auch ein kultiviertes Besäufnis mit erstklassigem Rotwein im Foyer der Hochschule der Künste ein. Schade, das war lange her. Damals lag die Zukunft noch ungeplant vor mir und alles war mehr oder weniger ein Spiel. Nichts war ernst. Das brachte mich wieder zurück in die Gegenwart. Ich nahm mir Karens Kulturklub wieder vor. Was sie erzählt hatte, klang nicht übel. Potentielle Auftraggeber, die sich zwar ratlos, aber mit Geld ausgestattet auf eine scheinbar ausweglose Situation zu bewegten, waren nicht das Schlechteste, was uns gerade zustoßen konnte. Zumindest erschien es mir wert, mich damit mal näher zu beschäftigen. Alternativen gab es nicht, ich hatte eh nichts anderes zu tun. Also fing ich an. Der Doktor konnte mich nicht stören, er war beim Friseur. Oder war es das Fitnessstudio?
Was wusste ich über Russland, deren Architektur, deren Stadtsoziologie? Ich nahm einen weißen A4-Zettel und schrieb alles auf, was mir zu diesem Thema einfiel. Leninmausoleum, Kreml, stalinistische Zuckerbäckerarchitektur, Moskauer U-Bahn, Winterpalast, GUM, Bolschoi-Theater. Aus Doktor Schiwago kannte ich noch den großen Wolga-Kanal und den Arbat. Das war alles. Mein Wissen über russische Architektur passte auf die Rückseite einer Busfahrkarte, wenn ich klein schrieb. Noch. Es war unwahrscheinlich, dass es sich bei Leuten, die nicht vom Fach waren, anders verhalten sollte. Unter Blinden ist der Einäugige König. Und wenn die anderen noch unwissender waren als ich, dann war es einen Versuch wert.
Senatsbibliothek
Mein Ausweis für die Senatsbibliothek war noch gültig. Offiziell war ich sowohl Student, als auch freier Mitarbeiter. Den leise vorbeilaufenden, mit Büchern beladenen Studenten fühlte ich mich überlegen, denn ich hatte schon einen Abschluss, war selbstständig, war im richtigen Leben angekommen. War das hier das richtige Leben? Es fühlte sich nicht so an.
In der Architekturabteilung arbeitete ich mich vor bis zur Architekturgeschichte Russlands während der Revolutionsjahre. Ich fand ein Dutzend Bücher und Bildbände und lud sie auf meinen Handwagen. Mit dem Wägelchen in der Hand suchte ich mir eine ruhige Ecke. Ich legte mir meinen Block und meine Stifte zurecht, stellte die beiden verschieden farbigen Rollen Klopapier auf den Tisch und fing an zu blättern. Ich stieß auf Namen wie Rodtschenko, Tatlin, Wesnin, Schussew, Chidekel, fand Verweise zur Kunst, zum Konstruktivismus und dem Suprematismus. Ich verstand nicht viel. Ich stieß auf einen internationalen Architekturwettbewerb zu Beginn der zwanziger Jahre, entdeckte Corbusiers Beitrag hierfür, fand spannende Entwürfe für offizielle Gebäude, für das Lenin-Mausoleum und das Ehrenmal für die III. Internationale. Ich legte ein weißes Blatt Klopapier zwischen die Seiten, die mir interessant erschienen. Nach einer Stunde hatte ich alle Bücher durchgesehen. Die Erläuterungstexte würde ich mir später und die Analysen von Wissenschaftlern nie ansehen. Ich legte mir eine Übersichtstabelle an und beschriftete sie mit „Zeitraum“, „Wer?“, „Was?“ und „Thema“. Darin trug ich die Jahreszahl, die Art des Bauwerks und den Architekten ein. Nebenbei fiel mir noch ein Bildband mit Revolutionsfotos in die Hände. Dort entdeckte ich dutzendfach Lenin, wie er gestikulierend auf den Rednerpulten stand. Die Pulte hatten eine eigene Gestaltungsästhetik. Ich bezog sie in meine Liste ein. Mir fiel auf, wie sehr Kunst und Architektur miteinander verzahnt waren. Architekten malten Bilder und Künstler bauten Häuser. Ein Fotograf, der die Innenräume des sowjetischen Pavillons auf der Weltausstellung in Paris 1925 gestaltete. Und die Möbel gleich mit dazu. Ich entdeckte einen Sessel, der dem berühmten Möbel von Corbusier in nichts nach stand. Bloß hatte er kein Marketing und keinen Vertrieb gefunden.
Das Ordnen kostete Zeit. Aus der Cafeteria holte ich mir einen Cappuccino. Ich trank ihn im Stehen vor dem Eingang und dachte nach. Der Doktor musste mittlerweile frisch frisiert im Fitnessstudio angekommen sein. Dort würde er mäßig schwere Gewichte in kontrollierten, formvollendeten Bewegungen langsam in die Höhe stemmen, um seinen Body in Form zu halten. Der Körperkult eines „Sport – 3 – Schülers“, der beim Fußball unter den letzten ist, die gewählt werden.
Auf keinen Fall würde er dabei schwitzen. Schweiß war nicht ästhetisch. Schweiß war für Proleten.
Wieder an meinem Arbeitstisch schrieb ich acht Überschriften auf ein anderes Blatt untereinander.
„Utopie und Gesellschaft – die Vision der Künstler“
„Von der Parole zur Demonstrationsarchitektur“
„Die Stadt als Bühne als Symbol als Theater als Stadt“
„Fortschritt und Transparenz“
„Die Geburt der Moderne“
„Zurück in die Zukunft: Die Ästhetik Stalins – zwischen Zuckerbäckerstil und Terrorregime“
„Die U-Bahn – Glanz und Gloria für das Volk“
„Die Gegenwart – Mensch und Wohnmaschine“
Plakativ, suggestiv, provokativ. Genau so wollte ich es.
Dann trug ich Jahreszahlen dahinter ein. Ich sortierte die Klopapiermarkierungen nach den Überschriften und übertrug die wichtigen Fakten in meine Tabelle. Ein gelbes Blatt Klopapier legte ich dort ein, wo ich ein aussagekräftiges Foto fand. Es waren 14 Bilder. Ich suchte noch etwas, bis ich für jede Überschrift mindestens zwei Bilder hatte. Ich fand den Fotokopierer und eine Viertelstunde später stopfte ich die Fotokopien in meine Tasche und stellte die Bücher wieder ins Regal. Bis jetzt hatte ich drei Stunden Zeit investiert und wusste mehr über das Thema der sowjetischen Architektur als der Veranstalter einer dies betreffenden Ausstellung. Jetzt brauchte ich nur noch ein Präsentationskonzept und einen Zugang zu dieser Herde der Ahnungslosen. Da der Doktor nicht mit dabei war, konnte ich mir eine Bratkartoffelpfanne im Cafe Hardenberg gegenüber der TU Mensa gönnen, gute alte gutbürgerliche Kost, nichts für den Feinschmecker.
Die schwarzbekittelte Kellnerin nahm meine Bestellung entgegen und während sie in Richtung Tresen verschwand, um mir mein Alsterwasser zu zapfen, las ich den aktuellen Tagesspiegel. Gorbatschow hatte eine weitere unabhängige Tageszeitung in Leningrad zugelassen. Er gab zu, dass es zu „schwierigen Zuständen“ in den Gulags und Zuchthäusern gekommen sei. Er hatte an diesem Tag mehr Informationen zugelassen, als Breschnew während seiner ganzen Amtszeit.
Die Kellnerin kam und da wusste ich, wie ich die Sache angehen konnte. Ich hörte den Anrufbeantworter im Büro ab, der einzige eingehende Anruf stammte von dem Doktor, der meinte, um vierzehn Uhr bräuchte man nicht mehr im Büro zu erscheinen, es sei besser, die Zeit zur Reflektion zu nutzen, um dann morgen mit neuem Schwung … Gut, sollte er. Ich rief Karen in ihrem Institut an. Ich verabredete mich mit ihr in der Cafeteria des Instituts für Wirtschaftswissenschaften für fünf Uhr. Neutraler Boden. Und dort gab es den besten Espresso.
In den nächsten Stunden zerschnitt ich Fotokopien, schrieb Überschriften und Überleitungen, klebte alles neu zusammen und zog es durch den Fotokopierer. Meine Textdatei kopierte ich auf eine Floppy Disk und legte sie dazu.
„Konzept einer Ausstellung zum Thema Gesellschaftsutopie in der Architektur“ stand oben drauf.
Anschließend setzte ich mich hin und listete die Arbeitsschritte auf. „Wissenschaftliche Analyse und Leitung“ stand ganz oben. Das war der Köder für den Doktor.
Cafeteria
Die Cafeteria im WiWi-Institut war fast leer. In den hinteren Reihen wurden bereits die Stühle auf die Tische gestellt. Nur ganz vorne saß eine junge Japanerin und sortierte ihre Unterlagen in einen Ringordner. Sie war klein und hübsch.
An einem Tisch gegenüber der langgestreckten Glastheke saß Karen. Sie trug ihr Yamamoto-Cape aus Lübeck und versprühte eine polyglotte Aura um sich herum. Ich gab ihr einen flüchtigen Kuss auf die Wange, zog die Klarsichthülle meines Konzeptpapiers aus meiner Tasche und legte es vor ihr auf den Tisch.
„Wär das was für deine Cedelius-Russen?“
Sie nahm die Hülle und zog das Dutzend Seiten heraus. Ich lief zur Theke, um uns noch einen Cappuccino zu ergattern. Ihren stellte ich neben dem Konzeptpapier ab. Sie war auf Seite fünf.
„Hast du das geschrieben?“ Ich nickte. „Ich hab etwas Zeit in das Thema investiert und mal sondiert, was man davon im Westen zeigen könnte. Aber das ist nur so eine Art zusammenfassende Vorschau. Das muss man natürlich noch wissenschaftlich extrapolieren“, sagte ich so nüchtern wie möglich.
Sie nickte und las weiter. Ich hatte recht, der Kaffee mit der Haube aus Milchschaum war immer noch gut. Und die Japanerin war wirklich hübsch. Auch von hinten. Sie brachte ihr Tablett mit dem Geschirr in einen der bereit stehenden Transportwagen und ging. Schade. Karen war auf Seite acht angekommen. Sie nickte, las weiter, schüttelte den Kopf, nickte wieder, fuhr mit dem Finger eine Textzeile entlang und verzog ihren Mund, um auf ihrer Unterlippe herumzukauen.
„Das ist nicht schlecht“, meinte sie.
„Ja, aber das ist nur so eine Art Briefing. Da muss der Doktor noch mal drüber schauen. So kann man es nicht präsentieren“, schränkte ich ein.
Sie nickte wieder. „Sicherlich kann das nicht so bleiben. Aber es ist eine gute Grundlage für den Anfang. Ich gebe das weiter und denke mal drüber nach, wie wir es dem Hügelzwerg präsentieren können.“
„Ok, das klingt gut.“
Beide nippten wir an unseren Getränken.
„Weißt du, wann die nächste Sitzung stattfindet?“, hakte ich nach.
Sie überlegte kurz. „Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, am kommenden Donnerstag, habe ich gehört. Ich bin nicht offiziell eingeladen. Aber ich kann bei Hügelzwerg nachfragen.“
„Das wär gut.“
Bis Donnerstag war nicht viel Zeit, wenn man das Konzept vorher bei Hügelzwerg einführen wollte.
Ich nickte. „Sag dem Doktor, er soll sich das Papier ansehen und sich dann erst nach dem Mittag melden.“
Sie guckte fragend. „Ich muss erst zum Friseur und dann in die Massage.“ Ich grinste, zwinkerte mit dem Auge und erhob mich. Sie lächelte, auch wenn ein Rest an Zweifel in ihren Mundwinkeln saß. Sie würde es dem Doktor erzählen, der würde es verstehen. Das Ausschlafen war gesichert. Ein langer Clubabend erwartete mich.
Mittag
Das Telefon klingelte das erste Mal um elf Uhr. Ich ließ es klingeln. Um halb zwölf klingelte es das nächste Mal. Ich drehte mich wieder auf die andere Seite und zog mir die Decke über die Ohren. Um zwölf schleppte ich mich ins Bad und gönnte mir eine ausgiebige Dusche. Als ich besser gelaunt aus dem Bad trat, zeigte mein Anrufbeantworter eine Vier. Ich checkte die Anruferliste, drei Mal war es die Privatnummer des Doktors. Einmal eine unbekannte Berliner Nummer aus Rudow oder Britz, was mich an die gestrige Nacht erinnerte. Ich zögerte. Ich drückte auf „antworten“, doch in Berlins Süden ging niemand ran. Ich war ein bisschen erleichtert und löschte nach kurzem Zögern die Nummer.
Ich nahm mir den Doktor vor. Hatte Karen ihm nicht meine indirekte Mitteilung überliefert? Ich trank eine große Tasse Milchkaffee, stieg in meine Jeans und in mein neu erworbenes Paar italienischer Schuhe und fuhr zum Doktor nach Hause. Mal sehen, was er mir als seine neueste Idee verkaufen würde.
„So geht das alles nicht“, sagte er und kratzte an einer seiner roten Pusteln, die er immer dann bekam, wenn er hektisch wurde. Seine neue Frisur unterschied sich nicht wesentlich von seiner alten, nur dass ihm jetzt eine einzelne, klar definierte Strähne in die Stirn fiel, die ihm wohl ein verwegenes, kreatives Image verschaffen sollte und als Kontrast zu seinen fülligen Backen diente. Die Haare an den Schläfen und den Seitenpartien waren kürzer geschnitten,ansonsten sah er aus wie immer, war dafür aber um mindestens achtzig Mark ärmer.
„Das hält so keiner wissenschaftlichen Überprüfung stand.“ Vor ihm auf dem Tisch lag ---- Posporewskis „Chronik der sowjetischen Architekturgeschichte.“
„Muss es jetzt auch nicht.“
„Doch, muss es.“
„Später vielleicht, aber jetzt nicht. Es soll die Leute vom Cedelius Club überzeugen und einfach gut klingen, nach einem Publikumserfolg. Nach Presse und Fernsehen, nach Interviews und SFB Aktuell. Und nach Glamour. Wissenschaft ist was für Architekturstudenten. Das interessiert aber sonst keinen.“ Das war ein schwerer Dämpfer. Daran musste er erst einmal knabbern.
Ich zog das Konzeptpapier zu mir rüber. Er hatte mit rotem Filzstift Anmerkungen an den Rand geschrieben. Sein Gekrakel war weitgehend unlesbar, aber es wurde deutlich, wie sehr er um seine Geltung kämpfte. Substantielle Streichungen konnte ich nicht entdecken. Nur Ergänzungen.
„Also, was passt dir nicht? Die Überschriften, der Inhalt, die Ausrichtung oder dass die Idee von mir ist?“
Er schnaufte und wollte etwas sagen, aber ich ließ ihn nicht zu Wort kommen. „Das hier ist ein Schnellschuss. Zum Anlocken dieses Hügelzwergs und seines Clubs. Nicht mehr. Wenn die es nicht interessiert, okay. Dann warst du beim Friseur und ich war in der Bibliothek. Mehr haben wir nicht dabei investiert.“
Er guckte kurz auf, denn der Sarkasmus meiner Worte war ihm nicht entgangen. „Aber wenn der Club anbeißt und das hier schluckt, kannst du so lange wissenschaftlich analysieren, bis du glücklich bist. Nur, dass wir dann Geld dafür bekommen.“
Er schaute schon wieder friedlicher. Ich hatte Oberwasser und das musste ich nutzen. „Also, lass uns zusehen, wie wir aus dem Papier ein Präsentationskonzept machen. Und zwar schnell. Am Donnerstag trifft sich der Cedelius Club wieder. Mein Ansatz ist: Was ist aus der Sicht des Westens interessant an der sowjetischen Architektur? Dem sollte sich alles andere unterordnen. Das sind das ‚Unbekannte‘, das ‚Innovative‘, das ‚Subversive‘. Wir legen Wurzeln frei, die schon zur Revolution 1917 vorhanden waren. Und das zeigen wir dem Club mit ein paar schnellen Bildern. Die dürfen gar nicht auf die Idee kommen, jemand anderen zu fragen.“