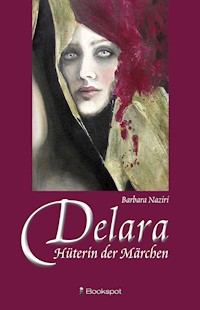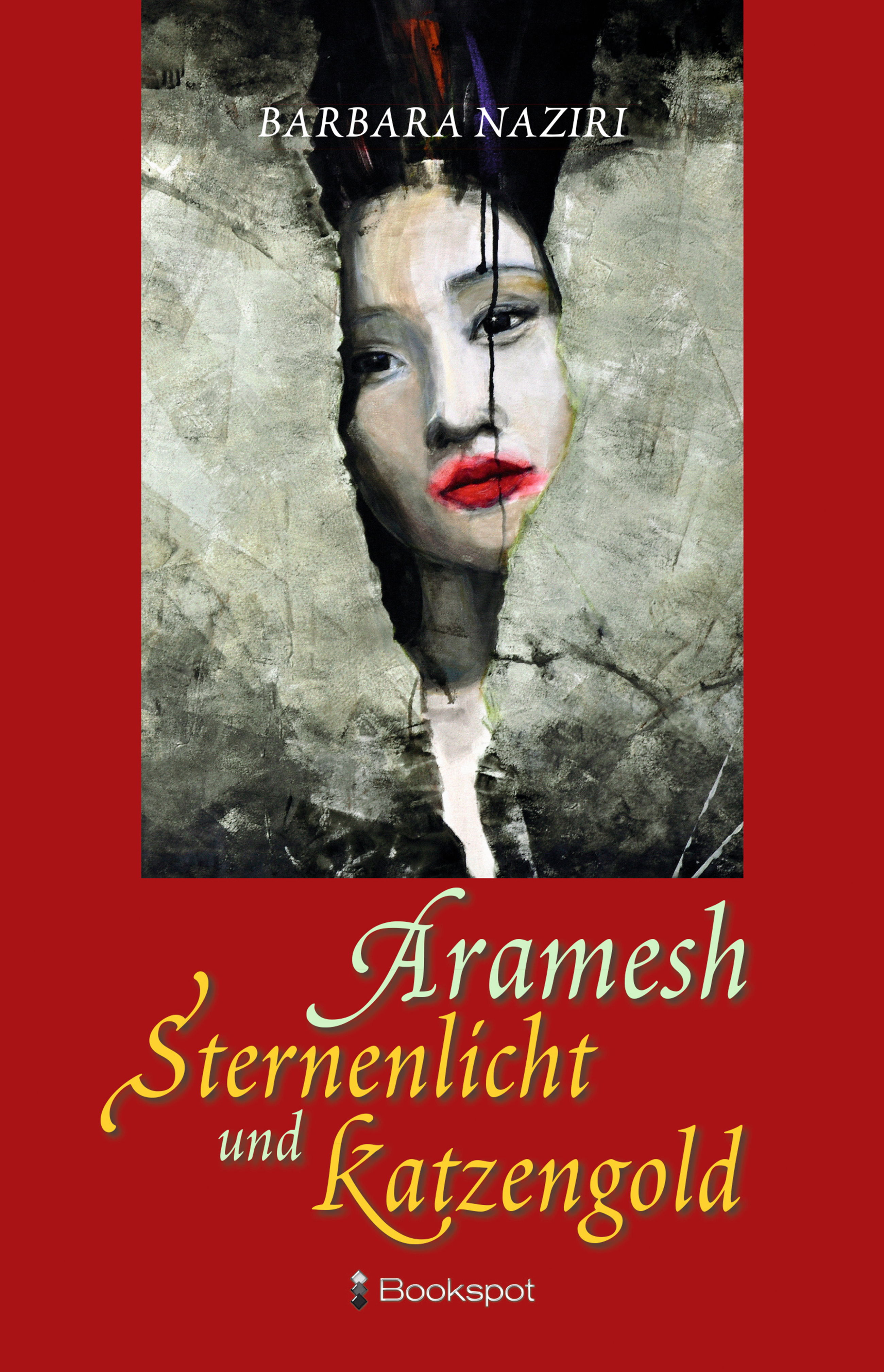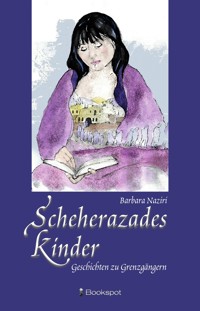
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bookspot Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dschinns, Räuberbanden, Schahs und verwegene Helden schmückten die Geschichten, mit denen Scheherazade in "Tausendundeiner Nacht" ihr Leben rettete. Doch was ist geblieben vom sagenumwobenen Morgenland? In "Scheherazades Kinder" folgt die deutsch-iranische Autorin Barbara Naziri den Spuren der Märchenerzählerin. Durch so berührende wie erschütternde Schilderungen lässt sie den Orient lebendig werden, setzt sich mit der politischen Situation ihres Heimatlands Iran auseinander und öffnet die Herzen und Augen ihrer Leserschaft für eine reiche Kultur, die selbst im Schatten von Krieg und Gewalt blüht. Eine bewegende und zugleich schmerzliche Kurzgeschichten-Sammlung, die durch atemberaubende Zeichnungen der deutsch-iranischen Künstlerin Schirin Khorram ergänzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile.
Die Rechte aller in diesem Band abgedruckten Texte liegen bei der Autorin.
Copyright © 2021 bei P&L Edition, ein Imprint von Bookspot Verlag GmbH
1. Auflage
Lektorat/Korrektrat: Andreas März und Jara Dressler
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Covergestaltung: Martina Stolzmann
Titelmotiv und Grafiken: Schirin Khorram
E-Book: Jara Dressler
ISBN 978-3-95669-163-8
www.bookspot.de
Den Kindern Irans
»Die Namen können nichts für die Taten der Menschen.
Die Menschen aber geben ihren Taten Namen.«
Aramesh
Ali Baba
Kaum konnte ich auf den Beinen stehen, wollte ich die Welt erforschen – mit aller Macht. Ich war ein wildes Kind mit einem starken Willen. Meine Eltern hatten ihre liebe Not mit mir. Da ich ihnen oft ausbüxte, erhielt ich kurzerhand ein Brustgeschirr, wie es die Blindenhunde tragen. Allerdings bimmelte vorne an meiner Brust auch noch ein Glöckchen, sodass ich nicht nur gefesselt, sondern auch noch weithin hörbar dahintrabte. So lief ich fast zweieinhalb Jahre zur allgemeinen Belustigung an der Leine. Komischerweise kann ich mich noch heute gut an das Glöckchen erinnern und ebenso an das weiße Laufgeschirr. Seitdem hat mich niemand mehr an die Leine genommen! Als meine Eltern mir endlich erlaubten, die Welt ohne Schutzleine zu erforschen, kletterte ich wie ein Eichhörnchen flink auf jeden Baum, um endlich freie Sicht auf die Welt zu haben. Klettern wurde zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Ich zerriss so manches Kleid und bekam von meiner Mutter eine Lederhose verpasst, die mein Vater von einer Geschäftsreise aus Bayern mitgebracht hatte. Das erregte hier an der Küste schon einiges an Aufsehen. Doch das war mir egal, Hauptsache, ich konnte mich frei bewegen.
Eines Tages – ich war gerade sieben Jahre alt – turnte ich wieder einmal in meinem Lieblingsbaum herum. Seine kräftigen Äste reichten weit hinunter bis zum Kanal, an den unser Garten grenzte. Plötzlich kletterte, behände wie ein Äffchen, ein Junge zu mir nach oben. Sein Haar war kohlrabenschwarz, dunkler noch als meines, aber seine Haut schimmerte in einem goldbraunen Ton. Im Gegensatz zu meinen runden blauen Augen waren seine wie tiefdunkler Samt, fast schwarz wie die sternenlose Nacht. Jetzt allerdings blitzte der Schalk aus ihnen.
»He du, ich beobachte dich schon eine ganze Weile«, sprach er mich an. »Das habe ich noch nie gesehen: ein persisches Mädchen, das eine Jungenhose trägt – mit Hosenladen«, lachte er. Es klang nicht gemein, aber es erinnerte mich daran, dass es auch eine gezielt erdachte Strafe meiner Eltern war, diese Hose zu tragen. Sie konnten mich einfach nicht bändigen, zumal ich lieber mit Jungen als mit Mädchen spielte. Unmutig betrachtete ich ihn und wollte zornig etwas entgegnen. Da berührte er mich sanft am Arm.
»Sei nicht böse, ich wollte dich nicht ärgern. Ich wollte dich einfach kennenlernen.« Dann hielt er mir strahlend die Hand hin: »Ich heiße Ali.«
So begann meine Freundschaft mit dem Nachbarsjungen, der genauso viel Unfug im Kopf hatte wie ich. Bald waren wir ein unzertrennliches Duo und unser Lachen konnte man noch in den Nebengärten vernehmen.
Als ich Ali das erste Mal mit nach Hause brachte, marschierte ich schnurstracks in das Arbeitszimmer meines Vaters, der tiefgebeugt über seinen Zeichnungen saß. Ich war ein »Papakind« – vom ersten Moment an. Das heißt nicht, dass ich meine Mutter weniger liebte, aber meinen Vater vergötterte ich. Etwas abwesend blickte Papa von seinen Papieren hoch und direkt in Alis Gesicht, der sich leise herangeschlichen hatte, um einen Blick auf die Zeichnungen zu werfen. Papa hob überrascht die Augenbrauen, weil Ali so gar keine Scheu vor ihm zeigte, denn immerhin war er eine imposante Erscheinung. Bevor er etwas sagen konnte, streckte Ali ihm die nicht ganz saubere Hand entgegen: »Ich heiße Ali und mein Vater ist ein Mullah. Wir wohnen ein paar Häuser weiter.«
»Ja, den kenne ich«, lächelte mein Vater, »er ist der Imam der iranischen Gemeinde an der Außenalster und ich kenne auch Ahmad, deinen Bruder.«
»Ahmad ist schon viel älter als ich«, erwiderte Ali. »Er geht schon aufs Gymnasium.«
»Nun, Ali Baba«, sagte mein Vater scherzhaft zu ihm, »wenn du magst, kannst du zum Essen bleiben.« Und Ali blieb, ebenso der Spitzname, der ihm verliehen worden war. Mein Vater mochte ihn sofort, auch meine Mutter entdeckte ihr Herz für ihn, und bald war er in unserem Hause ein gern gesehener Gast. Mein jüngerer Bruder, der im Gegensatz zu uns mehr ein ruhiges Naturell besaß und mehr ein Träumer war, konnte ihn ebenfalls gut leiden. Ali besaß die wunderbare Gabe, sich auf das Gemüt der Menschen seiner Umgebung einzustellen.
Ali Baba war ein Unikum. Er schien sich alles spielend anzueignen, so auch die plattdeutsche Sprache. Wie erstaunt war ich und wie sehr bewunderte ich ihn, als ich ihn das erste Mal Platt sprechen hörte. Er sprach es tatsächlich perfekt, was so manchen aufgrund seines Äußeren verwunderte, dem er begegnete. Er liebte es, morgens beim Bäcker einen »Klönschnack« zu halten, wie er es nannte. Die Bäckersfrau freute sich jedes Mal, wenn er bei ihr auftauchte. Auch war er mir ein wunderbarer Zuhörer, wenn ich ihn mit meinen selbst erdachten Geschichten unterhielt und wir einträchtig nebeneinander auf unserem – mittlerweile – gemeinsamen Lieblingsbaum saßen und die Beine baumeln ließen. Ich liebte ihn mittlerweile wie einen zweiten Bruder und er war mein Held, als er später einmal einer Lehrerin Kontra bot, die aufgrund ihres autoritären Auftretens bei allen Schülern sehr unbeliebt war. Er hatte sie auf der Straße ein bisschen lausbubenhaft geärgert, aber ihre Reaktion schockte mich dann doch. Sie schrie ihn an:
»Geh mir aus dem Weg, du frecher Neger!« Mir war klar, dass das Wort Neger hier als Schimpfwort fungierte und ich war erschrocken, weil ich glaubte, Ali Baba sei nun verletzt. Doch der tanzte ganz munter um die Lehrerin herum und sang: »Bin ja gar kein Negerlein«, und das so oft, bis sie zornig davonstob. Er schien sich vor nichts und niemandem zu fürchten, war wild, wirkte fast ungezähmt. Er nahm einem jedoch auch so schnell nichts übel. Er konnte austeilen, aber auch gut einstecken.
Mein Vater hatte inzwischen die nähere Bekanntschaft mit Ali Babas Vater gemacht und daraus war eine herzliche Freundschaft entstanden. Als dieser nun das erste Mal mitbekam, wie wir Ali nannten, lachte er laut auf und meinte, dieser Spitzname treffe wirklich den Nagel auf den Kopf. Der Mullah war ein gütiger freundlicher Herr und wandelte stets in Kaftan und Turban durch unsere Gegend. Auf der Straße drehte sich niemand mehr nach ihm um. Er war allgemein bekannt und gern gesehen, weil er für jeden ein freundliches Wort oder – wenn nötig – einen Rat hatte. Ich ging nun auch bei Alis Familie ein und aus. Seine Mutter sah ich nie ohne Kopftuch. Sie war eine scheue und warmherzige Frau, deren Lächeln ich in Alis Zügen wiederfand. Ahmad aber, seinen Bruder, betrachtete ich nur mit Ehrfurcht aus der Ferne. Er war viel älter als wir, hoch aufgeschossen und hatte klare ebenmäßige Züge. Aber er wirkte irgendwie immer abwesend.
Eines Tages riefen mich meine Eltern in die Bibliothek. »Daria«, sagte meine Mutter, »du bist nun zehn Jahre alt und wir würden uns freuen, wenn du dich für eine Glaubensrichtung entscheidest.« Bisher hatte ich mir darüber keine Gedanken gemacht, dass meine Mutter Jüdin und mein Vater Moslem waren. Sie hatten mich liberal erzogen und es war nicht in ihrem Sinne, mir ihre Religionen aufzuzwingen. Ihre gemeinsame Weltanschauung war offen und tolerant und darum wollten sie mich selbst entscheiden lassen, wenn ich mental dazu in der Lage war. Mir passte das eigentlich nicht so sehr, dass ich mich einer Glaubensgemeinschaft anschließen sollte. Ich kannte die Synagoge wie auch die Moschee, fühlte mich heimisch mit den Bräuchen und Festen, aber ehrlich gesagt zu keiner so richtig hingezogen. Ich wusste, Jüdin war ich schon vom Matriarchat her. Um meinem Vater aber eine Freude zu machen und weil Ali aus einem muslimischen Hause kam, entschied ich mich für den Islam. Ali war mittlerweile zwölf Jahre alt und freute sich sehr über meinen Entschluss. Ich muss allerdings ehrlich zugeben, dass ich keinen Eifer in den Religionsstunden an den Tag legte. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ich fühle mich keiner Religion richtig verbunden, aber ich glaube an Menschlichkeit und Liebe.
Unsere Kindheit verging wie im Flug. Alis Mutter starb ganz plötzlich an einer schweren Krankheit und in das Haus zog Trauer ein. Ali Babas Lächeln war wie weggewischt und starb mit ihr an diesem Tag. Er zog sich zurück und wurde stiller. Mit wahrem Eifer warf er sich auf alle Lehrbücher, die sich auf seinem Schreibtisch türmten, und beschäftigte sich intensiv mit Mathematik und Physik. Das waren Fächer, die mich die Flucht ergreifen ließen. In seinem Elternhaus war es so still, dass sich die Trauer stets wie ein schwerer Stein auf mein Gemüt legte, sobald ich dort eintrat. Hilflos musste ich mit ansehen, wie Ali Baba immer melancholischer wurde. Ich spürte seinen Schmerz um den erlittenen Verlust fast körperlich, denn bei seinem Anblick zog sich mir stets das Herz zusammen. Er war so einsam und er wollte es auch bleiben, denn seine Besuche bei uns wurden immer weniger. Sein Vater war viel unterwegs, flüchtete vor dem leeren Haus, und sein Bruder Ahmad lebte mittlerweile in Amerika und studierte dort.
Der zweite Schicksalsschlag traf mich unvermittelt. Obwohl mein Vater mitten im Leben stand, hatte er des Öfteren über Herzprobleme geklagt. Kurz vor meinem sechzehnten Geburtstag starb er urplötzlich und meine kleine heile Welt zerbrach in Scherben. Meine Mutter – einst stark und lebendig – war nur noch ein Häuflein Elend, denn die Ehe meiner Eltern konnte man als glücklich bezeichnen. Das hatten wir Kinder auch stets zu spüren bekommen. Mein Bruder war noch so jung, und so nahm ich die Beerdigung in die Hand. Ich war so beschäftigt damit, dass ich nicht einmal ihn trösten konnte, brauchte ich den Trost doch dringend selbst. Die Verwandten meiner Mutter hielten mich für hartherzig, weil ich kaum eine Träne vergoss und in ihren Augen starr funktionierte. Anders hätte ich nicht durchgehalten. Nur nachts, wenn ich allein im Bett lag, ließ ich meinen Tränen freien Lauf. Plötzlich war Ali Baba wieder da, nahm mich einfach nur wortlos in die Arme. Allein seine Anwesenheit gab mir Halt in diesen dunklen Tagen.
Dann überschlugen sich die Ereignisse. Mein Leben geriet aus der Bahn. Während Ali Baba wie ein Besessener über seinen Büchern saß und lernte, trieb ich mich herum, ging zwar zur Schule, aber freudlos und halbherzig.
Mein Elternhaus war mir durch den Tod des Vaters fremd geworden. Meine Mutter war in ihre Trauer vergraben und übersah dabei, dass auch ihre Kinder litten. Ich hatte nur den einen Wunsch fortzugehen, wusste aber nicht, wohin. Da lernte ich Bülent kennen. Bülent war erheblich älter als ich mit meinen damals siebzehn Jahren. Sein Interesse an meiner Person schmeichelte meiner Eitelkeit und ich kann heute nicht mehr sagen, ob ich mich einfach nur verlieben wollte, um von zu Hause fortzukommen. Nach einem Jahr machte er mir einen Heiratsantrag. Er verlangte allerdings zwei Dinge von mir: erstens die Aufgabe meiner Freundschaft zu Ali, die ihm schon lange ein Dorn im Auge war, und zweitens, dass ich ihm in die Türkei folgen sollte, denn er wollte nach Beendigung des Studiums nicht in Deutschland bleiben. Ich war geschockt und bat um Bedenkzeit.
Noch am gleichen Abend eilte ich zu Ali und erzählte ihm alles. Er schwieg lange und sah sehr blass aus.
»Daria«, sagte er leise. »Es ist dein Leben und ich darf dich nicht halten, wenn es auch wehtut. Ich habe sowieso vor, auswärts zu studieren und irgendwann nach Iran zu gehen. Dort braucht man Mathematiker und Physiker. Da sind auch meine Wurzeln.«
Ich sah ihn fassungslos an. »Du willst fort? Und unsere Freundschaft gibst du so einfach auf?«
»Nein, Daria«, sagte er eindringlich. »Es fällt mir nicht leicht, und egal wo ich auf dieser Welt bin, wirst du immer in meinem Herzen sein. Glaube mir, du warst und bist und bleibst mir immer eine Schwester und liebe Freundin.«
Ich brach in Tränen aus. »Was mache ich mit Bülent? Wie ist das möglich? Darf jemand, der einen liebt, den anderen um die Aufgabe eines Menschen bitten?«
»Er ist eifersüchtig. Liebe geht manchmal seltsame Wege«, entgegnete Ali rätselhaft. »Vielleicht ist alles nicht endgültig und eines Tages sehen wir uns wieder.«
Ich starrte ihn fassungslos an. »Ich habe mich doch noch gar nicht entschieden, Ali.«
»Doch«, lächelte er traurig, »das hast du. Sei nicht bedrückt. Dein Herz wird dir den Weg weisen.«
Als ich ihn verließ, hatte ich das Gefühl, ihn und mich verraten zu haben. Ich verschloss mein Herz, ging zu Bülent und willigte in alle seine Wünsche ein, obwohl mich eine innere Stimme eindringlich warnte. Ich wollte einfach nur fort und ging leichtfertig und unwissend, wie ich war, eine Ehe ein, die ein Fiasko wurde. Wir hatten uns nicht allzu viel zu sagen und trennten uns einvernehmlich nach ein paar Jahren.
Als ich nach Deutschland zurückkehrte, war Alis Vater tot. Meine Mutter sagte mir, er sei an gebrochenem Herzen gestorben, nachdem Ali Baba fortgegangen und nicht zurückgekehrt sei. Keiner wisse, wo er sich aufhielt. So hatte ich meinen Freund aus Kindertagen endgültig verloren. Die Jahre vergingen. Ich heiratete noch einmal, wurde glücklich, bekam meine Kinder. Ich arbeitete mittlerweile an der Universitätsbibliothek und mein Beruf machte mir viel Freude. An Ali dachte ich trotzdem noch ab und zu. So besuchte ich mitunter das Grab seines Vaters, das außer mir wohl keinen Besucher mehr anzog. Es verwilderte zusehends und ich begann, es ein wenig herzurichten. Meinem Mann hatte ich von Ali erzählt und er besuchte gelegentlich das Grab mit mir gemeinsam, wenn wir zuvor am Grab meiner Eltern verweilt hatten. Mein Mann war Iraner wie Ali und wie mein Vater. Mit ihm konnte ich so ungehemmt über die vergangenen Jugendstreiche sprechen, die Ali und ich einst ausgeheckt hatten. Oft lachten wir gemeinsam darüber und ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass er und Ali sich einmal kennenlernen würden.
Eines Tages stand ich auf der Leiter in der Bibliothek, um einige Bücherstapel auszusortieren, denn die Regale quollen über. Die Jahrbücher der Abiturienten von Eliteschulen nahmen zu viel Platz ein, wurden kaum entliehen und sollten darum entsorgt werden. Beim Sortieren glitt mir ein Buch aus der Hand. Gerade wollte ich es auf den Stapel legen, da sah ich, dass es ein Jahrbuch aus Alis Schule war, und zwar genau sein Jahrgang zum zehnjährigen Jubiläum. Ich lehnte mich ans Regal und blätterte darin. Die Konterfeis der Schüler lächelten mir entgegen und darunter stets ihr Werdegang. Dann erblickte ich Alis lächelndes Gesicht, reifer und ernster, als ich ihn in Erinnerung hatte. Mein Herz begann schmerzhaft zu pochen und meine Sehnsucht nach ihm lebte wieder auf. Unter seinem Bild stand: »Der junge Erfolg versprechende Wissenschaftler Dr. Ali M. bei der Entgegennahme des Preises für Physik in Berlin.« Meine Augen flogen über seine Vita. Die schloss hier mit den Worten: »In der Blüte seiner Jahre wurde der junge Akademiker Ali M. viel zu früh aus unserer Mitte gerissen. Bei einer Demonstration in Teheran wurde er unter ungeklärten Umständen getötet.« … Das Buch entglitt meinen Händen ein zweites Mal. Ich sank auf die Knie und weinte, wie ich noch nie geweint hatte, um Ali Baba, meinen Vater, meine verlorene Jugend und darum, dass ich meinen Freund nun endgültig verloren hatte.
Das Lied
Kaum ein Laut drang von der Straße in den stillen Innenhof. Im Garten zirpte ab und zu eine Zikade. Bijan saß unter dem alten Feigenbaum und stimmte seine Kemantsche, eine persische Kniegeige. Ein Lächeln lag auf seinen Lippen. Wie sehr genoss er die stillen Nachmittagsstunden, wenn halb Teheran schlief. Vergangene Nacht hatte er ein Gedicht geschrieben, das er nun vertonen wollte. Leise summte er vor sich hin. Musik erfüllte ihn mit Hingabe. Wenn er sang, vergaß er die Welt um sich herum und verschmolz mit seinem Instrument zu einem Wesen. Das spürte auch sein Publikum, das selbstvergessen seinen Liedern lauschte. So war er im Laufe der Zeit zu einem beliebten Sänger geworden, dessen klangvolle Stimme in ganz Teheran und weit darüber hinaus bekannt war.
Während er sich mit halb geschlossenen Lidern auf die Töne konzentrierte, sah er einen Augenblick lang den kleinen Jungen vor sich, der er einst gewesen war. Ein wehmütiges Lächeln umspielte seine Lippen. Schon als Knirps hatte er hier gesessen und selbst erdachte Melodien geträllert, bis ihm sein Ziehvater mit einem Schmunzeln im Gesicht die erste Kniegeige schenkte. Seitdem war sie aus seinem Leben nicht wegzudenken.
»Bijan! Bijan!« Donjas verstörte Stimme riss ihn jäh aus seinen Gedanken. Erschrocken fuhr er herum, wobei ihm beinahe sein kostbares Instrument entglitt. Für eine Sekunde umschloss seine Hand den Klangkörper fester. Dann legte er ihn behutsam beiseite. Im gleichen Moment stolperte Donja [1] völlig aufgelöst auf ihn zu. Sie musste wie eine Besessene gerannt sein. Ihr Atem ging stoßweise und sie hielt keuchend vor ihm an. Obwohl sie vom Laufen erhitzt schien, zeigte ihr Gesicht keine Farbe. In ihren Augen stand blankes Entsetzen.
Oh nein, dachte er, während eine böse Ahnung sein Innerstes beschlich, lass es nicht geschehen sein.
»Sie haben Vater festgenommen!« Donjas Stimme brach. Tränen strömten über ihre Wangen. Plötzlich knickten ihre Beine einfach weg. Hätte er sie nicht rechtzeitig aufgefangen, wäre sie auf den Boden aufgeschlagen. Er hob sie hoch und trug sie mit klopfendem Herzen ins Haus.
Wie leicht sie ist!, dachte er erstaunt. Wie eine Feder. Vorsichtig ließ er sie auf den Diwan gleiten. Dann eilte er in die Küche, tauchte ein Handtuch in kaltes Wasser und legte es ihr auf die Stirn. Zart klopfte er mit den Fingern gegen ihre Schläfen. Fast widerwillig öffneten sich ihre dunklen Augen mit den langen gebogenen Wimpern. Sie schienen in ihrer Furcht noch größer zu werden.
»Oh, Vater«, schluchzte sie. »Diese schreckliche SAVAK [2] … diese Verbrecher. Sie werden ihm etwas antun. Ich spüre es, nun muss er für seinen Mut mit dem Leben bezahlen.«
Bijan presste die Lippen zusammen. Wie sollte er widersprechen? Er fühlte die gleiche Angst. Mit seinen Fingerspitzen strich er ihr geistesabwesend über die Stirn. Er hatte Ramin wiederholt gewarnt. Als Offizier des Schahs hatte er sich manchen seiner Anweisungen widersetzt, die ihm ungerecht erschienen. Darauf stand seit jeher die Todesstrafe. Es war tollkühn, sich diesem Despoten entgegenzustellen. Bijan verspürte, wie eine hilflose Wut in ihm emporkroch. Wie viele Menschen hatte dieser Hundesohn mithilfe seiner überall gefürchteten SAVAK schon auf dem Gewissen?
Oh mein Gott, dachte er, lass es nicht zu! Nicht auch noch Ramin. Doch er wusste, wer sich dem Herrscher auf dem Pfauenthron nicht beugte, war so gut wie tot. Selten sah ein Gericht die Widersacher. Seine Gegner verschwanden spurlos, als hätte es sie nie gegeben. Die Familien nahmen zu, die einen Sohn, einen Vater oder einen Bruder zu beklagen hatten.
Im Geiste sah er Ramins gütiges Gesicht vor sich, der sich lächelnd über ihn beugte, einen nunmehr kleinen Waisenjungen. Ramin war Vaters bester Freund gewesen. Nach dessen Tod hatte er Bijan an die Hand genommen und in sein Haus geführt. Seitdem lebte er hier wie sein eigener Sohn. Die aufkeimende Liebe zwischen seiner Tochter Donja und Bijan hatte Ramin mit Wohlwollen betrachtet. »Ich weiß Donja bei dir in guten Händen«, hatte er einmal freundlich gesagt. »Aber lasst euch Zeit. Ihr seid noch so jung.«
»Was sollen wir denn nur tun? Ich habe solche Angst!« Donjas zitternde Stimme holte ihn in die Gegenwart zurück.
»Ich gehe zum Evin-Gefängnis und frage, ob ich mit ihm sprechen kann«, entgegnete er ernst. »Er kann nur dort sein. Sie bringen alle politischen Gefangenen ins Evin.«
Auf dem Weg dorthin schossen ihm hundert Gedanken durch den Kopf. Er hatte keinen Blick für die üppig blühenden Gärten Schemirans [3]. Die nimmermüden Spatzen tschilpten in den Bäumen. Ein Hauch von Jasmin hing in der Luft, doch er bemerkte ihn nicht, genauso wenig wie den leichten Frühlingswind, der ihm über die Wangen strich. Bijans Stirn umwölkte sich sorgenvoll, wenn er daran dachte, bei wem er nun vorsprechen musste. Kommandant Bakhtiar, ausgerechnet, dachte er grimmig. Ramins Erzfeind und ewiger Gegenspieler. Von ihm hat er keine Milde zu erwarten.
Er bog in eine Seitengasse ein. Mit einem Schlag betrat er eine andere Welt. Hier wuchsen keine Blumen. An dieser Stelle hatte der Schah das berüchtigte Evin-Gefängnis errichten lassen. Hoch wölbte sich eine gelbe Ziegelsteinmauer dem Himmel entgegen und schien die schmale Straße fast zu erdrücken. Der Stacheldraht oben auf dem Mauerkranz verstärkte diesen Eindruck und warf seinen bizarren Schatten auf das Straßenpflaster. Kein Fenster, nicht mal eine Maueröffnung war zu sehen. Bijan atmete schwer, als er vor dem Gefängnistor stand.
Der wachhabende Offizier trat ihm in den Weg und fragte schroff: »Was suchen Sie hier?«
Herausfordernd blickte er ihn an, gewohnt, dass die Menschen sich vor ihm duckten. Bijan hielt seinem Blick stand. Innerlich drehte sich ihm der Magen um. Ein feiner Schweißfilm bildete sich auf seiner Stirn.
»Ich möchte den Kommandanten sprechen«, sagte er klar. »Es geht um Ramin Assadollahi.«
Der Offizier musterte ihn forschend. »Den Verräter? Agha [4] Bakhtiar empfängt nicht jeden Dahergelaufenen«, plusterte er sich auf.
»Es ist wichtig«, antwortete Bijan mit fester Stimme.
»Soso. Und wer sind Sie?«, klang es schroff zurück.
»Sein Sohn«, antwortete Bijan zu seinem eigenen Erstaunen.
Ja, ich bin sein Sohn, dachte er warm. Er hat mich großgezogen, mir seine Liebe gegeben und nun sogar die Ehe mit Donja erlaubt … meine herrliche Liebste, meine Welt.
»Warten Sie hier!«, wurde er aus seinen Gedanken gerissen. Kurz darauf kam der Offizier zurück. »Er gewährt Ihnen fünf Minuten seiner kostbaren Zeit. Sputen Sie sich!«
Bijan betrat schweren Herzens das Amtszimmer, dessen Tür weit geöffnet war. Es hatte die Ausmaße eines Festsaals und war bis auf den einsamen Tisch in seiner Mitte unmöbliert. Das wirkte auf jeden Besucher einschüchternd. Bakhtiar hob den Blick nicht und blätterte weiter in Dokumenten, die auf dem Schreibtisch verstreut lagen. Schweigend wartete Bijan. Endlich, nach einer Ewigkeit, so schien es ihm, sah der Kommandant auf. Aus zusammengekniffenen Augen musterte er ihn verächtlich.
»Soso, sein Sohn also«, sagte er kalt. »Ich nahm an, Ramin habe nur eine Tochter … Um Ihre Frage vorwegzunehmen: Ramin Assadollahi wird innerhalb von 24 Stunden durch den Strang hingerichtet.«
»Aber …« Bijan glaubte, seine Welt stürze zusammen, und suchte verzweifelt nach Worten.
»Wer sich des Verrats an dem Schah-in-Schah [5] schuldig macht, hat weder Gnade noch einen würdevollen Tod zu erwarten. Die Ehre, erschossen zu werden, hat Ramin Assadollahi somit verwirkt. – Sie können nun gehen!«
Bijan nahm seinen ganzen Mut zusammen: »Und der Prozess?«, fragte er, während er versuchte, seine bebende Stimme unter Kontrolle zu halten.
»Welcher Prozess? Die Fakten sind klar. Ein solches Geschmeiß gehört vom Erdboden getilgt«, donnerte Bakhtiar, während ihm Speichel im Mundwinkel saß. »Und wenn Sie jetzt nicht augenblicklich meinen Raum verlassen, können Sie ihm gern bei den Ratten Gesellschaft leisten!«
Bijan musste sich beherrschen, nicht laut aufzuschreien, und ballte die Hände zu Fäusten. Dennoch blieb er stehen und deutete eine leichte Verbeugung an, um Demut zu demonstrieren.
»Ein letztes Anliegen noch, Eure Exzellenz. Wir erflehen die Gnade, unseren Vater noch einmal zu sehen …« Nun hielt er den Blick gesenkt und harrte auf die Antwort.
»So sei es«, antwortete Bakhtiar, durch die hohe Anrede etwas milder gestimmt. »Allerdings erlaube ich den Besuch nur der Tochter.« Dann winkte er unwirsch, als wolle er ein lästiges Insekt verscheuchen.
Nachdem Bijan das Gefängnistor passiert hatte, wurde ihm so übel, dass er sich übergeben musste. Er suchte sich eine ruhige Ecke hinter den Mauern, um zur Besinnung zu gelangen. Das Entsetzen hatte seinen ganzen Körper ergriffen. Der Gedanke, nun auch Donja die Worte des Kommandanten zu übermitteln, verursachte ihm erneute Übelkeit. Doch er riss sich zusammen, die Zeit war kostbar.
Als er nach Hause kam, brauchte er nichts zu sagen. Donja las in seiner Miene die furchtbare Botschaft. Aus tränenlosen Augen blickte sie ins Leere. Ihr Gesicht war noch einen Hauch blasser geworden, aber sie hielt sich erstaunlich gerade und gab sich gefasst, doch Bijan spürte den Aufruhr in ihrem Inneren.
»Wann?«
Dieses eine Wort schien im Raum zu schweben, sich auszuweiten und ihn ganz zu beherrschen. Bijan stand da mit hängenden Schultern.
»Morgen Abend«, flüsterte er kaum hörbar. Sie rannte aus dem Zimmer und warf sich schluchzend auf den Diwan.
Nach einer schlaflosen Nacht begleitete er Donja zum Evin. Sein Herz zog sich zusammen, als sich das Gefängnistor kreischend hinter ihr schloss.
Donja folgte dem Soldaten, der ihr durch unzählige Gänge voranschritt. Sie verließen das Verwaltungsgebäude und betraten durch eine Seitentür den Trakt, in dem die Gefangenen hausten. Immer wieder mussten Zwischentüren geöffnet und verschlossen werden. Donja glaubte, ersticken zu müssen. Die Luft wurde immer schwerer. Je weiter sie eindrangen, desto stärker roch es nach Schweiß und Urin. Sie zuckte erschrocken zusammen, als sie plötzlich von irgendwoher den Aufschrei eines Mannes hörte, der verzweifelt um seinen Tod flehte. Viele Türen musste sie passieren, bis der Soldat jäh innehielt und sich an einer schweren Metalltür zu schaffen machte. Sie glaubte kurz, das Auf-flackern von Mitleid in seinen Augen zu erkennen. »In einer Stunde hole ich Sie wieder ab!«, sagte er. Dann stieß er die Tür auf und verschloss sie hinter ihr wieder. Im Raum herrschte Halbdunkel, die schmalen Fenster waren so hoch angebracht, dass niemand hinausschauen konnte.
»Baba [6]?«, flüsterte sie zitternd in das Dämmerlicht.
»Liebchen!«, erklang seine Stimme, und gleich darauf fühlte sie sich von den väterlichen Armen fest umschlossen. Eine Tränenflut nässte ihr Gesicht. Schluchzend umschlang sie ihren Vater, als könne sie ihn dadurch vor dem Schlimmsten bewahren. Ramin schwieg und strich ihr sanft über das Haar. »Weine nicht, mein Täubchen. Deine Tränen schmerzen mich. Schau mich an. Ich möchte dein lächelndes Gesicht in Erinnerung behalten.« Behutsam wischte er ihr die Tränen von den Wangen.
»Können wir gar nichts tun?«, fragte Donja bang. »Eine Petition an den Schah?«
»Nein, mein Kind. Du weißt wie ich, er ist ein Unmensch, dem nur die eigenen Interessen am Herzen liegen. Außerdem wird Bakhtiar es mit allen Mitteln verhindern.« Nach einer Weile fügte er hinzu: »Es wäre würdelos, auf Knien um etwas zu bitten, das ihm doch gar nicht gehört. Es ist mein Leben. Ich habe Frieden geschlossen mit Gott und seiner Welt.« Donja hielt den Blick gesenkt, um die Tränen zu unterdrücken, und presste ihren Kopf an seine Brust.
»Ich habe einen Brief für dich geschrieben, weil ich glaubte, ich würde dich nicht noch einmal sehen«, sagte Ramin leise. »Hier ist er. Bewahre ihn gut auf. Wenn du traurig bist, werde ich im Geiste bei dir sein.« Donja nahm ihn an sich und drückte einen Kuss darauf, bevor sie ihn in ihrer Kleidertasche verstaute.
»Bijan ist sehr traurig, weil er dich nicht noch einmal sehen durfte.«
»Er ist ein guter Junge. Du weißt, er ist mir wie ein eigener Sohn ans Herz gewachsen. Gehe ich heute auch meinen letzten Weg, so beruhigt mich das Gefühl, dass ihr zusammen seid. Mich schmerzt, dass ich von ihm nicht Abschied nehmen kann. Aber mein Segen ist mit euch.«
»Oh, Baba jan [7], ich habe dich so lieb. Du wirst mir so sehr fehlen.«
Ein leichtes Lächeln stahl sich auf seine Lippen. »Wenn Gott mir für mein Erdenleben vergibt, bitte ich ihn darum, mich zu deinem Schutzengel zu machen.«
Den Rest der Zeit verbrachten sie aneinandergeschmiegt und schweigend. Es gab nichts mehr zu sagen.
Als der Soldat die Tür öffnete, schrie Donja laut auf. »Nein, ich will bei ihm bleiben. Ihr dürft ihm nichts tun! Er ist ein guter Mensch! Er ist doch mein Vater!«
Der Soldat zog das weinende Mädchen aus der Zelle und verschloss die Tür. Dahinter sank Ramin auf die Knie, während sich seine Augen mit Tränen füllten.
»Donja«, flüsterte er, »Gott schütze dich!«
Donja ließ sich teilnahmslos mitziehen. Blindlings stolperte sie durch die endlosen Gänge und wusste später kaum, wie sie nach draußen gelangt war. Bijan schloss sie wortlos in die Arme.
Wie sie beide nach Hause fanden, sie wussten es nicht. Diese Willkür eines sinnlosen Todes erfüllte sie mit Zorn und tiefer Trauer.
Sie verhängten die Spiegel und beteten verzweifelt darum, er möge würdevoll aus dieser Welt scheiden. Als die vermutete Todesstunde heranrückte, holte Donja den Brief hervor und begann, ihn zu lesen. Tränen rannen ihr über die Wangen. Mit einem Aufschluchzen hielt sie ihn Bijan hin, der ergriffen auf die letzten Schriftzüge seines Ziehvaters blickte. Im Geiste sah er Ramin vor sich, wie er ihm lächelnd zunickte. Seine Augen überflogen die Zeilen, in ihm erklang ganz leise eine Melodie. Bijan seufzte und hielt inne. Doch sobald er weiterlas, erklang sie von Neuem. Da erhob er sich und wanderte auf und ab. Nun wurde die Melodie klarer und stimmiger. Er griff nach Papier und Stift und hockte sich auf ein Sitzkissen. Versunken begann er zu schreiben. Der Morgen umarmte die Nacht, die ersten Vögel zwitscherten schlaftrunken, als er sich endlich erhob. Donja lag in erschöpftem Halbschlaf. Ihre Augen waren dunkel verschattet, Tränen glänzten in den Winkeln. Sacht zog er die herabgeglittene Decke über sie und streichelte ihre Wange. Sie schlug die Augen auf. Sofort war die Erinnerung wieder da und mit ihr der Schmerz.
»Donja, Azizim [8], ich habe aus dem Brief ein Gedicht gemacht und es vertont – also, die Melodie war zuerst da, schon während ich den Brief las«, sagte er leise. »Ich nenne es ›Küss mich‹(Farsi: Mara bebus). Willst du es hören?«
Verblüfft richtete sie sich auf. »Ja, bitte singe es mir vor!«
Bijan stimmte seine Kemantsche. Dann begann er: »Mara bebus …«
Küss mich ein letztes Mal,
es bleibt mir keine Wahl,
das Schicksal trägt mich fort
an einen fernen Ort.
Gott schütze dich, mein Kind,
ich fliege mit dem Wind.
Du sollst nicht um mich bangen,
Vergangen ist vergangen.
Küss mich ein letztes Mal.
Ich reise durch die Dunkelheit
und überwinde Raum und Zeit.
Ich habe in der finstren Nacht
die Flamme zu dem Berg gebracht.
Der Widerstand muss leben,
hab alles hingegeben.
Wir kämpfen Seit’ an Seit’
in dieser schweren Zeit.
Küss mich ein letztes Mal.
Mein Blümchen, schau mir ins Gesicht.
Ich bitt dich, weine um mich nicht!
Ich nehme Abschied in der Nacht,
mein Herz hält ewig bei dir Wacht.
Wir sehen uns in der andren Welt,
schau nur hinauf zum Sternenzelt!
Wein nicht, für mich ist das nur Qual,
Komm, Kind, küss mich ein letztes Mal.
Bijan hatte geendet, still saßen sie beieinander.
»Es klingt wie sein Vermächtnis«, sagte Donja endlich, »und es tröstet mich. Ich bitte dich, singe dieses Lied auch für andere Menschen, denn es gibt Mut und Zuversicht.«
Bijan erhob sich. »Dieses Lied ist unser Schicksal.«
Bald erklang Mara bebus überall in Teheran. Seine Entstehungsgeschichte verbreitete sich von Mund zu Mund. Sie berührte, wie auch das Lied selbst, die Herzen der Menschen. Das Lied machte sich selbstständig, flog wie ein Vogel in die Weiten Irans und erklang am Elbursgebirge ebenso wie am Persischen Golf und mit ihm wurde auch der Sänger Bijan bekannter. Sooft Bijan das Lied anstimmte, erlosch das Licht im Saal, und er spielte in völliger Dunkelheit. Das geschah aus zwei Gründen. Erstens, um ihn zu schützen, falls die SAVAK plötzlich auftauchte, und zweitens, weil viele Zuhörer während des Liedes in Tränen ausbrachen und sich im Schutze der Dunkelheit ihrer eigenen Trauer ganz hingeben konnten. Das Lied wurde zum Protest gegen das Schah-Regime.
Bijan und Donja heirateten und bekamen ihre Tochter Schirin. In Iran indes stieg unerbittlich der Unmut gegen den Schah und eines Tages geschah, was schon niemand mehr erhofft hatte: Der Schah wurde gestürzt. Die Revolution brach aus wie ein Vulkan. Die amerikanischen Besatzer und Unterstützer des Schahs wurden unter dem Jubel der Bevölkerung des Landes verwiesen. Die SAVAK wurde abgeschafft, ihre Schergen wurden vernichtet. Wildfremde Menschen fielen sich auf der Straße in die Arme und glaubten an ein freies, demokratisches Iran. Donja sprach am Grabe ihres Vaters ein Dankgebet.
Doch in den Wirren der Revolution geschah viel Unrecht und viel Leid. Unmerklich rissen die schwarzen Tulpen, wie man die Mullahs in Iran betitelte, die Macht immer mehr an sich. Es folgte ein acht Jahre währender Krieg mit Irak, der keine Sieger kannte. Die Mullahs vergaßen ihre großen Versprechungen, sich nicht in die Politik einzumischen, denn sie hatten etwas Unwiderstehliches geschmeckt: die Macht. Die Macht über ein ganzes Volk – und der SAVAK folgte die VEVAK [9]. Nun mussten sich plötzlich die Frauen verhüllen, die gesellschaftliche Ordnung wurde umgekehrt und Iran schritt zurück ins Mittelalter. Intellektuelle, besonders Ärzte, Künstler und Journalisten, wurden verfolgt. Musik wurde – mit Ausnahme klassischer Konzerte – öffentlich verboten. Man durfte nur dunkle Kleidung tragen, weil sich das Land aufgrund der vielen Kriegstoten in Trauer befand. Plötzlich erhielten jene die Macht, die man zuvor würdelos und herablassend behandelt hatte, die Habenichtse und Ungebildeten, die dem Regime blind folgten. Da sie es nicht anders kannten, missbrauchten sie ihre neuen Positionen ebenso, wie die früheren Inhaber es getan hatten, und wurden selbst zu Unterdrückern. Wieder wurden Menschen willkürlich hingerichtet, eingesperrt und verfolgt. In dieser Zeit wuchs Schirin zu einem jungen Mädchen heran.
Bijan hatte lange mit sich gerungen, Iran zu verlassen, wie es viele taten. Künstler konnten nicht mehr auftreten, denn Gesang, Filme und Musik waren nun verboten. Schriftsteller konnten ihrer Fantasie freien Lauf lassen, solange sie nicht die Wahrheit schrieben. Ein kritisches Wort gegen das Mullah-Regime konnte das Leben kosten. Die Menschen litten, doch sie hielten sich heimlich ihre Nischen offen. Auch Bijan. Nach wie vor fühlte er sich seiner Heimat verbunden und es schmerzte ihn, mitanzusehen, wie die Menschen unter den Theokraten litten. So veranstaltete er unauffällig, wie er meinte, seine Konzerte hinter verhangenen Fenstern und verschlossenen Türen. Sein Publikum blieb ihm treu und besuchte die Konzerte heimlich. Das Lied Mara bebus erhielt wieder Bedeutung. Nun sangen es auch die Iraner im Exil, um sich Mut zu machen. Denn diesmal richtete es sich gegen die Mullah-Diktatur.
Eines späten Abends, Bijan sang gerade das Lied und die Zuhörer hielten Teelichter in ihren Händen und sangen leise mit, erklang von draußen das Stampfen schwerer Stiefel. Ehe die Zuhörer begriffen, in welcher Gefahr sie schwebten, wurden plötzlich die Türen aufgerissen. Eine Meute von Revolutionswächtern in dunkelgrünen Militäruniformen stürmte herein und schlug kommentarlos mit ihren Gewehrläufen auf das Publikum ein. Die Menschen schrien, flehten, auch Kinder und Jugendliche waren unter ihnen. Doch die Pasdaran [10] hieben blindlings auf alles ein, was sich bewegte. Bijan kam es vor wie ein böser Traum, als sei er Zuschauer eines schlechten Films. Zwei Pasdaran sprinteten nach vorn, das Gewehr im Anschlag und zielten auf ihn.
»Mitkommen!«, schrie der eine und hieb ihm den Gewehrlauf in den Magen. Bijan krümmte sich vor Schmerzen. Wellenartig stieg die Übelkeit in ihm empor. Er war halb besinnungslos, als seine Peiniger ihn rau packten und aus dem Raum schleiften. Plötzlich ein Schlag auf den Hinterkopf. Er verlor das Bewusstsein.