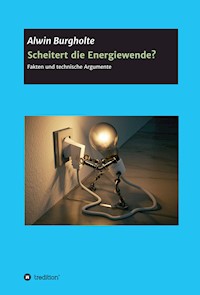
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Kann die Erderwärmung gestoppt und das Klima gerettet werden? Zwei substantielle Fragen, die unsere Politiker schon für sich beantwortet und mit gravierenden Änderungen durch Gesetze und Verordnungen unter dem Stichwort »Energiewende« beschlossen haben. Bedauerlicherweise bleibt dabei aber die Verhältnismäßigkeit auf der Strecke! Die mangelnde technische Sachkenntnis der Entscheidungsträger verhindert auch ihre geringsten Zweifel an den Beschlüssen, auch wenn immer häufiger auf die Gefährdung unserer Stromversorgungssicherheit hingewiesen wird. Aus technischen Gründen ist die Energiewende so nicht zu realisieren. Darum dieses Buch. Auf der Grundlage anerkannter Fakten und der Vorstellung der aktuellen Situation unserer Energieversorgung werden die technischen und wirtschaftlichen Zustände beschrieben. Die Beschlüsse zur Energiewende werden kritisch hinterfragt und auf ihre Realisierbarkeit geprüft. Wie Wissenschaft und Medien die politisch vorgegebenen Ziele unterstützen, macht schon nachdenklich. Sie bestimmen den Mainstream. Alternative Möglichkeiten zur Schonung der Ressourcen und zur Reduktion der Emissionen werden nicht aufgegriffen. Die zunehmenden negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft durch den massiven Zubau von Wind- und Solaranlagen bei einseitiger Förderung durch das EEG werden nicht zur Kenntnis genommen. Die in diesem Buch angesprochenen Themen werden nicht wissenschaftlich und akademisch behandelt. Leicht verständlich und mit vielen praktischen Beispielen sollen die Leser eine neue, auch kritische Einstellung zu künftigen technischen und wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten unserer Energieversorgung kennenlernen, denn auch in Zukunft ist eine sichere Energieversorgung unverzichtbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Alwin Burgholte
Scheitert die Energiewende?
Fakten und technische Argumente
Alwin Burgholte
Scheitert die Energiewende?
Fakten und technische Argumente
© 2021 Alwin Burgholte
Autor: Alwin Burgholte
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-33344-4
Hardvover:
978-3-347-33345-1
e.Book:
978-3-347-33346-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Fußnoten verweisen auf Internetquellen, die zum Zeitpunkt der Drucklegung erreichbar waren.
Es wird keine Haftung für den zitierten Inhalt der Quellen übernommen.
Das Copyright haben die Verfasser der Quelle.
Autor und Verlag haben alle Texte und Abbildungen mit großer Sorgfalt erarbeitet bzw. überprüft. Dennoch können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Weder Autor noch Verlag übernehmen irgendwelche Garantien für die in diesem Buch gegebenen Informationen. In keinem Fall haften Autor oder Verlag für irgendwelche direkte oder indirekte Schäden, die aus der Anwendung dieser Informationen folgen könnten.
Vorwort
Die Energiewende soll unser Klima retten; deshalb die politischen Aktivitäten ohne Rücksicht auf die Konsequenzen:
Ausstieg aus der Kohleverstromung, Umstieg auf die Elektromobilität, CO2-Bepreisung, Verbot von Öl- und Erdgasheizungen bis zu Flugscham und Essvorschriften. Unsere Politiker sind da sehr erfindungsreich; denn das Thema Klimarettung ist allgegenwärtig und bringt sogar tausende Kinder und Jugendliche auf die Straße. Schließlich sind das ja zukünftige Wähler, für die gehandelt werden soll. Doch wie sieht unser Energiealltag aus?
Unsere Abhängigkeit von einer gesicherten Stromversorgung wird uns immer erst dann bewusst, wenn kein Strom mehr geliefert wird, ob für Sekunden, Minuten, Stunden, Tage oder länger. Zuerst ist es nur ein wenig störend. Das Licht flackert oder der Rechner stürzt ab. Ärgerlicher ist dann schon die Verstellung aller Uhren, die synchron am Netz betrieben werden, weil keine konstante Frequenz mehr geliefert wird und wir deshalb zu spät zur Arbeit kommen.
Bleibt es dunkel, greifen wir spätestens nach einigen Stunden zum Telefon (sofern es noch geht) und rufen unseren Netzbetreiber an. Ist der Stromausfall großflächig, oder ist die Haussicherung ausgefallen? Doch das sind schon spezielle Fragen für den Fachmann. Die ganz große Mehrheit der Bevölkerung kann das Problem nur zur Kenntnis nehmen, jedoch nichts daran ändern.
Ist überhaupt Gefahr in Verzug?
Richtig ist auf jeden Fall die Zielvorgabe, Ressourcen zu schonen und langfristig auf fossile Energiequellen zu verzichten.
Noch hat Deutschland weltweit das sicherste Stromversorgungsnetz. 2017 betrug die durchschnittliche Unterbrechungsdauer nur 15,4 Minuten, 2018 nur 13,91 Minuten und 2019 nur 12,2 Minuten1 von 52 560 Minuten eines Jahres. Aber Miniblackouts unter drei Minuten sind dabei nicht berücksichtigt.
Doch fragen wir zuerst, woher der Strom kommt und wie er verteilt wird. Da gibt es nicht nur technische Fragen. Zunehmend wirken sich auch wirtschaftliche Faktoren oder sogar spekulative Manipulationen auf die Stromversorgungssicherheit aus. So kommt es nahezu alle 15 Minuten zu Stabilitätsproblemen im Netz, weil alle 15 Minuten ein neuer Strompreis an der Strombörse veröffentlicht wird und dies zu Netzumschaltungen bei den Verbrauchern führt.
Spannend wird es auch, wenn wir an den zukünftigen Bedarf elektrischer Leistung denken, wie er aus den Maßnahmen zur Sektorkopplung im Verkehr und in der Wärmeversorgung entstehen wird.
Technische Argumente werden in der politischen Argumentation nicht genannt. Voraussetzungen, die eine gesicherte Stromversorgung garantieren, werden verschwiegen, bewusst oder tatsächlich aus Unkenntnis? Wind- und Solaranlagen können nur in ein vorhandenes stabiles Stromversorgungsnetz einspeisen und kein eigenes Netz aufbauen. Auch die vorhandene Sicherheitstechnik gegen Kurzschlussströme versagt, weil die Anlagen nur geregelte Nennströme liefern können. Deshalb ist ein Strategiewechsel erforderlich, um eine »Energiewende« realisieren zu können.
Die Themen werden nicht wissenschaftlich und lehrbuchmäßig behandelt. Leicht verständlich, mit vielen Beispielen, können die Leser eine neue, auch kritische Einstellung zu diesem wichtigen Thema entwickeln und belegte wissenschaftliche Fakten hinterfragen.
Beachtet werden sollte dabei auch die Verhältnismäßigkeit der Forderungen und Beschlüsse.
Eine ergebnisoffene breite Diskussion ist lange überfällig.
Vielleicht finden sich auch Anregungen, wie eine individuelle Vorsorge getroffen werden kann.
Alwin Burgholte
Wilhelmshaven, Mai 2021
1 https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/20201022_SAIDIStrom.html
1. Stromerzeugung
1.1 Kraftwerke als Leistungserzeuger
1.2 Prinzipielle Wirkungsweise konventioneller Kraftwerke
1.3 Prinzipielle Wirkungsweise von Blockheizkraftwerken
1.4 Regenerative Energieerzeugungsanlagen
1.4.1 Biogas Kraftwerke
1.4.2 Wasserkraftwerke
1.4.3 Prinzipielle Wirkungsweise der Pumpspeicherkraftwerke
1.4.4 Solaranlagen
1.4.5 Windenergieanlagen
1.4.6 Brennstoffzelle
1.4.7 Geothermie
2. Stromspeicher
2.1 Akkumulatoren
2.2 Wärmespeicher
2.3 Power to Gas Umwandlung
3. Derzeitige Energieversorgung
3.1 Primärenergieverbrauch in Deutschland
3.2 Elektrische Energieerzeugung
3.3 Anteile der einzelnen Erzeugeranlagen
3.4 Verfügbarkeit elektrischer Leistung
4. Stromversorgung - heute
4.1 Leistungserzeugung und -bedarf im Jahresverlauf
4.2 Überschussleistung führt zu negativen Strompreisen
4.3 Strompreisbildung
4.4 Kraftwerksstilllegungsplanung
4.5 Netzentwicklungsplanung der BNetzA
4.6 Erneuerbare Energieanteile an der Energieversorgung
4.7 Kapazitätsmarkt und Versorgungssicherheit
4.8 Deutschland droht Versorgungsengpass
4.9 Der Irrweg zur Dekarbonisierung unserer Energieversorgung
4.10 Störungen der Netzqualität werden ignoriert
5. Zukünftige Stromversorgung
5.1 Smart Grid
5.2 Sektorkopplung
5.3 Verantwortung der Bundesnetzagentur (BNetzA)
5.4 Wird die Stromversorgungssicherheit gefährdet?
5.5 Blackout Gefahr
5.6 Kosten eines Blackouts
5.7 Krisenvorsorge
5.8 Wärmeversorgung
5.8.1 Wärmepumpen
5.8.2 Solarthermie im Einfamilienhaus
5.8.3 Energieeinsparverordnung
5.9 Verkehr
5.9.1 Elektromobilität
5.9.2 Der Weg in die Wasserstoff-Gesellschaft
5.9.3 Kann Wasserstoff die Energiewende noch retten?
6. Politische Verantwortung für Fehlinvestitionen
6.1 Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich
6.2 Steinkohlekraftwerk Datteln
6.3 Vorschläge von Expertenkommissionen
6.4 Atomausstiegs-Gesetz
6.5 Klimagesetze
7. Ausbau der Förderprogramme
7.1 Förderung Kohleausstieg
7.2 Förderung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen
7.3 Fördersätze für Biomasseanlagen
7.4 Förderung von Windenergieanlagen
7.5 Förderung von Solaranlagen
7.6 Förderung der Elektromobilität
7.7 Förderung der Ladeinfrastruktur
8. Privatwirtschaftliche Verluste
8.1 Niedergang der Solarwirtschaft
8.2 Niedergang der Windenergiebranche
8.3 Neue Arbeitsplätze durch Rückbau alter Windanlagen
9. Viele Forschungsinstitute leben nicht schlecht davon
9.1 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)
9.2 Agora Energiewende
9.3 Agora Verkehrswende
10. Umsetzung der politisch vorgegebenen Ziele
10.1 Klare Vorgabe
10.2 Aufbau - Entwicklung der wissenschaftlichen Institutionen
10.3 Und die Wissenschaft macht auch mit
10.4 Die Medien verstärken und profitieren
11. Manipulierte Informationen täuschen die Öffentlichkeit
11.1 Neue Studie »Windanlagen auf See liefern jeden Tag Strom«
11.2 Einhundert Prozent regenerative Energien für Strom und Wärme
11.3 Exportieren wir massiv PV-Strom ins europäische Ausland?
11.4 Medien unterstützen den Zubau von Windenergieanlagen
11.5 Meeresspiegel-Anstieg
11.6 Gefahr durch Kohlekraftwerke
12. Fazit
13. Literaturverzeichnis
2. Stromspeicher
Stromspeicher für große Energiemengen sind weder technisch noch physikalisch und heute auch nicht wirtschaftlich absehbar.
Batterien sind als Speichermedium nur für Sekunden, Minuten oder Stunden geeignet.
Derzeit speichern 36 Pumpspeicherwerke 37,4 GWh. Sie könnten eine maximale Leistung von 6,7 GW für 4 bis 8 Stunden liefern. Eine Überbrückung von 14 Tagen Dunkelflaute würde 21 TWh erfordern. Dafür wären insgesamt 20 000 Pumpspeicherkraftwerke erforderlich, was absolut nicht realisierbar ist. Außerdem kann die Wirtschaftlichkeit von Pumpspeicherkraftwerken nur erreicht werden, wenn im Tagesrhythmus Ein- und Ausspeicherung stattfindet und die Einkaufs- und Verkaufspreise dazu passen.
Bild 22 zeigt eine Übersicht der erreichbaren gemittelten Werte der Volllaststunden regenerativer Anlagen für die Jahre 2018 bis 2030 in Deutschland71.
Bild 22.
3. Derzeitige Energieversorgung
Die elektrische Stromerzeugung erfolgt bisher überwiegend in Kraftwerken, also in Braun- und Steinkohlekraftwerken, Kernkraft-, Gas-, Öl- und Müllverbrennungskraftwerken. Dabei muss deckungsgleich genau so viel elektrische Leistungerzeugt werden, wie benötigt wird. Zahlenangaben zur Energie sagen nichts über eine verfügbare Leistung aus.
Für Wärme und Verkehr werden Kohle, Gas und Öl als Primärenergieträger genutzt. Tabelle 2 listet den Primärenergieverbrauch (brutto) und den Nettoenergieverbrauch für die Jahre 2014 bis 2020 auf. Zur Erinnerung: Energie in Terawattstunden ist gleich Leistung in Gigawatt multipliziert mit der Zeit in Stunden. Verbraucher benötigen für ihre Anwendungen aber die erforderliche Leistung.
3.1 Primärenergieverbrauch in Deutsch and
Tabelle 2. Energieverbrauch für die Jahre 2014 bis 2020
3.2 Elektrische Energieerzeugung
2020 wurden 488,7 TWh elektrische Netto-Energie erzeugt (Bild 23), das sind 282 TWh mehr als in 201990,91. 2020 lieferten die regenerativen Quellen 247 TWh oder 50,5% und 2019 (46%) 238 TWh. Bezogen auf die in 2020 hinzu gekommene installierte Leistung bei Wind- und Solaranlagen von 4,7 GW, sind 9 TWh ein sehr geringer Zuwachs. Mit anderen Worten: Die zusätzlich installierten Wind- und Solaranlagen mit 4,7 GW speisten von den 8760 Jahresstunden nur 1915 Stunden ihre Nennleistung ein. Die Leistung stand nur für knapp ein Viertel der Jahresstunden zur Verfügung, (die Zahlen differieren je nach benutzter Quelle geringfügig).
Bild 23. Nettoenergieerzeugung in Deutschland für 2020 - 2019
Die elektrische Energie von 488,7 TWh wird zu 98% in den Sektoren Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen eingesetzt92, also Bereiche, die die meisten Arbeitsplätze bieten. Bild 24 zeigt die einzelnen Anteile. Die Überschrift »Stromverbrauch« im Chart ist nicht gerechtfertigt, weil Energieanteile dargestellt sind. Bemerkenswert ist der hohe Bedarf von 45% für die Industrie und 26% für Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, zwei Sektoren, die den größten Teil der Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Im Verkehr werden nur 2% benötigt. Dieser geringe Anteil elektrischer Energie betrifft ausschließlich elektrisch betriebene Fahrzeuge, überwiegend bei der Bahn.
Bild 24. Energieverbrauch in Deutschland nach Verbrauchergruppen
3.3 Anteile der einzelnen Erzeugeranlagen
Mit einer gesamten installierten Windleistung in 2020 von 54 938 MW aus 29 608 Anlagen erzeugten diese einen Energieanteil von 132 TWh, das sind 27%. Solaranlagen waren mit 49 780 MW aus über 1,7 Millionen Anlagen installiert und lieferten 51,42 TWh, also 10,5% des Nettoenergiebedarfs. Leider sagen die Energieanteile nichts über die gelieferte Leistung aus, die jederzeit für den Verbraucher verfügbar sein muss, auch wenn die Charts mit »Stromerzeugung« beschriftet sind. Tabelle 3 listet alle in 2020 verfügbaren Erzeugeranlagen mit ihren installierten Leistungen auf93.
(Die Zahlen variieren je nach verwendeter Datenquelle)
Tabelle 3. in 2020 verfügbare Erzeugeranlagen mit ihren installierten Leistungen
In 2020 betrug die gesamte installierte Solar- und Windleistung 116 GW, die 33,4% des Energiebedarfs lieferten. Konventionelle Kraftwerke lieferten mit einer installierten Leistung von 82,9 GW 50,8% des Netto-Energieverbrauchs! Der elektrische Nettoenergieerzeugung 2020 mit 539,4 TWh, verteilt sich auf folgende Erzeugerquellen:
• 45,4% oder 244,9 TWh regenerativ
• 39,5% oder 213,2 TWh auf Kohlenstoffbasis (Braun-, Steinkohle, Erdgas)
• 11,3% oder 60,9 TWh auf Kernenergie
Braun- und Steinkohle lieferten mit 44,7 GW installierter Leistung allein 123,5 TWh des elektrischen Energiebedarfs, das entspricht 22,9%.
3.4 Verfügbarkeit elektrischer Leistung
Zur Erinnerung: elektrische Leistung wird in Watt, kW, MW oder GW gemessen und angegeben. Die Energie, die sich aus der über eine Zeitspanne bezogenen Leistung berechnet, wird in Wattsekunden(Ws) bzw. für große Energiemengen in Kilowattstunden (kWh), Megawattstunden (MWh), Gigawattstunden (GWh) oder Terawattstunden (TWh) angegeben. Ein Vierpersonenhaushalt benötigt ca. 3500 kWh in einem Jahr. Der Bedarf für die gesamte Bundesrepublik liegt bei ca. 600 TWh, das sind 600 Milliarden kWh. Dabei schwankt der monatliche Bedarf nach Jahreszeit und Monat zwischen 60,4 TWh im Januar und 43,4 TWh im Juni 2019. Im Durchschnitt beträgt der monatliche Bedarf 50,3 TWh, das sind 70 GW über 24 Stunden (Bild 25)94. Auch hier wird wieder von Bruttostromerzeugung gesprochen und Energieanteile dargestellt. 2020 verringert sich der Bedarf um ca. 9,5%.
Bild 25. Monatliche Energieerzeugung in Deutschland
86 https://www.energie-lexikon.info/kvaerner_verfahren.html
87 https://www.bdew.de/energie/primaerenergieverbrauch-in-deutschland-nach-energietraegern-2020/
88 https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/news/2020/nettostromerzeugung-in-deutschland-2021-erneuerbare-energien-erstmals-ueber-50-prozent.html
89 https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/primaerenergieverbrauch#primarenergieverbrauch-nach-energietragern
90 https://www.laborpraxis.vogel.de/wie-gruen-ist-strom-aus-deutschland-a-990423/
91 https://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/news/2020/nettostromerzeugung-in-deutschland-2021-erneuerbare-energien-erstmals-ueber-50-prozent.html
92 https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/stromverbrauch-deutschland-verbrauchergruppen/
93 https://www.bdew.de/service/daten-und-grafiken/installierte-leistung-und-erzeugung/





























