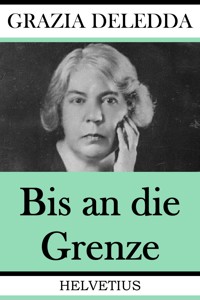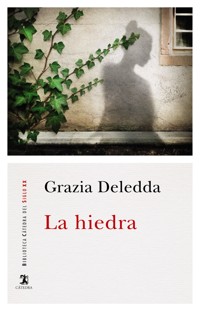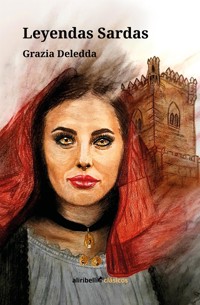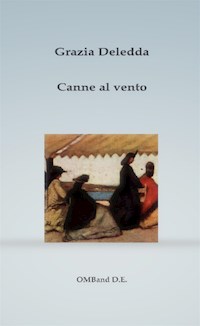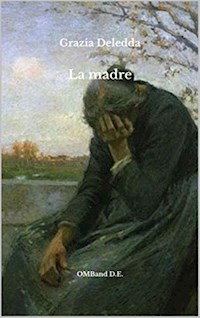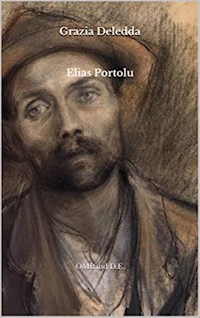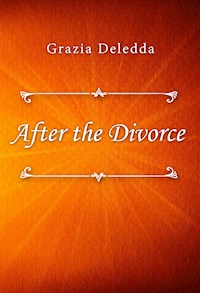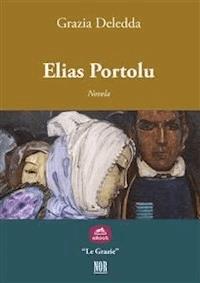Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Schilf im Wind (im italienischen Original Canne al vento) ist ein Roman der sardischen Schriftstellerin Grazia Deledda, die u.a. für dieses Werk 1926 den Literaturnobelpreis erhielt. Der Roman spielt mit den zentralen der kargen Landschaft Sardiniens, der Armut, dem Aberglauben der Sarden und der Ehre. Grazia Deledda, (1871-1936) war eine italienische Schriftstellerin und Nobelpreisträgerin der Literatur des Jahres 1926. Sie zählte zu den bedeutendsten Autorinnen des Naturalismus innerhalb der italienischen Literatur. In ihren Werken schildert sie das harte Leben der Sarden. Deleddas Bücher sind Schicksalsromane, die oft Frauen als zentrale Figuren haben, die in Konflikten um Ehre, Glauben und gesellschaftliche Vorurteile zerrieben werden. Das Nobelpreiskomitee verlieh ihr den Preis "für ihre von Idealismus getragenen Werke, die mit Anschaulichkeit und Klarheit das Leben auf ihrer heimatlichen Insel schildern und allgemein menschliche Probleme mit Tiefe und Wärme behandeln."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Schilf im Wind
Titel SeiteImpressumGrazia Deledda
Schilf im Wind
I.
Den ganzen Tag hatte Efix, der Knecht der Damen Pintor, an der Verstärkung des dürftigen Dammes gearbeitet, den er selbst im Wandel arbeitsamer Jahre, am Rande des kleinen Bauerngutes, längs des Flusses aufgeschüttet hatte; und nun, bei Einbruch der Dunkelheit, betrachtete er sein Tagewerk aus der Höhe, vor seiner Hütte sitzend, im Schutze des blaugrünen Schilfrohrs, das sich am weißen Hang des Taubenhügels emporzog.
Still und friedlich, da und dort von einem schimmernden Wässerchen geädert, ruht das Gut im Dämmerschein zu seinen Füßen – dieses Gut, das Efix mehr als sein Eigentum betrachtet denn als Eigentum seiner Herrinnen. Dreißig Jahre harter Arbeit ließen ihn eng damit verwachsen, und die beiden Feigenhecken, die es zu beiden Seiten einfrieden wie zwei graue, sich allmählich über den Hang zum Fluß hinabschlängelnde Mauern, erscheinen ihm wie die Grenzen der Welt.
Absichtlich blickte der Knecht nicht über sie hinaus, da das Land daneben einst auch seinen Herrinnen gehört hatte. Warum in die Vergangenheit zurückschweifen? Sinnlose Trauer ... Nein, lieber an die Zukunft denken und auf des Himmels Hilfe hoffen.
Und der Himmel verhieß heuer eine gute Ernte, ließ die Mandelbäume und Pfirsichsträucher im Talgrund in üppiger Blüte prangen; und dieser, eingesäumt von zwei weißen Hügelketten, mit den blaudunstigen Bergen fern im Westen und dem schimmernden Meer im Osten, war wie eingebettet in grüne und blaue Schleier, darunter der Fluß seine einschläfernde Weise murmelte.
Aber die Tage waren schon recht heiß – fast zu heiß, und Efix dachte besorgt an die Gewitterregen, die den nicht eingedämmten Fluß anschwellen und aus den Ufern treten und alles ringsum verheeren lassen. Hoffen, ja – aber nicht vertrauen! Vor allem aber auf der Hut sein wie das Schilfrohr am Hang, durch das schon beim leisesten Windhauch ein banges Flüstern und Raunen geht, wie zur Warnung vor der drohenden Gefahr ...
Deshalb hatte er ja auch den ganzen Tag gearbeitet und betete nun, während er der Nacht entgegenharrte und eine Binsenmatte flocht, zu Gott, damit er sein Werk segnen möge. Was nützt ein kleiner Damm, wenn der Herr ihn nicht mit seinem Willen unerschütterlich macht wie einen Felsen?
Sieben Binsen also durch eine Weidenrute und sieben Gebete zum Herrgott und zu Unserer Lieben Frau dort in dem kleinen Kirchlein in der Ferne, das ins tiefe Blau der Dämmerung taucht, umringt von friedlichen Hütten, von einem uralten, wie seit Jahrhunderten verlassenen Dorf. In dieser Stunde, wenn der Mond wie eine große Rose zwischen den Sträuchern am Hügel erblühte und die Wolfsmilch berauschend am Fluß unten duftete, sprachen auch Efix' Herrinnen den Abendsegen. Fräulein Esther, die älteste, schloß sicherlich auch ihn, den armen Sünder, ein in ihr Gebet; und das genügte, um ihn froh zu stimmen und zu belohnen für all seine Mühe.
Da ließ ein Schritt in der Ferne ihn plötzlich aufblicken. Er glaubte ihn zu erkennen; es war ein rascher, leichtbeschwingter Schritt, als eilte ein Engel durch das Land, um freudige und traurige Mären zu verkünden. Der Wille des Herrn geschehe immerdar; er ist es, der gute und schlechte Botschaft schickt! Aber sein Herz begann laut zu pochen, und auch die Binsen, die silbern wie Wasserstrahlen im Mondlicht glitzerten, zitterten in seinen schwarzen, rissigen Fingern.
Nun war der Schritt nicht mehr zu hören. Dennoch blieb Efix regungslos sitzen und wartete.
Höher und höher stieg der Mond, und die Stimmen des Abends verkündeten dem Alten, daß sein Tagewerk zu Ende war: der gedämpfte Ruf des Kuckucks, das Zirpen der jungen Grillen, ein klagender Vogelschrei; das Seufzen des Schilfrohrs und das immer heller tönende Lied des Flusses; ein geheimnisvolles Wispern und Atmen, das aus der Erde selbst zu kommen schien. Ja, des Menschen Tagewerk war nun zu Ende; dafür erwachten nun die Gnome, die Elfen und die ruhelosen Seelen der Gestorbenen zu gespenstischem Leben. Die Geister der alten Ritter kamen aus der Schloßruine über dem Dorf Galte links im Tal herab und jagten an den Ufern des Flusses nach Ebern und nach Füchsen; ihre Waffen blitzten durch das niedrige Erlengestrüpp, und das heisere Hundegebell in der Ferne zeigte an, daß sie vorübertrabten.
Zumal in hellen Mondnächten treibt dieser Geisterspuk auf den Hügeln und in den Tälern sein geheimnisvolles Wesen, und dann soll der Mensch ihn nicht stören durch seine Gegenwart, da ja auch die Geister ihn untertags unbehelligt ließen. Ja, dann wird es Zeit, sich zurückzuziehen und einzuschlummern unter den Fittichen der Schutzengel.
Efix bekreuzte sich und stand auf. Aber noch immer erwartete er irgend jemand. Trotzdem schob er das Brett vor, das als Tür diente, und lehnte ein großes Kreuz aus Schilfrohr dagegen, das den bösen Geistern und den Anfechtungen des Teufels das Eindringen in die Hütte verwehren sollte.
Das Mondlicht fiel durch die Ritzen in den engen, niedrigen Raum, der freilich groß genug schien für ihn, der klein und mager war wie ein junger Bursche. Von dem kegelförmigen Schilf- und Binsendach, das die rohgemauerten Wände deckte und in der Mitte ein Loch zum Abziehen des Rauches hatte, hingen an Schnüren aufgereihte Zwiebeln und getrocknete Kräuterbüschel herab, geweihte Palm- und Ölzweige, ein bunter Wachsstock, eine Sichel zum Schutze gegen den Werwolf und ein Säckchen Gerste zum Schutze gegen die Panas, die irrenden Seelen der im Wochenbett verstorbenen Frauen. Bei jedem Luftzug gerieten all diese Dinge in Bewegung, und die Spinnweben glitzerten im Mondschein. Am Boden lag der Tonkrug mit den großen Henkeln, und daneben ruhte der umgestürzte Wasserkessel.
Efix schüttelte den Strohsack auf, legte sich aber nicht hin. Immer wieder glaubte er den leichtbeschwingten Schritt zu hören. Sicher nahte dort irgend jemand, und wirklich schlugen plötzlich die Hunde auf den Nachbargütern an, und das ganze Land, das erst vor kurzem unter dem Raunen der nächtlichen Stimmen sanft entschlummert zu sein schien, hallte wider von dumpfen Lauten, erwachte gleichsam wieder.
Efix öffnete die Tür wieder. Eine dunkle Gestalt stieg den Hügelhang empor, auf dem die Zwergbohnen silbern im Mondschein wogten, und der Knecht, dem nachts auch die menschlichen Gestalten nicht geheuer erschienen, schlug wieder ein Kreuz. Da rief ihn auf einmal eine wohlbekannte Stimme an. Es war die muntere, aber leicht keuchende Stimme eines jungen Burschen, der neben dem Haus der Damen Pintor wohnte.
»Gevatter Efix, Gevatter Efix!«
»Was gibt's, Zuannantò? Sind meine Damen wohlauf?«
»Ich glaube – ja. Sie lassen Ihnen nur sagen, Sie möchten morgen frühzeitig ins Dorf zurückkehren – sie müßten Sie sprechen. Es ist wohl wegen eines gelben Briefs, den ich in Fräulein Noemis Hand sah. Fräulein Noemi las ihn leise vor, und Fräulein Ruth, die wie eine Nonne aussah mit ihrem weißen Kopftuch, fegte gerade den Hof, stützte sich aber müßig auf den Besenstiel und hörte zu.«
»Ein Brief? Weißt du nicht, von wem er ist?«
»Nein, ich nicht; ich kann doch nicht lesen. Aber meine Großmutter meint, er sei vielleicht vom jungen Herrn Giacinto, dem Neffen Ihrer Herrinnen.«
Ja, das fühlte Efix; sicher war es so; trotzdem kratzte er sich sinnend, mit gesenktem Kopf an der Wange und hoffte und fürchtete, sich zu täuschen.
Der junge Bursche hatte sich müde auf den Felsblock vor der Hütte gesetzt, schnürte langsam seine Nagelschuhe auf und fragte, ob nichts zum Essen da sei.
»Ich bin gerannt wie ein junger Hirsch, ich hatte Angst vor den bösen Geistern ...«
Efix hob das wettergebräunte, harte Gesicht und starrte den Burschen mit hellblauen, tiefliegenden, von vielen Fältchen umgebenen Augen an, und aus diesen lebhaft blitzenden Augen sprach eine fast kindliche Angst.
»Haben sie dir gesagt, ob ich erst morgen früh oder noch heute nacht zurückkehren soll?«
»Ich sage Ihnen doch, morgen früh. Und inzwischen, während Sie im Dorf sind, soll ich hier auf dem Gut nach dem Rechten sehen.«
Der Knecht war gewohnt, seinen Herrinnen zu gehorchen, und stellte keine weiteren Fragen. Er nahm eine Zwiebel von der Schnur, ein Stück Brot aus dem Beutel, und während der junge Bursche, halb lachend, halb weinend infolge des beißenden Geruchs der Zwiebel, sein karges Mahl verzehrte, fuhren sie fort, zu plaudern. Die wichtigsten Persönlichkeiten im Dorfe gingen durch ihr Gespräch: zunächst kam der Herr Pfarrer, dann die Schwester des Pfarrers, dann Milese, der eine Tochter der letzteren geheiratet hatte und aus einem Apfelsinen- und Tonwarenhändler zum reichsten Kaufmann im Dorf geworden war. Es folgte Don Predu, der Amtmann und Vetter von Efix' Herrinnen. Auch Don Predu war wohlhabend, aber nicht ganz so reich wie Milese. Und zuletzt kam noch die Wucherin Kallina, auch eine reiche, märchenhaft reiche Frau.
»Neulich versuchten Diebe bei ihr einzubrechen. Umsonst – sie ist gefeit! Und am nächsten Morgen kicherte sie in ihrem Hof und sagte: ›Sollen sie ruhig einbrechen, sie werden nichts als Asche und ein paar alte Nägel finden, ich bin arm – arm wie eine Kirchenmaus.‹ Aber meine Großmutter meint, die Muhme Kallina halte einen Beutel Gold in der Wand versteckt.«
Aber Efix kümmerte sich im Grunde wenig um dieses Geschwätz. Die eine Hand unter der Achsel, die andere unter der Wange, lag er auf seinem Strohsack und hörte sein Herz klopfen, und das Rauschen des Schilfrohrs draußen am Hang tönte wie das Seufzen eines bösen Geistes an sein Ohr.
Dieser gelbe Brief! Gelb, eine schlechte Farbe. Wer weiß, was alles seinen Herrinnen noch zustoßen würde? Zwanzig Jahre ging das nun schon so: wenn wirklich einmal ein Ereignis das eintönige Leben im Hause Pintor unterbrach, war es unweigerlich ein Unglück.
Auch der junge Bursche hatte sich hingelegt, hatte aber noch keine Lust zum Schlafen.
»Gevatter Efix, auch heute erzählte meine Großmutter wieder, daß Ihre Herrinnen einmal so reich gewesen seien wie Don Predu. Stimmt's oder stimmt's nicht?«
»Ja, es stimmt«, seufzte der Knecht. »Aber es ist jetzt nicht Zeit, diese alten Geschichten aufzurühren. Schlaf du lieber!«
Der junge Bursche gähnte.
»Aber meine Großmutter meint, daß seit dem Tode Frau Marias, Ihrer alten Herrin selig, ein Fluch auf eurem Hause ruhe. Stimmt's oder stimmt's nicht?«
»Du sollst doch schlafen, es ist jetzt nicht Zeit ...«
»Lassen Sie mich doch reden! Und warum ist Fräulein Lia, Ihre kleine Herrin, entflohen? Meine Großmutter meint, Sie wüßten es. Sie hätten Fräulein Lia zur Flucht verholfen, hätten sie bis zur Brücke gebracht, wo sie sich versteckt hätte, bis ein Fuhrwerk vorbeikam, mit dem sie bis ans Meer fuhr. Dort – dort hätte sie sich dann eingeschifft. Und Don Zame, ihr Vater und Ihr Herr, suchte und suchte sie, bis er eines schrecklichen Todes starb. Dort – bei der Brücke, nicht wahr? Wer hat ihn wohl ermordet? Meine Großmutter meint, Sie wüßten es ...«
»Deine Großmutter ist eine alte Hexe. Laßt die Toten gefälligst ruhen, ihr beiden!« schrie Efix; aber seine Stimme klang heiser, und der junge Bursche lachte dreist.
»Keine Aufregung, das könnte Ihnen schaden, Gevatter Efix. Meine Großmutter meint, der Nöck habe Don Zame umgebracht. Stimmt's oder stimmt's nicht?«
Efix gab keine Antwort. Er schloß die Augen, hielt sich das Ohr zu, aber die Stimme des Jungen dröhnte dumpf durchs Dunkel, und ihm war, als spräche die Vergangenheit aus ihr.
Wie die Strahlen des Mondes stehlen sie sich, einer nach dem anderen, durch die Ritzen und scharen sich alle um ihn: Frau Maria Christina, schön und sanft wie eine Heilige; Don Zame, krebsrot und wild wie der Teufel; die vier Töchter, über deren bleichen Gesichtern ein heiterer Schimmer liegt wie über dem der Mutter, und in deren Augen eine düstere Leidenschaft flammt wie in denen des Vaters; die Knechte und die Mägde, die Verwandten und die Freunde, sie alle, die aus und ein gehen in dem reichen Hause, bei den Nachkommen der alten Burgherren aus der Gegend. Aber da bricht auf einmal das Unglück über sie herein, und alle stieben auseinander wie Wolken am Himmel, wenn der Föhnsturm pfeifend zwischen sie fegt.
Frau Christina ist nun tot; die bleichen Gesichter der Töchter verlieren mehr und mehr an Heiterkeit, und die düstere Glut in ihren Augen wächst. Wächst in dem Maße, wie Don Zame nach dem Tode seiner Gattin immer mehr das herrische Wesen seiner Ahnherren annimmt und die vier Mädchen wie Mägde gefangenhält im Hause und auf Freier wartet, die ihrer würdig sind. Und wie Mägde müssen diese arbeiten, Brot backen, Flachs spinnen, nähen und kochen und ihre Sachen in Ordnung halten; vor allem aber dürfen sie nie den Blick zu einem Manne erheben oder an jemand denken, der ihnen nicht zum Bräutigam bestimmt ist. Aber die Jahre verstreichen, und kein Freier stellt sich ein. Und je älter seine Töchter werden, desto unerbittlicher sieht Don Zame darauf, daß sie streng im Geist der Väter leben. Wehe, wenn er sie am Fenster stehen und auf das Gäßchen hinter dem Hause blicken sieht, oder wenn sie ohne seine Erlaubnis fortgehen! Dann schlägt er sie, überhäuft sie mit Schmähungen und bedroht die jungen Burschen mit dem Tode, die zweimal hintereinander durch das Gäßchen gehen.
Er selbst treibt sich den ganzen Tag im Dorf herum oder sitzt auf der Steinbank vor dem Krämerladen, der der Schwester des Pfarrers gehört. Und wenn die Leute ihn dort sitzen sehen, machen sie einen großen Bogen, so sehr fürchten sie seine böse Zunge. Er sucht Händel mit aller Welt und ist so neidisch auf die Habe der anderen, daß er jedesmal, wenn er einen reichen Gutshof betritt, hämisch sagt: »Die Herren Advokaten werden dich schon noch darum bringen.« Aber statt dessen bringen die Prozesse schließlich ihn um Haus und Hof, und eines Tages trifft ihn ein schweres Unglück wie zur Strafe für seinen Hochmut und seine Vorurteile. Fräulein Lia, die drittälteste seiner Töchter, verschwindet eines Nachts aus dem Vaterhaus, und lange Zeit hört man nichts mehr von ihr. Ein düsterer Schatten lastet auf dem Haus; noch nie ist eine solche Schande im Dorfe vorgekommen; noch nie ist ein ehrbares und züchtiges Mädchen wie Fräulein Lia einfach von Zuhause fortgelaufen. Don Zame scheint den Verstand zu verlieren; rastlos irrt er durch das ganze Land, sucht verzweifelt die Umgebung und die Küste nach seinem Kinde ab; doch niemand vermag ihm Nachricht von Lia zu geben. Schließlich schreibt sie an ihre Schwestern, teilt ihnen mit, daß sie gut aufgehoben sei und glücklich, ihre Fesseln abgestreift zu haben. Aber die Schwestern verzeihen ihr nicht, würdigen sie keiner Antwort. Don Zame hält sie nun noch strenger als zuvor. Er verkauft den Rest seiner Habe, mißhandelt den Knecht, behelligt alle Leute mit seiner Streitsucht und reist noch immer durch das Land, in der Hoffnung, seine Tochter wieder einzufangen und nach Hause zu schleppen. Und dann findet man ihn eines Morgens tot auf der Landstraße, auf der Brücke hinter dem Dorf. Scheinbar ist er an einem Herzschlag gestorben, denn keine Spur einer Gewalttat ist an ihm zu sehen, nur ein kleiner grüner Fleck am Halse, unterm Nacken.
Im Dorfe heißt es zunächst, Don Zame hätte wie so oft Streit gesucht mit einem anderen und sei mit einem Knüppel erschlagen worden; aber mit der Zeit verstummt dieses Gerücht und weicht der Gewißheit, daß er an gebrochenem Herzen, wegen der Flucht seiner Tochter verschieden ist.
Und indes die durch Lias Flucht entehrten Schwestern keinen Gatten finden, zeigt sie ihnen eines Tages in einem Briefe ihre Heirat an. Ihr Mann sei ein Viehhändler, den sie zufällig auf ihrer Flucht kennengelernt hätte. Sie lebten in Civitavecchia, in ziemlich guten Verhältnissen, und sollten demnächst ein Kind bekommen.
Auch diese neue Verirrung, diese Heirat mit einem Emporkömmling, den sie unter so traurigen Umständen kennengelernt hat, verzeihen ihr die Schwestern nicht, und sie würdigen sie wieder keiner Antwort.
Bald darauf teilt ihnen Lia die Geburt Giacintos mit. Sie schicken dem Neffen ein Taufgeschenk, schreiben aber kein Wort an die Mutter.
Und so vergehen die Jahre. Giacinto wächst heran, schreibt jedes Jahr zu Ostern und zu Weihnachten an die Tanten, und die Tanten schicken ihm ein Geschenk. Bald schreibt er, daß er studiert, bald, daß er zur See gehen wolle; und dann wieder, daß er eine Stellung gefunden hätte; dann zeigt er ihnen den Tod seines Vaters an und dann den seiner Mutter; und schließlich verleiht er dem Wunsche Ausdruck, sie zu besuchen und ständig bei ihnen zu bleiben, wenn er im Dorfe Arbeit fände. Sein kleiner Posten bei der Zollbehörde behage ihm nicht; er sei erniedrigend und beschwerlich, verdürbe ihm seine Jugend. Und er sehne sich nach einem arbeitsamen Leben, ja – aber nach einem schlichten Leben unter freiem Himmel. Alle Leute rieten ihm, nach der Insel seiner Mutter zu fahren und dort in ehrlicher Arbeit sein Glück zu versuchen.
Die Tanten beginnen hin und her zu überlegen; und je länger sie überlegen, desto weniger vermögen sie sich zu einigen.
»Arbeiten will er?« sagt Fräulein Ruth, die besonnenste. »Wo das Dörfchen nicht einmal die Einheimischen ernährt?«
Fräulein Esther dagegen begünstigt die Pläne des Neffen, während Fräulein Noemi, die jüngste, nur kalt und spöttisch lächelt.
»Vielleicht gedenkt er hier den feinen Herrn zu spielen. Mag er ruhig kommen! Dann kann er ja an den Fluß gehen und Fische angeln ...«
»Aber Noemi, liebe Schwester, er schreibt doch selbst, er möchte arbeiten. Und er wird gewiß auch arbeiten, wird einen kleinen Handel anfangen wie sein Vater.«
»Da hätte er etwas früher anfangen müssen. Und unsere Ahnen haben nie mit Vieh gehandelt.«
»Andere Zeiten, liebe Noemi, übrigens sind heutzutage die Händler die wahren Herren. Sieh dir doch den Milese an! Der sagt: Der Herr von Galte bin jetzt ich!«
Noemi lacht, in ihren dunklen Augen blitzt es boshaft, und ihr Lachen entmutigt Esther noch mehr als alle Einwände der anderen Schwester.
Jeden Tag ist es das gleiche Lied. Giacintos Name hallt durchs ganze Haus; auch wenn die Schwestern schweigen, weilt er unter ihnen, wie schon seit der Stunde seiner Geburt, und seine fremde Gestalt erfüllt das zerfallene Haus mit jungem Leben.
Efix erinnerte sich nicht, je unmittelbar an den Gesprächen seiner Herrinnen teilgenommen zu haben. Er wagte es nicht, vor allem wohl, weil sie ihn nicht zu Rate zogen, aber auch weil er sein Gewissen nicht belasten wollte; doch er wünschte, der junge Herr möchte kommen.
Er liebte ihn, hatte ihn schon immer geliebt, fast wie einen Sohn.
Nach Don Zames Tod war er bei den drei Damen geblieben, um ihnen zu helfen beim Ordnen der verworrenen Vermögensverhältnisse. Die Verwandten kümmerten sich nicht um sie, verachteten und mieden sie eher; sie wußten nur im Haushalt Bescheid und kannten nicht einmal das kleine Gut, das letzte Überbleibsel von dem Erbe ihrer Väter.
Ich werde noch ein Jahr in ihrem Dienste bleiben, hatte sich Efix gesagt, mitleidig gestimmt durch ihre Hilflosigkeit. Und aus dem einen Jahr waren zwanzig geworden.
Die drei Frauen lebten von dem Ertrag des Gutes, das er bewirtschaftete. Fiel die Ernte schlecht aus, so sagte Fräulein Esther, wenn die Zeit herankam, wo sie ihm seinen Lohn – dreißig Silbergulden und ein Paar Stiefel – geben sollte, zu dem Knecht:
»Gedulde dich in Gottes Namen noch ein Weilchen; du sollst nicht um das Deinige kommen.«
Und er geduldete sich, und sein Guthaben wuchs von Jahr zu Jahr, so daß Fräulein Esther halb im Scherz, halb im Ernst versprach, ihn als Alleinerben des Gutes und Hauses einzusetzen, obgleich er viel älter war als sie alle.
Gewiß, er war alt und gebrechlich, aber immerhin ein Mann, und sein Schatten lieh den drei Frauen noch genügenden Schutz.
Und jetzt träumte er von einer glücklicheren Zukunft für die drei. Träumte zum mindesten davon, daß Noemi einen Gatten fände. Wenn der gelbe Brief nun eine gute Nachricht enthielte? Wenn er eine Erbschaft ankündigte? Oder wenn es gar ein Heiratsantrag für Fräulein Noemi wäre? Die Damen Pintor hatten ja noch reiche Verwandte in Sassari und Nuoro. Weshalb sollte nicht einer von ihnen Noemi heiraten? Sogar Don Predu konnte den gelben Brief geschrieben haben.
Und mit einemmal wechseln im müden Geist des Knechtes die Dinge das Gesicht; alles ist nun in ein helles, sanftes Licht getaucht; seine adligen Herrinnen werden noch einmal jung; ihr sterbendes Geschlecht erstarkt zu neuem Leben, und alles ringsum sprießt und blüht wie das Tal im Frühling.
Und ihm, dem armen Knecht, bleibt nun nichts anderes übrig, als sich auf seine alten Tage auf das kleine Gut zurückzuziehen, seinen Strohsack auszubreiten und im Herrn zu entschlafen, während im Schweigen der Nacht das Schilfrohr mit eintönigem Rauschen das Land in den Schlummer wiegt.
II.
Im Morgengrauen machte er sich auf den Weg und ließ den jungen Burschen zur Bewachung des Gutes zurück.
Die Straße führte bis zum Dorf ständig bergauf, und er wanderte langsam auf ihr dahin, weil er im vorigen Jahr das Sumpffieber gehabt und eine große Schwäche in den Beinen zurückbehalten hatte. Hin und wieder blieb er stehen und blickte auf das Gut zurück, das leuchtendgrün zwischen den beiden Feigenhecken ruhte; und die Hütte dort oben, die schwarz zwischen dem Blaugrün des Schilfrohrs und dem Weiß des Felsgesteins nistete, erschien ihm wie ein Nest – ein wirkliches Vogelnest. Jedesmal, wenn er fortging, betrachtete er sie so, halb zärtlich und halb traurig, ganz wie ein Vogel, der in die Ferne zieht. Ihm war fast, als ließe er dort sein besseres Ich zurück, die Kraft, welche die Einsamkeit, die Abgeschiedenheit von der Welt verleiht; und während er die Straße emporstieg, durch die blühende Heide, vorbei an den Binsen und dem niedrigen Erlengestrüpp am Fluß, kam er sich wie ein Pilger vor, der mit einem kleinen härenen Sacke auf der Schulter und einem Holunderstabe in der Hand auf einen Ort der Buße zustrebt: die Welt.
Doch des Herrn Wille geschehe immerdar! Und plötzlich öffnete sich das Tal vor seinen Blicken, und wie auf einem gewaltigen Schutthaufen taucht auf der Kuppe eines Hügels die alte Schloßruine auf. Aus einem schwarzen Gemäuer blickt ein blaues, leeres Fenster wie das Auge der Vergangenheit auf die schwermütige, rötlich im Schein der aufgehenden Sonne erglühende Landschaft herab, auf die sanft gewellte, grau und gelb gefleckte Ebene, auf das silbergrüne Band des Flusses, auf die weißen Dörfchen, die langgeschwungenen Höhen und die blaugoldene Wolke der Nuoreser Berge in der Ferne.
Klein und schwarz schreitet Efix in die strahlende Helle hinein. Die schrägen Sonnenstrahlen fluten leuchtend über das Land; jede Binse trägt ein Silbergespinst, aus jedem Wolfsmilchgebüsch steigt ein Vogelruf; und dort winkt auch schon der grün und weiß gescheckte, von Schatten und Sonnenstreifen durchfurchte Kegel des Galteberges, und an seinem Fuße ruht das kleine Dorf, das nur aus Schutt und Trümmern zu bestehen scheint: aus den Resten der alten Römerstadt.
Lange geborstene Mauern, eingestürzte Häuser ohne Dach, zerfallene Höfe und verwilderte Gärten, noch ziemlich gut erhaltene Hütten, die aber fast noch trauriger anmuten als all die Trümmer, säumen die steilen, in der Mitte mit mächtigen Sandsteinquadern gepflasterten Straßen ein; Lavabrocken liegen umher und erwecken den Anschein, daß ein Erdbeben die alte Stadt zerstört und die Bewohner in alle Winde zerstreut habe; da und dort taucht auch ein neues Haus fast schüchtern in der trostlosen Öde auf, und Granatapfel- und Johannisbrotbäume, etliche Feigensträucher und Palmen verleihen der traurigen Stätte ein freundlicheres Gepräge.
Aber je höher Efix stieg, desto öder und verlassener wurde es um ihn her, und zu allem Überfluß ragten dort am Straßenrand, im Schatten des Berges, zwischen dichtem Brombeer- und Wolfsmilchgestrüpp, auch noch die Überreste eines alten Kirchhofs und die zerfallene Basilika düster in den Himmel. Die Straßen waren wie ausgestorben, und die Felsen auf der Bergkuppe schimmerten wie Leichensteine ins Land.
Efix machte vor einem großen, an den alten Friedhof grenzenden Tor halt. Die beiden Tore waren fast gleich; drei verwitterte, grasüberwucherte Stufen führten zu ihnen empor. Aber während das Tor des alten Kirchhofs nur von wurmstichigem Gebälk überdacht war, wölbte sich über dem der Damen Pintor ein steinerner Rundbogen, und auf dem Pfeiler war ein verblaßtes Wappen angedeutet: ein Ritterkopf mit einem Helm und ein mit einem Schwert gewappneter Arm. Darunter stand als Wahlspruch: Quis resistit hujas?
Efix schritt durch den weiten, viereckigen Hof, durch den sich ein breiter, wie das Straßenpflaster aus Sandsteinquadern zusammengefügter Rinnstein zog, nahm den Sack von den Schultern und blickte um sich, ob nicht eine seiner Herrinnen zu sehen sei. Das einstöckige Haus erhob sich am Ende des Hofes, im Schutz des Berges, der wie eine riesige, weiß und grün gescheckte Haube auf ihm zu ruhen schien.
Drei kleine Türen gähnten unter einer Holzveranda, die um das ganze Haus lief und zu der außen eine morsche Stiege emporführte. Ein schwärzliches Seil, das um die in der untersten und obersten Stufe eingerammten Nägel geknotet war, ersetzte das abgebrochene Geländer. Die Türen, die Stützen und das Geländer der Veranda waren zierlich geschnitzt, aber alles drohte einzustürzen, und es sah aus, als wenn das schwarzverwitterte, wurmstichige Holz beim geringsten Lufthauch zu Staub zerfallen müßte.
Eine kleine, beleibte, schwarzgekleidete Frau, die ein weißes Tuch um das dunkle, eckige Gesicht trug, trat auf die Veranda; sie beugte sich über das Geländer, erblickte den Knecht, und ihre schwarzen, mandelförmigen Augen leuchteten freudig auf.
»Ah – Fräulein Ruth! Guten Morgen, Herrin!«
Hurtig kam Fräulein Ruth die Treppe herab, mit dicken Beinen, die in dunkelblauen Strümpfen steckten. Sie lächelte ihn freundlich an und ließ die schneeweißen Zähne unter der von einem zarten Flaum beschatteten Lippe sehen.
»Und Fräulein Esther? Und Fräulein Noemi?«
»Esther ist zur Messe gegangen, Noemi steht eben auf. Herrliches Wetter, Efix! And wie steht es mit dem Gut?«
»Gut, gut – Gott sei Dank, sehr gut.«
Auch die Küche hatte einen mittelalterlichen Einschlag: groß, niedrig, mit einer rußgeschwärzten Balkendecke. Zu beiden Seiten des gewaltigen Herdes lief eine geschnitzte Holzbank an der Wand entlang; durch das Gitter des Fensters sah die grüne Berglehne herein. An den kahlen, rötlichgrauen Wänden waren noch die Spuren der nach und nach verschwundenen Kupferpfannen zu bemerken; und die verrosteten Nägel, an denen einst die Sättel, Harnische und Waffen hingen, waren wie zur Erinnerung dort geblieben.
»Nun, Fräulein Ruth?« fragte Efix, während die Herrin einen kleinen kupfernen Kaffeekessel auf das Feuer setzte. Aber sie wandte ihm nur das breite, dunkle, weißumrahmte Gesicht zu und bedeutete ihn durch ein Blinzeln, sich noch eine Weile zu gedulden.
»Hol mir doch einen Eimer Wasser, bis Noemi herunterkommt!«
Efix holte den Eimer unter der Bank hervor, ging auf die Tür zu, schaute sich aber auf der Schwelle noch einmal scheu und fragend um und betrachtete sinnend den schwankenden Eimer.
»Der Brief war wohl von Don Giacinto?«
»Der Brief? Es ist ein Telegramm ...«
»Barmherziger Gott! Es ist ihm doch nichts zugestoßen?«
»Nein, gar nichts. Geh jetzt ...«
Es war zwecklos, weitere Fragen zu stellen, bevor Fräulein Noemi herunterkam; denn obwohl Fräulein Ruth die älteste der drei Schwestern war und die Hausschlüssel verwahrte – viel zu verwahren gab es allerdings nicht mehr –, tat sie doch nie etwas aus freien Stücken und wies jede Verantwortung von sich.
Er ging auf den Brunnen zu, der wie ein riesiges, in einem Winkel des Hofes aufgeworfenes Hünengrab aussah und eingefaßt war von mächtigen Sandsteinblöcken, auf denen in alten zerbrochenen Töpfen Goldlack und Jasmin blühten. Ein Jasminzweig rankte sich an der Mauer empor und lugte über sie hinweg, wie um zu sehen, was es dort draußen gäbe in der Welt.
Wie viele Erinnerungen weckte dieser düstere, moosbewachsene Winkel mit dem hellen Braun des Goldlacks und dem zarten Grün des Jasmins im Herzen des Knechts!
Er glaubte Fräulein Lia wieder bleich und schmal wie eine Binse auf der Veranda stehen zu sehen, die Augen starr in die Ferne gerichtet, als wollte auch sie ergründen, was es dort draußen gäbe in der Welt. Genau so hatte er sie auch am Tage der Flucht dort oben stehen sehen, unbeweglich gleich einem Fährmann, der in die geheimnisvollen Tiefen des Wassers späht ...
Wie schwer diese Erinnerungen sind! Schwer wie der volle Wassereimer, der in die Tiefe zieht, in den schwarzen Brunnenschacht hinab.
Doch als Efix nun wieder aufblickte, sah er, daß die große, schlanke Frauengestalt, die leichten Schritts auf den Balkon trat und die Ärmelbündchen ihres schwarzen, fein gefältelten Mieders zuhakte, nicht Lia war.
»Ah – Fräulein Noemi! Guten Tag, Herrin! Kommen Sie nicht herunter?«
Mit schwarzem, golden schimmerndem Haar, das sich in zwei breiten Flechten um ihr blasses Gesicht schmiegte, beugte sie sich über das Geländer, dankte ihm mit einem flüchtigen Blick aus ihren schwarzen, gleichfalls golden unter den langen Wimpern schimmernden Augen für seinen Gruß, sprach aber kein Wort und kam auch nicht herunter.
Sie öffnete Türen und Fenster – heute war ja keine Gefahr, daß ein Windstoß sie zuschlage und die Scheiben zertrümmere, die übrigens schon seit vielen Jahren fehlten – und breitete sorgsam eine gelbe Decke in die Sonne.
»Kommen Sie nicht herunter, Fräulein Noemi?« wiederholte Efix, der noch immer zu ihr emporsah.
»Doch, doch, gleich ...«
Aber wieder strich sie sorgsam die Decke glatt und schien versonnen auf die Landschaft zur Rechten und zur Linken zu blicken, die in wehmütiger Schönheit vor ihr ausgebreitet lag: auf die weite Sandebene, durchbrochen vom glitzernden Band des Flusses, von Pappelreihen, von niedrigen Erlen und Schilf- und Wolfsmilchflächen, auf die düstere Basilika inmitten des Brombeergestrüpps, auf den alten Kirchhof, wo zwischen dem hellen Grün des wuchernden Grases wie weiße Margueriten die Gebeine der Toten schimmerten, und auf die trotzige Burgruine auf dem Hügel in der Ferne.
Noch immer lagerte die Vergangenheit düster über der Gegend. Aber Noemi ließ sich dadurch nicht traurig stimmen; seit frühester Kindheit war sie daran gewöhnt, dort drüben die Gebeine der Toten bleichen zu sehen, die im Winter zu frieren schienen in der fahlen Sonne und auf denen im Frühjahr der Tau blinkte. Niemand dachte daran, sie fortzuschaffen; weshalb also hätte sie daran denken sollen?
Fräulein Esther aber, die langsam und in sich gekehrt aus der neuen Kirche im Dorf zurückkommt, bekreuzt sich, als sie zu dem alten Friedhof gelangt, und spricht ein Gebet für die toten Seelen.
Esther vergißt niemals etwas und hat ein Auge für alles. Und so bemerkt sie, als sie nun den Hof betritt, daß irgend jemand Wasser geschöpft hat aus dem Brunnen, und stellt den Eimer an seinen Platz; dann entfernt sie ein Steinchen aus dem Goldlacktopf, geht in die Küche, begrüßt Efix und fragt ihn, ob er schon seinen Kaffee bekommen habe.
»Ja, ja – schon lange, Herrin.«
Inzwischen war auch Noemi mit dem Telegramm in der Hand heruntergekommen. Aber sie entschloß sich nicht, es vorzulesen; es bereitete ihr fast ein heimliches Vergnügen, die bange Neugier des Knechts auf die Folter zu spannen.
»Esther«, sagte sie und setzte sich auf die Bank neben dem Herd, »warum legst du dein Tuch nicht ab?«
»Heute vormittag ist Messe in der Basilika, ich gehe gleich wieder. So lies doch vor!«
Auch Esther setzte sich auf die Bank, und Fräulein Ruth folgte ihrem Beispiel. Und wenn die drei Schwestern so nebeneinandersaßen, sahen sie sich seltsam ähnlich; nur daß sie eben drei verschiedene Lebensalter verkörperten: Noemi die Jugend, Esther die Reife und Ruth das Alter – ein rüstiges, von heiterer Ruhe verklärtes Alter.
Der Knecht war vor sie hingetreten und wartete; aber nachdem Fräulein Noemi das gelbe Papier auseinandergefaltet hatte, betrachtete sie es starr, als wenn sie die Worte darauf nicht entziffern könnte, und schüttelte es schließlich ärgerlich in der Hand.
»Nun, er telegraphiert, daß er in wenigen Tagen hier sein wird. Das ist alles.«
Sie erhob die Augen und errötete, als ihr strenger Blick auf Efix' Gesicht fiel; auch die beiden anderen schauten ihn an.
»Verstehst du? Ganz so, als wenn er hier zu Hause wäre.«
»Was sagst du dazu?« fragte Fräulein Esther, mit einem Finger durch den Spalt des Tuches zeigend.
Efix leuchtete über das ganze Gesicht; die vielen kleinen Fältchen um seine lebhaft blitzenden Augen sahen wie Strahlen aus, und er versuchte seine Freude nicht zu verbergen.
»Ich bin zwar nur ein armer Knecht, aber ich sage mir, der Himmel weiß schon, was er tut.«
»Gottlob, endlich einmal ein vernünftiges Wort«, sagte Fräulein Esther.
Noemi aber war wieder totenbleich geworden. Entrüstete Worte drängten über ihre Lippen, und obgleich sie sich wie immer vor dem Knecht zu beherrschen verstand – sie gab übrigens nicht viel auf seine Meinung –, erwiderte sie doch:
»Damit hat doch der Himmel nichts zu tun, und darum handelt es sich ja auch nicht. Es handelt sich«, setzte sie nach kurzem Zögern hinzu, »ja, es handelt sich darum, ihm kurz und bündig zu antworten, daß in unserem Haus kein Platz für ihn ist.«
Da breitete Efix die Arme aus und beugte ein wenig den Kopf zurück, als wollte er sagen: Nun, weshalb fragt ihr mich dann um Rat?
Esther aber lachte scharf auf, erhob sich und schlug zornig die schwarzen Zipfel ihres Tuches zurück. »Und zu wem soll er dann gehen? Vielleicht zum Herrn Pfarrer, wie die Fremden, die kein Obdach finden?«
»Ich würde ihm eher überhaupt nicht antworten«, schlug Fräulein Ruth vor und nahm Noemi das Telegramm aus der Hand, das diese unruhig immer wieder auf- und zufaltete. »Kommt er trotzdem, so ist's gut. Dann können wir ihn wie jeden Fremden aufnehmen. Tritt ein, bring Glück herein!« setzte sie hinzu, als wenn sie einen in die Tür tretenden Gast begrüßen wollte. »Und wenn er nicht gut tut, ist es noch immer Zeit, ein Wort zu sagen.«
Aber Esther sah lächelnd ihre Schwester an, die die schüchternste und unentschlossenste von allen dreien war, neigte sich auf sie zu und legte die Hand auf ihre Knie: »Ihn fortzujagen, meinst du wohl? Ausgezeichnet, liebe Schwester! Und wirst du das Herz dazu haben, Ruth?«
Efix überlegte. Plötzlich hob er den Kopf und legte die Hand beteuernd an die Brust.
»Dafür werde ich schon sorgen«, versprach er feierlich.
Da begegneten seine Augen denen Noemis, und er, der stets Angst hatte vor diesen hellen, kalten, abgrundtiefen Augen, begriff, daß die junge Herrin sein Versprechen ernst nahm.
Doch er bereute es nicht. Er hatte ja schon ganz andere Verantwortungen auf sich genommen in seinem Leben.
Er blieb den ganzen Tag im Dorf.
Zwar war er unruhig wegen des Gutes – obwohl es in dieser Jahreszeit dort wenig zu stehlen gab –, aber ihm schien, daß ein heimlicher Zwiespalt seine Herrinnen bekümmerte, und er gedachte nicht aufzubrechen, bevor er sie nicht einig sah.
Fräulein Esther räumte in der Küche auf und ging dann wieder fort, um sich in die Basilika zu begeben. Efix versprach, bald nachzukommen; aber als Fräulein Noemi nach oben ging, trat er wieder in die Küche und bat Fräulein Ruth, die auf dem Boden kniete und etwas Teig auf einem niedrigen Schemel knetete, leise um das Telegramm. Sie hob den Kopf und schob mit der mehlbestäubten Faust das Tuch aus der Stirn.
»Hast du gehört?« spielte sie leise auf Noemi an. »Sie bleibt stets die alte! Der Stolz beherrscht sie ...«
»Richtig«, bekräftigte Efix sinnend. »Wer adligen Geblütes ist, der bleibt es auch, Fräulein Ruth. Sie finden eine alte Münze auf dem Boden, glauben zunächst, sie sei aus Eisen, weil sie ganz schwarz angelaufen ist; doch reiben Sie sie dann blank, so sehen Sie, daß sie aus lauterem Gold ist ... Gold bleibt Gold ...«
Ruth erkannte, daß sie Noemis verwerflichen Stolz nicht zu entschuldigen brauchte vor Efix, und da sie sich stets willig der Meinung der anderen anschloß, heiterte sich ihr Gesicht wieder auf.
»Weißt du noch, wie stolz mein Vater war?« sagte sie und wühlte die roten, blaugeäderten Hände wieder in den blassen Teig. »Er sprach genau so. Er hätte Giacinto sicher nicht einmal erlaubt, an Land zu gehen. Was meinst du, Efix?«
»Ich? Nun, ich bin zwar nur ein armer Knecht, aber ich meine, Don Giacinto wäre trotzdem an Land gegangen.«
»Du meinst, er ist der Sohn seiner Mutter«, seufzte Ruth, und auch der Knecht seufzte leise. Immer und immer wieder umhüllte sie der Schatten der Vergangenheit.
Aber der Alte machte eine abwehrende Geste, wie um diesen Schatten zu verscheuchen, und während er mit aufmerksamen Augen die Bewegungen der roten Hände verfolgte, die den weißen Teig walkten, kneteten und schlugen, fuhr er ruhig fort:
»Er ist ein guter Junge, und der Himmel wird ihm helfen. Aber man muß darauf achten, daß er sich nicht das Sumpffieber holt. Ferner sollte man ein Pferd für ihn kaufen, weil die Leute dort – auf dem Festland nicht gewohnt sind, zu Fuß zu gehen. Aber das laßt meine Sorge sein. Das Wichtigste ist, daß die Herrinnen untereinander einig sind.«
»Und sind wir das nicht? Hast du uns vielleicht streiten hören? Willst du jetzt nicht lieber zur Messe gehen, Efix?«
Da begriff er, daß sie ihn verabschiedete, und ging in den Hof. Aber er blickte um sich, ob er nicht auch noch gleich mit Fräulein Noemi sprechen könnte. Ah – dort steht sie ja auf der Veranda und holt gerade die Decke herein. Sie herunterzubitten, ist wohl zwecklos; nein, er muß schon selbst zu ihr hinaufgehen.
»Fräulein Noemi, dürfte ich Sie etwas fragen? Freuen Sie sich eigentlich?«
Erstaunt, mit der Decke unterm Arm, sah Noemi ihn an.
»Über was denn?«
»Nun, daß Don Giacinto kommt. Sie werden sehen, er ist ein guter Junge.«
»So? Wo hast du ihn denn kennengelernt?«
»Das sieht man doch schon aus seinen Briefen. Er wird es bestimmt zu etwas bringen. Man muß ihm ein Pferd kaufen ...«
»Und auch die Sporen dazu, natürlich ...«
»Hauptsache ist, daß die Herrinnen untereinander einig sind. Ja, das ist das Wichtigste.«
Sie zupfte ein Fäserchen von der Decke und warf es in den Hof; ihr Gesicht hatte sich verdüstert.
»Wann sind wir schon einmal nicht einig gewesen? Ich denke, bisher doch immer.«
»Ja – aber – mir scheint, Sie freuen sich nicht über die Ankunft Don Giacintos.«
»Soll ich vielleicht einen Freudengesang anstimmen? Er ist doch kein Messias«, sagte sie und verschwand in der Tür, durch die man in ein helles Zimmer sah, mit einem alten Bett, einem alten Kleiderspind und einem scheibenlosen Fensterchen, das auf die grüne Berglehne ging.
Efix stieg die Treppe hinunter, pflückte eine kleine rötliche Goldlackblüte, hielt sie zwischen den auf dem Rücken verschränkten Händen und ging so nach der Basilika.
Die Stille und Kühle des ragenden Berges lagerte über allen Dingen. Nur das Gezwitscher der Drosseln in den Brombeersträuchern belebte die Gegend und mischte sich mit dem eintönigen Beten der Frauen in der Kirche. Auf den Zehenspitzen, mit der Goldlackblüte in der Hand, trat Efix ein und kniete hinter der Kanzelsäule nieder.