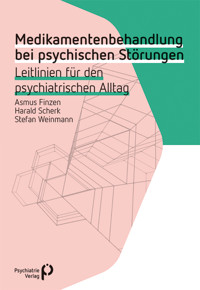Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychiatrie Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fachwissen
- Sprache: Deutsch
Der Klassiker Asmus Finzens Buch zur Schizophrenie ist die Essenz seiner Erfahrungen aus fünf Jahrzehnten der Arbeit und des Lebens mit psychosekranken Menschen. Es richtet sich an die Erkrankten, ihre Angehörigen und Freunde sowie an all jene, die beruflich mit psychisch kranken Menschen zu tun haben. Seine größten Stärken sind die klare Sprache und die Verständlichkeit. Von den ersten Symptomen bis zu den Behandlungs- und Bewältigungsmöglichkeiten – Finzen vermittelt die wichtigsten Informationen zur Schizophrenie unter Berücksichtigung sozialer, psychologischer und biologischer Aspekte. Wie Betroffene und Angehörige eine Schizophrenie erleben, wird in vielen Beispielen deutlich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Asmus Finzen, Jahrgang 1940, Professor der Psychiatrie, engagiert sich seit mehr als vier Jahrzehnten für Menschen, die an schizophrenen Psychosen erkranken. Als Klinikleiter war er sowohl in Deutschland (Wunstorf) als auch stellvertretend in der Schweiz (Basel) tätig. Seine zahlreichen Veröffentlichungen in Fach- und Tagespresse fanden ein breites Echo. Seit seiner Emeritierung setzt er sich verstärkt für Patientenrechte, für gleichberechtigte Patient-Therapeut-Beziehungen sowie gegen Vorurteile, Diskriminierung und Stigmatisierung psychisch Kranker ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.finzen.de.
Asmus Finzen
Schizophrenie
Die Krankheit verstehen, behandeln, bewältigen
Asmus Finzen
Schizophrenie
Die Krankheit verstehen, behandeln, bewältigen
3., korrigierte Auflage 2020
ISBN-Print: 978-3-96605-046-3
ISBN-E-Book: 978-3-96605-067-8
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Weitere Bücher zum Umgang mit psychischen Störungen unter: www.psychiatrie-verlag.de
© Psychiatrie Verlag GmbH, Köln 2011, 2013, 2020
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne Zustimmung
des Verlags vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
Lektorat: Uwe Britten, Eisenach
Umschlaggestaltung: GRAFIKSCHMITZ, Köln
unter Verwendung eines Fotos von skyla80/photocase.de
Typografiekonzeption: Iga Bielejec, Nierstein
Satz: Psychiatrie Verlag, Köln
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2019
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Vorwort
Eine Geschichte
Kindheit und Schulzeit
Rückzug und erste Krise
Erleichterung und Ratlosigkeit
Ausbruch und Zusammenbruch
Das Leben danach
Die Krankheit
Das zentrale schizophrene Syndrom
Schizophrenie als Metapher
Die zweite Krankheit
Die schizophrene Erkrankung: eine Katastrophe für die ganze Familie
Stigma und Schuldzuweisung
Die Identität der Eltern und die Rolle der Kinder
Die Familienkatastrophe »Schizophrenie«
Das Leid der Kinder
Wenn Eltern psychisch erkranken
Schweigen und Schuldgefühl
Wie kann Hilfe aussehen?
Niemand hat Schuld
Was haben wir falsch gemacht?
Unbekannte Ursachen – erhöhte Verletzlichkeit
Entwicklungskrisen sind unvermeidbar
Was können wir tun?
Jenseits der Schuld: Verantwortung
Im Vorfeld der Psychose: Frühintervention – Vorstellungen und Wirklichkeit
Unspezifische Symptome
Ratlosigkeit und Unverständnis
Überempfindlichkeit und Verletzlichkeit
Bewältigungsversuche im Vorfeld
Das Dilemma der Frühintervention
Wenn die Krankheit »ausbricht«: Symptome und Zeichen
Symptome – die Systematik Bleulers
Die »zusätzlichen« Symptome
Was nicht gestört ist: die »intakten Funktionen«
Die Krankheit erhält ihren Namen – die Diagnose und was sie bedeutet
Blinde Flecken und Verdrängung
Diagnosekriterien
Engagement, Wissen und Erfahrung
Der Name der Krankheit
Der lange Weg des Leidens: Verlauf und Prognose
Psychosen bei Kindern und Jugendlichen
Krankheitsphasen
Die beginnende Schizophrenie
»Offenbarung« und »Ausbruch«
Die aktive Phase
Die Konsolidierung
Verlauf und Prognose
Erleben und Miterleben
»Die Gedanken werden handgreiflich« – Erfahrungsberichte
Menschen in der Psychose zuhören
Ursachen und Anlässe I: soziale und psychologische Aspekte
Psychische Erkrankung als Verhaltensstörung
Labeling: die Etikettierungstheorie
Soziale Schicht und psychische Krankheit
»Life-Events«: die Rolle lebensverändernder Ereignisse
Schizophrenie und Familie
Psychologische und psychodynamische Aspekte
Ursachen und Anlässe II: biologische Aspekte und Vulnerabilität
Veränderungen der Gehirnstruktur
Störungen der Gehirnentwicklung
Biochemie und Neurobiologie
Genetische Aspekte
Vulnerabilität: Die Ursachen sind nicht bekannt
Behandlungsgrundsätze
Wege der Behandlung
Behandlung individualisieren
Wider das Verzagen: die Haltung der Angehörigen
Über Behandlung verhandeln
Die akute Psychose
Medikamentenbehandlung bei akuten Krisen
Zuwendung
Frühes Einbeziehen der Kranken – vertrauensvolle Beziehungen entwickeln
Zeit und Geduld
Die Erfahrung der Krise
Psychoinformation und Psychoedukation
Psychotherapie
Milieutherapie
Die Zeit der Krise – die Angehörigen
Wenn es losgeht
Und immer wieder: die Frage nach der Schuld
Angehörige brauchen Verständnis
Angehörige brauchen Informationen
Zukunftsperspektiven
Der steinige Weg zur Wiederherstellung
Anfängliche Schwierigkeiten
Regression und Aktivierung
Kontinuierlich Geduld zeigen
»Woodshedding«
Zeit für Psychotherapie
Rückfallvermeidung und Wiedererkrankung – eine Herausforderung
Prophylaxe von Anfang an
Vorbehalte gegen Medikamente
Anzeichen eines Rückfalls
Wiederaufnahme der Neuroleptikatherapie
Diätetik des Lebens
Langfristige Strategien
Selbsthilfe
Familienklima und Rückfallrisiko
Wenn die Krankheit andauert – »Therapieresistenz«
Fortbestehen »produktiver« Symptome
Fortbestehen negativer Symptome
Fehlende Kooperation
Mangelnde »Krankheitseinsicht«
Störungen des Handelns und Wollens
Der »Drehtüreffekt«
Doppelerkrankung Psychose und Abhängigkeit
Was lässt sich tun?
Rehabilitation und psychosoziale Hilfen
Grundlagen der Rehabilitation bei psychischen Störungen
Berufliche Rehabilitation – was ist zu tun?
Psychosoziale Rehabilitation
Hilfen im Alltag
Risiken: Suizidalität, Gewalt, Verweigerung und Zwang
Suizid und Suizidgefährdung
Gewalt
Wenn Kranke Medikamente ablehnen
Zwangsbehandlung
Mit den Kranken leben
Akzeptieren, was ist
Auf sich achten
Angehörigenselbsthilfe
Das Zusammenleben verändert alle Beteiligten
Angehörige als Experten
Nachwort: Was mir zu sagen noch wichtig ist
Literatur
Internet-Adressen
Stichwortverzeichnis
Vorwort
»Wenn Sie nicht wissen, was Schizophrenie ist, seien Sie froh.«
Motto einer britischen Angehörigenvereinigung
»Dem Schizophrenen bleibt das Gesunde erhalten.«
Eugen Bleuler
Die Schizophrenie ist die schillerndste aller psychischen Störungen. Sie kann leicht sein oder schwer. Sie kann akut und dramatisch verlaufen oder schleichend und für Außenstehende kaum wahrnehmbar. Sie kann kurze Zeit andauern oder ein ganzes Leben. Sie kann einmalig auftreten. Sie kann in längeren oder kürzeren Abständen wiederkehren. Sie kann ausheilen oder zu Invalidität führen. Sie trifft Jugendliche im Prozess des Erwachsenwerdens oder in der beruflichen Entwicklung. Sie trifft Frauen und Männer, die mitten im Leben stehen, und solche an der Schwelle des Alters.
Weil die Schizophrenien, die Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis, so vielfältig in ihren Erscheinungsformen sind, sind sie auch für mit der Krankheit Vertraute oft nur schwer greifbar. Unerfahrene – das sind auch Kranke am Beginn ihres Leidens, Angehörige, Freunde und junge Berufskollegen sowie die breite Öffentlichkeit – stehen der Krankheit eher ratlos und sogar (ver)zweifelnd gegenüber. Wo viel Unklarheit besteht, müssen Vorurteile Platz greifen. Diese versteigen sich vom Mythos der Unheilbarkeit bis zur Unterstellung, die Schizophrenie gebe es gar nicht. Sie sei eine Erfindung der Psychiater, »ein von Eugen Bleuler erfundenes Wort«, wie Thomas Szasz 1976 schrieb. Leider trifft das nicht zu. Bleuler hat zwar das Wort »erfunden«, aber nicht das Leiden, für das es steht. Er hoffte, damit der Stigmatisierung der Kranken durch die von Kraepelin geprägte Bezeichnung »Dementia Praecox« entgegenzuwirken. Leider ist das, wie wir heute wissen, gründlich misslungen (vgl. S. 89).
Doch bei alldem gilt: Psychische Krankheiten sind behandelbar, auch die Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis, schizophreniforme, schizotype und wahnhafte Störungen. Die größten Hindernisse für eine erfolgreiche Therapie sind nicht die begrenzten Möglichkeiten der Medizin und der Psychotherapie: Oft dauert es (zu) lange, bis psychotisches Erleben und Verhalten als Krankheit erkannt wird. Ebenso oft finden die Betroffenen erst spät angemessene Hilfe. Schließlich erweisen sich Vorurteile und Stigmatisierung als Behandlungshindernisse ersten Ranges. Alles dies macht es schwer, angemessen mit der Krankheit umzugehen – und, wenn sie anhält, mit ihr zu leben.
»If you don’t know Schizophrenia, you’re lucky«, mahnt die englische National Schizophrenia Fellowship; und in Österreich wird die Frage gestellt: »Gehören Sie auch zu den 80 Prozent der Österreicher, die nicht wissen wollen, was Schizophrenie ist?«
Dieses Buch wendet sich an alle, die das wissen sollten: die Kranken, ihre Angehörigen und Freunde, ihre Nachbarn und Kollegen; an alle, die beruflich mit psychisch Kranken zu tun haben; an Verantwortliche im Gemeinwesen und in der Politik – und schließlich an eine aufgeklärte Öffentlichkeit. Es will helfen, Wege zu suchen, die Krankheit, wo immer möglich, zu überwinden oder, wenn das nicht möglich ist, ihre Auswirkungen zu begrenzen, und wenn es sein muss, mit ihr zu leben. Es will die Kranken und ihre Angehörigen ermutigen, Hilfe zu suchen und Geduld und Hoffnung zu bewahren. Es appelliert an die Behandelnden, nicht vorschnell vor der Krankheit und ihren Folgen zu kapitulieren. Es setzt auf das Zusammenwirken von Kranken, Angehörigen und Behandelnden, auf den »Trialog« zwischen den Beteiligten, aber auch auf die Unterstützung durch die Gemeinschaft der Gesunden, der nicht Betroffenen.
Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis gehören zu den wenigen Krankheiten, bei denen die Diagnose wenig über die Prognose, über den Krankheitsausgang aussagt. Eine Besserung, ja eine weitgehende Wiederherstellung ist auch nach Jahren möglich, selbst wenn der Verlauf sich zunächst ungünstig anlässt. Das verlangt von allen Beteiligten nicht nur einen langen Atem. Es erfordert auch langfristige Behandlungsstrategien: Beharrlichkeit, Geduld, die Bereitschaft zu Neuanfängen und die Gewährleistung einer langfristigen Kontinuität der Behandlung. Bereits die erste psychotische Krise ist ein so dramatisches Geschehen, dass es nicht nur um Behandlung geht, sondern zugleich um die Bewältigung der Erkrankung, um das Leben mit der Krankheit und ihren Auswirkungen. Das geht aber nur, wenn Angehörige und Betroffene von Anfang an einbezogen werden. Und wenn sie dabei die Hilfe erfahren, die sie benötigen. Diese Grundüberzeugung ist der Leitgedanke meiner Überlegungen.
Ich leite dieses Buch mit der authentischen Lebens- und Krankheitsgeschichte eines jungen Mannes ein, mit dem ich zusammen aufgewachsen bin – und mit dem ich verwandt bin. Anschließend versuche ich dann die zentrale Symptomatik schizophrener Psychosen und ihre sozialen Folgen zu beschreiben. Ich versuche zu zeigen, was es für eine Familie bedeutet, wenn eines ihrer Mitglieder krank wird. Ich stelle klar, dass niemand daran schuld ist. Ich befasse mich mit den Geschehnissen im Vorfeld der Psychose. Erst danach wende ich mich den medizinischen Abläufen und der Therapie zu: Diagnose, Frühintervention, Akutbehandlung, Wiederherstellung, Wiedererkrankung, Rehabilitation – und schließlich der Frage, was zu tun ist, wenn die Krankheit andauert.
Schon von Anfang an bedeutet die Erkrankung, dass man lernen muss, »mit ihr zu leben«, ihre Auswirkungen zu bewältigen, und zwar auch für Partner und Angehörige. In allen Darstellungen des Krankheitsverlaufs versuche ich ihre Situation einzubringen, ihren Umgang und ihre Auseinandersetzungen mit der Krankheit sowie deren Folgen für ihr eigenes Leben. Ich frage, was man tun kann, wenn scheinbar nichts mehr geht. Ich zeige, wie wichtig es für die Mitbetroffenen ist, auf sich und ihre Kräfte zu achten.
Dies ist in einem gewissen Sinn ein persönliches Buch geworden. Es vermittelt die Essenz meiner Erfahrungen aus fünf Jahrzehnten der Arbeit und des Lebens mit psychosekranken Menschen. Und es ist, zugegeben, lang geworden. Aber es muss nicht von Anfang bis Ende gelesen werden, jeder kann sich die Abschnitte heraussuchen, die ihn besonders interessieren und die er für hilfreich hält.
Asmus Finzen
Berlin, im Herbst 2019
Eine Geschichte
»Vor dem Ausbruch der Psychose findet man meist Änderungen im gewohnten Wesen. Die späteren Kranken werden empfindsamer und zurückgezogener, geben persönliche Beziehungen und Interessen auf.«
Manfred Bleuler
Patienten sind Menschen. Die Krankheit ist Teil ihrer Biografie. Aber sie sind nicht nur Kranke. Sie haben ein Leben jenseits der Krankheit – davor, danach, daneben. Das ist eine Binsenweisheit, dennoch tun gerade psychiatrisch Tätige gelegentlich gut daran, sich das in Erinnerung zu rufen, begegnen wir ihnen doch in der besonderen Situation ihrer Erkrankung in aller Regel zum ersten Mal. In gesunden Tagen haben wir sie nicht gekannt.
Wir fragen dann im sogenannten Anamnesegespräch nach dem Vorleben. Aber wir tun das unter dem Blickwinkel der besonderen Patient-Therapeut-Beziehung. So wird das Vorleben zur Kankheitsvorgeschichte, eben zur Anamnese. Über das frühere – das gesunde, das normale – Leben erhalten wir nur indirekte Informationen, sei es von den Kranken selbst, sei es von ihren Angehörigen oder von Dritten.
Auch bei der Entstehung der Krankheit waren wir nicht dabei. Das Bild, das wir uns davon machen, entbehrt des eigenen Augenscheins. Das gilt nicht nur für den Einzelfall. Das Bild der Psychiatrie von der beginnenden Psychose beruht in erster Linie auf Erzählungen und nicht auf Beobachtungen. Ob es nun durch gezielte Befragung, durch Exploration, zustande kommt oder ob es sich im Laufe einer Psychotherapie allmählich entwickelt: In jedem Fall geschieht es unter dem Blickwinkel und dem Einfluss der inzwischen erfahrenen Erkrankung.
Bevor ich mich dem Versuch zuwende, die Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis wissenschaftlich authentisch und zugleich verständlich darzustellen, will ich eine Geschichte erzählen. Es ist die Lebens- und Leidensgeschichte von Holger Andresen. Holger ist der Sohn eines Freundes. Ich kenne ihn seit seiner Kindheit. Ich habe ihn als Schuljungen, als Zivildienstleistenden und als jungen Studenten immer wieder aus der Nähe erlebt. Ich war dabei, als er in eine Krise geriet, als er schließlich erkrankte. Ich habe ihn als Freund begleitet, nicht als Arzt. Aber weil ich Psychiater bin, habe ich seine Entwicklung in die Krankheit natürlich auch mit den Augen des Psychiaters gesehen.
Holgers Geschichte ist »wahr«. Sie ist es in dem Sinn, dass ich sie so erlebt habe. Zugleich ist sie »erdichtet«: Die handelnden Personen sind andere als im wirklichen Leben. Auch der Rahmen und die Schauplätze sind – selbstverständlich! – verändert.
Kindheit und Schulzeit
Holger war ein freundliches, ein strahlendes, ein liebes Kind. Mit großen, offenen Augen und unbezwingbarer Neugier eroberte er die Welt für sich. Er lernte früh laufen und sprechen. Seine beiden älteren Geschwister nahmen ihn dabei fürsorglich unter ihre Fittiche. Selbstverständlich gab es Reibereien und Rivalitäten zwischen ihnen, wie immer unter Geschwistern.
Die Eltern kamen offensichtlich gut miteinander klar, obwohl die Mutter von der Ausschließlichkeit des Lebens mit drei kleinen Kindern zeitweise recht genervt war. Der Vater, ein gefragter Anwalt, kam während der Woche abends meist spät nach Hause. Aber am Wochenende war er fast immer da und verfügbar. Als Holger mit drei Jahren in den Kindergarten kam, seine Schwester eingeschult wurde und sein Bruder die dritte Klasse erreicht hatte, ergriff die Mutter die Gelegenheit, zunächst stundenweise, dann halbtags in ihren Beruf als Psychologin in eine Beratungsstelle zurückzukehren.
Der Lebensstil der Familie war mehr oder weniger konventionell: Haus am Stadtrand, Mittelklasseauto, Sommerurlaub in Dänemark, gelegentliche Theater- und Konzertbesuche, Einladungen von Freunden, Bekannten und Nachbarn und entsprechende Gegenbesuche.
Holgers Grundschuljahre und die ersten Jahre im Gymnasium verliefen unspektakulär. Er war von Anfang an ein ausgezeichneter Schüler. Scheinbar mühelos heimste er eine gute Note nach der anderen ein. Daneben nahm er seit dem sechsten Lebensjahr Klavierunterricht. Er spielte Handball in der Schulmannschaft und später im Verein – vorzugsweise im Tor. Seine freie Zeit verbrachte er zu Hause mit Lesen und Musikhören – viel Klassik – oder mit seinen beiden Freunden. Die drei hatten sich in der ersten Grundschulklasse kennengelernt und bildeten seither eine verschworene Gemeinschaft, die sich mehr oder weniger selbst genügte.
Seine beiden älteren Geschwister entwickelten sich sichtbar anders als er. Sein Bruder war schon früh überwiegend aushäusig. Er war entweder auf dem Sportplatz oder mit seinen vielen Freunden – und bald auch mit Freundinnen – unterwegs. Er bastelte an Stereoanlagen, an Mofas und später an Motorrädern herum. Die Schule nahm er von der leichten Seite. Immerhin schaffte er mit zwanzig Jahren ohne »Ehrenrunde« das Abitur mit gerade noch ausreichendem Notendurchschnitt. Nach Ableistung des Wehrdienstes begann er, wie er es gewünscht hatte, ein Betriebswirtschaftsstudium an einer entfernten Universität.
Seine Schwester hatte viel Ähnlichkeit mit ihrem älteren Bruder. Sie verbrachte ihre Zeit, wann immer möglich, mit lauter Musik und Freunden in Discos und bei Konzerten. Die Schule besuchte sie eher widerwillig. Aber im zweiten Anlauf brachte sie es schließlich doch zum angestrebten Abschluss.
Rückzug und erste Krise
Als Holger sechzehn Jahre alt war, verließ sein älterer Bruder das Elternhaus. Der Auszug hinterließ für Holger eine unerwartet schmerzliche Lücke. Des Bruders Lockerheit und Unbekümmertheit fehlten ihm. Seine eigenen ernsthaften Züge traten in der Folgezeit immer stärker in den Vordergrund. Er wandte sich verstärkt klassischer Musik zu und ging abends selten aus dem Haus. Er kehrte nach dem Handballtraining direkt aus seinem Tor nach Hause zurück. Und während seine Kameraden sich mit den Mädchen aus der Klasse in der »Milchbar« trafen, las er Dostojewski.
Die anderen begannen ihn deswegen zu necken. Sie verstanden nicht, dass er sich daraufhin noch mehr zurückzog. Sie sagten, er sei einfach zu empfindlich. Manchmal hatten wir den Eindruck, er versuchte damit, möglichen Kränkungen und Verletzungen aus dem Weg zu gehen. Aber ich würde lügen, wenn ich behauptete, irgendjemand sei darüber besorgt oder beunruhigt gewesen. Er machte in seiner pubertären Entwicklung kaum Anstalten, sich vom Elternhaus zu lösen. Nur gelegentlich kam es zu unvermittelten, heftigen Auseinandersetzungen mit dem Vater.
Kurz vor dem Ende des vorletzten Schuljahres, er war mittlerweile fast neunzehn, geriet er ohne sichtbaren äußeren Anlass in eine Krise. Ganz unvermittelt wollte er nicht mehr zur Schule gehen. Auch das Training stellte er ein. Er überwarf sich aus für uns unverständlichen Gründen mit seinem Klavierlehrer. Er stand zu Hause stundenlang vor dem Spiegel und betrachtete sein Gesicht. Er mochte nicht mehr vor die Tür treten, und zwar ohne dass er einen Grund dafür nennen konnte oder wollte. Er kam morgens nicht aus dem Bett. Er suchte die Schule verspätet auf. Manchmal kam er gar nicht dort an. Seine beunruhigten Eltern spürten, dass er Angst vor etwas hatte. Sie konnten nicht begreifen, warum und was es war. Seine überragenden Leistungen blieben, wie in all den Jahren zuvor, ungefährdet. Auch über Konflikte oder konkrete Schwierigkeiten mit Lehrern oder Mitschülern berichtete er nicht.
Die Eltern reagierten verständnislos und ungehalten auf seine Veränderung. Sie hielten ihm vor, er möge sich gefälligst zusammennehmen. Jeder habe mal ein Tief. Er könne wenige Wochen vor dem Ende des vorletzten Schuljahres nicht sein Abitur riskieren. Das Aufstehen und der Gang zur Schule wurden zum allmorgendlichen Kampf zwischen seiner Mutter und ihm. Eine Woche lang quälte er sich aus dem Haus. Dann verweigerte er sich gänzlich. Er würde nicht mehr gehen, erklärte er. Seine Eltern waren ratlos und außer sich zugleich.
In dieser Situation rief Holger mich an. Ich arbeitete damals in einer kleinen Universitätsstadt in Süddeutschland. Ich hatte ihn seit den vergangenen Sommerferien, die er überwiegend bei uns verbracht hatte, nicht mehr gesehen. Ich fiel aus allen Wolken, als er mitten in der Schulzeit fragte, ob er kommen dürfe. Er habe sich mit den Eltern zerstritten. Er könne nicht mehr zur Schule; er könne aber auch nicht im Haus bleiben.
Bei der Ankunft wirkte er verängstigt und ratlos. Er erzählte, die Reise sei schrecklich gewesen. Die Leute hätten ihn alle angestarrt. Sie seien so merkwürdig gewesen. Er bat mich, einen Umweg zu machen, damit wir nicht zu vielen Menschen begegneten. Er habe das Gefühl, sie kämen ihm einfach zu nahe. Überhaupt werde ihm alles zu viel, zu laut und zu grell. Er fühle sich von innen durch seine Gedanken und von außen durch die Menschen bedrängt.
Wir versuchten ihm zu helfen, zunächst einmal zur Ruhe zu kommen. Er tat sich schwer damit. Er war hin- und hergerissen. Dass er nicht zur Schule konnte, bedrückte ihn, obwohl er froh war, nicht gehen zu müssen. Er hatte Schuldgefühle. Er dürfe nicht klein beigeben. Er habe letztlich keinen Grund für seine Angst und seine innere Aufgeregtheit. Immerhin konnte er schlafen.
Ich konnte mir in den nächsten Tagen viel Zeit für ihn freihalten. Wir unternahmen lange Wanderungen durch die einsamen Wälder außerhalb der Stadt. Es beruhigte ihn sichtlich, dass uns kaum jemand begegnete. Die Stille tat ihm wohl. In der Stadt sei in den letzten Wochen alles so laut gewesen. Auch die grellen Farben und die bunten Lichter an den Abenden seien regelrecht auf ihn eingestürmt. Ein flegelhafter Radfahrer, der unvermittelt auftauchte und ihn fast umfuhr, erschreckte ihn über die Maßen. Ich konnte ihm nicht begreiflich machen, dass das sicher nicht mit Absicht geschehen sei. Er brach in Tränen aus und schluchzte, so etwas sei in den letzten Wochen immer wieder passiert: Er werde gerempelt, Autos kämen auf ihn zu, alte Frauen starrten ihn an, Jugendliche riefen ihm Unverschämtheiten nach. Er begreife das alles nicht mehr.
In der Schule sei das alles besonders schlimm. Seit die Klasse im vergangenen Jahr neu zusammengesetzt worden sei, habe sich alles zum Schlechteren verändert. Es herrsche ein fürchterliches Klima. Fast alle hätten etwas gegen ihn. Sie tuschelten und redeten hinter seinem Rücken über ihn. Wenn seine beiden Freunde nicht wären, hätte er schon vor Monaten nicht gewusst, was er tun solle. Manchmal sei er in letzter Zeit nicht so sicher, ob die beiden nicht auch von den anderen beeinflusst würden. Seine Eltern seien in dieser Situation wenig hilfreich. Sie sagten ihm, er bilde sich das alles ein. Manchmal denke er, sie stünden auf der anderen Seite. Das könne ja wohl nicht sein. Aber sie würden ihm einfach nicht glauben.
Erleichterung und Ratlosigkeit
Die Tage vergingen. Die langen Spaziergänge und die Ruhe zeigten allmählich Wirkung. Holger fasste wieder Mut. Er ließ sich nicht mehr durch jede unverhoffte Begegnung aus dem Gleichgewicht bringen. Er überzeugte sich in langen Telefonaten, dass seine Eltern doch auf seiner Seite standen. Er zwang sich, unter Leute zu gehen. Er ging allein ins Kino, in Cafés und in Kneipen. Er ließ die abendlichen Lichter von Schaufenstern und Reklame auf sich wirken.
Schließlich beschloss er zurückzufahren. Er müsse sich dem stellen. Er müsse lernen, die Abneigung und Gehässigkeit der anderen in der Schule auszuhalten. Vielleicht habe er sich manches ja doch eingebildet. Vielleicht sei es gar nicht so schlimm, wenn er stärker wäre und sich besser auf die anderen einstellen könne. Er werde jedenfalls nicht klein beigeben.
Erleichterung bei den Eltern und bei mir trat ein, aber auch ein beträchtlicher Rest an Ratlosigkeit. War er einfach nur erschöpft und übermäßig gestresst? War das Klima in der Klasse wirklich so böswillig? Reagierte er überempfindlich, wie das seit Jahren viele behaupteten? Hörte er irgendwie »das Gras wachsen«? Hatte er irgendwelche Probleme, von denen die Eltern und ich nichts wussten? Täuschte die scheinbar so heile Familienwelt über versteckte Konflikte hinweg?
Wir bekamen es nicht heraus. Holger zeigte keine Neigung, darüber zu diskutieren. Internat und Psychotherapie wurden zum Thema. Holger blockte beides mit Nachdruck ab. Psychotherapie sei keine Lösung für die Art, wie die anderen mit ihm umgingen. Im Übrigen müsse er sich durchbeißen und das könne er am besten zu Hause. Dort fühle er sich doch noch am sichersten.
Nach den Sommerferien nahm er die Schule wieder auf. Mithilfe eines Tranquilizers überwand er die Angst der ersten Tage. Er schaffte es. Aber seine Schulleistungen ließen nach. Wir führten das auf die fehlenden Wochen vor den Ferien zurück. Allein, er erholte sich nicht. Es schien, als seien seine frühere Arbeitskraft und seine Leistungsmotivation wie weggeblasen. Er konnte sich nicht konzentrieren. Er zehrte von dem in den zwölf Jahren angehäuften Wissen. Um alles Neue machte er einen Bogen. Wenn Neues gefordert wurde, kam er nicht mit. In Chemie und Physik musste er erstmals in seiner Schulkarriere Nachhilfeunterricht nehmen, um mit Mühe den Anschluss zu erreichen.
Holger schien das wenig zu kümmern. Ihm sei sein soziales Leben wichtiger als seine Leistungen. Aber für uns Außenstehende tat sich auf der sozialen Seite nicht mehr als früher, eher weniger. Er spielte wieder Klavier, stand wieder im Tor, ging zu Schulveranstaltungen. Ansonsten aber verkroch er sich in seinem Zimmer. Er las auch kaum noch. Er hörte keine Musik mehr. Wenn er überhaupt etwas tat zu Hause, so saß er vor dem Fernseher.
Auf unser Zureden suchte er schließlich doch eine Psychotherapeutin auf. Nach drei Sitzungen brach er das Unternehmen allerdings wieder ab. Die Frau habe ihm lauter Fragen über Dinge gestellt, die sie nichts angingen. Sie sei ihm keine Hilfe. Immerhin, er wirkte jetzt entspannter. In den Telefonaten beklagte er sich nicht mehr über die vielsagenden Blicke und das gehässige Getuschel der anderen. Er schien in die Klassengemeinschaft zurückgefunden zu haben und absolvierte schließlich das Abitur mit leidlich gutem Notendurchschnitt.
Ausbruch und Zusammenbruch
Nach den Prüfungen wollte er unbedingt von zu Hause weg. Er erlebte die Beziehung zu seinen Eltern seit der Krise als angespannt. Sie hinderten ihn daran, selbstständig zu werden. Sein Ersatzdienst war ihm willkommene Gelegenheit auszuziehen. Er stellte den Antrag, in meine Stadt versetzt zu werden, um nicht ganz allein zu sein.
Er wurde als Pfleghelfer in einer Privatklinik eingesetzt, tat sich allerdings schwer in der neuen Umgebung. Das Leid der Kranken bedrückte ihn. Er fand überhaupt keinen Anschluss und hatte Mühe mit dem breiten schwäbischen Dialekt. Auch zu mir kam er nur selten: Er müsse lernen, selbstständig zu leben und sich nicht ständig anzulehnen. Er belegte Volkshochschulkurse, brach sie jedoch nach kurzer Zeit wieder ab. Die Leute seien so unfreundlich zu ihm.
Bald beklagte er, wie sich die Kolleginnen und Kollegen und die Vorgesetzten im Krankenhaus über ihn lustig machten, über ihn tuschelten, ja laut über ihn redeten. Auf seine Nase hätten sie es besonders abgesehen. Er höre immer wieder, wie sie sagten: »Hat der eine hässliche Nase!«, »Hat der einen Zinken!«. Sie sei ja auch groß, aber so mit ihm umzugehen, sei gemein.
Wenn er mich besuchte, stand er ständig vor dem Spiegel und betrachtete und betastete seine Nase. An keiner spiegelnden Glasfläche konnte er vorbeigehen, ohne nach seiner Nase zu schauen. Wenn er etwas Geld verdiente, würde er sie sich operieren lassen, meinte er. Sie war keineswegs groß und hässlich, diese Nase. Zwanzig Jahre war er mit ihr zufrieden gewesen – und jetzt dieses Theater! Ich spürte, dass ich zunehmend gereizt reagierte. Aber ich half ihm damit nicht: »Wozu hat man denn Freunde, wenn die einem nicht glauben!«, rief er eines Abends verzweifelt aus und knallte die Tür hinter sich zu.
Er beantragte die Versetzung in eine andere Klinikabteilung und war erleichtert, als er dort anfangen konnte. Der Betrieb war weniger hektisch, die Leute waren freundlich. Alles schien in Ordnung. Aber nach zwei Wochen ging es abermals los: Getuschel, übles Gerede. Es wurde sogar noch schlimmer. Es ging jetzt nicht nur um die Nase, sondern um das ganze Gesicht, das hässlich sei. Sein ganzer Körper sei verwachsen. Auch die Leute auf den Straßen sähen ihn wieder so eigenartig an. Auch sie redeten über ihn. Er sei ganz sicher. Er bilde sich das nicht ein. Schließlich habe er Ohren. Er begann, sich über das unverschämte Verhalten der Menschen aufzuregen. Er empörte sich. Wenn dies so weitergehe, würde er die Verantwortlichen ansprechen und zur Rechenschaft ziehen. So könne man nicht mit ihm umgehen. Im Übrigen, und das sei ja wohl das Letzte, habe bei seinem vorigen Besuch auch einer meiner Gäste so über ihn geredet.
Am Tag darauf kam er in Panik zu uns. Er halte es nicht mehr aus: Jetzt befassten sie sich schon im Radio mit ihm. Und gerade habe sich jemand im Fernsehen über seine große Nase aufgehalten. Alles habe sich gegen ihn verschworen. Selbst das Diktiergerät, mit dem er versuchte habe, das Gerede über ihn aufzuzeichnen, werde gestört. Es sei nichts darauf.
Meine Versuche, ihm das auszureden, waren vergebens. Ich schlug ihm vor, er möge sich beurlauben lassen und schleunigst nach Hause zu den Eltern zurückkehren. Nein, er müsse das aushalten. Er sei ohnehin verurteilt; er würde alle mit ins Unglück ziehen. Er dürfe nicht heim.
Kaum zu Hause in seiner Wohnung, rief er mich an, jetzt in Panik. Sein ganzer Körper stehe unter Strahlen. In seinem Kopf finde eine Sendung statt. Die Sprecher sagten, seine Mutter habe Krebs; sein Vater sei schon tot und wir würden auch sterben. Er sei verurteilt. Es sei alles hoffnungslos. Ich möchte bitte sofort zu ihm kommen und ihm helfen. Als ich zu ihm kam, war er gequält von Angst und Verzweiflung. Ich solle ihm helfen zu sterben, damit dies aufhöre.
Er kam in die Klinik, in der Hoffnung, dort den Tod zu finden. Panik und Angst machten jede Auseinandersetzung mit ihm unmöglich. Auf die Injektion von Haloperidol und Valium reagierte er mit Entspannung und schließlich mit Schlaf. Am nächsten Morgen stand ihm die Erinnerung an die entsetzlichen Erlebnisse des Vorabends noch in den Augen: Nur das nicht wieder, gebt mir was dagegen! Das konnte er immerhin äußern. Wir spürten, dass ganz Verschiedenes mit ihm und in ihm geschah, zu dem wir keinen Zugang hatten, von dem wir ausgeschlossen waren. Er konnte uns auch nicht einbeziehen, weil er fest davon überzeugt war, dass wir alle seine Gedanken lesen könnten, dass wir alles hörten, was auch er hörte.
Innerhalb weniger Tage wurde er ruhig, fast gelassen. Er erzählte uns von den eigenen Gedanken, die vor wenigen Tagen noch schrecklich laut gewesen waren, und von den Stimmen, die ständig in ihm sprachen. Sie waren nicht mehr so schrill und bedrohlich. Er fand sie unterhaltsam: »So bin ich nie allein«, meinte er eines Tages. Als sie leiser wurden und schließlich verschwanden, bedauerte er das. Fast gleichzeitig ließ seine Geräuschempfindlichkeit nach. Auch das Getuschel und die beziehungsreichen Blicke der Mitmenschen, die er in der Klinik im Übrigen nicht wahrgenommen hatte, spürte er bei seinen Spaziergängen außerhalb der Station bald nicht mehr.
Stattdessen litt er an Medikamentennebenwirkungen: Er verspürte ein heftiges Ziehen in den Muskeln und erlebte seine Beweglichkeit als eingeschränkt. Zugleich konnte er seine Füße nicht stillhalten. Er war müde und gleichgültig und konnte sich nicht konzentrieren. Mit den Therapeuten begann er über die Dosierung zu verhandeln und setzte mit unserer Unterstützung eine rasche Reduktion durch, wenig später gegen unseren Rat auch seine Entlassung.
Das Leben danach
Die Therapeuten stellten damals die Diagnose einer paranoiden Psychose – eine Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis. Holger und seine Eltern hatten große Mühe, diese Diagnose zu akzeptieren, die ihnen wie ein gewaltiger Einbruch in ihr Leben erschien. Dass er sich so rasch wieder gefangen hatte, schien die Experten zudem Lügen zu strafen. Schon nach drei Wochen hatte er aus dem Krankenhaus entlassen werden können. Nur widerwillig ließ er sich überreden, die Medikamente weiterhin einzunehmen. Sie machten ihn müde und unkonzentriert; und wenn er sie einnehme, sei das ein Zeichen dafür, dass er krank sei. Im Übrigen seien die Nebenwirkungen schlimmer als die positiven Wirkungen. Immerhin, ein Gutes hatte die Diagnose: Sie befreite ihn von der Beendigung des Zivildienstes. Er konnte vorzeitig sein Studium aufnehmen und trat in die Fußstapfen seines älteren Bruders und studierte Betriebswirtschaft.
Inzwischen sind mehr als zwanzig Jahre vergangen. Holger weiß heute, dass er mit der Bürde einer schweren psychischen Störung leben muss. Er hat anfangs bittere Erfahrungen gemacht. Schon drei Monate nach der Entlassung hatte er die Medikamente abgesetzt, weil ihn die Nebenwirkungen beeinträchtigten. Sechs Wochen später war er wieder in der Klinik, diesmal für wesentlich längere Zeit. Eine Rehabilitationsbehandlung in der Tagesklinik hatte sich angeschlossen. Die Wiederaufnahme des Studiums scheiterte.
In dieser Situation fand er eine Teilzeitarbeit in einem Archiv und eine Psychotherapeutin, die ihm half, seine vielfältigen Lebensprobleme zu verarbeiten, die Krankheit zu begreifen, seine Fähigkeiten und seine Belastbarkeit auszuprobieren und aus allem das Beste zu machen. Dabei kam ihm seine alte Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit zustatten. Er lernte, seine Medikation jenseits einer niedrigen Basisdosierung, je nach Belastung, selbst zu regulieren. Er knüpfte an alte Freundschaften und Bekanntschaften wieder an.
Nach Abschluss der Psychotherapie fühlte er sich stark genug, um eine Ausbildung als Verwaltungsangestellter zu beginnen und drei Jahre später abzuschließen. Mittlerweile hat er über zehn Jahre lang keinen Rückfall mehr gehabt, aber er erlebt sich selbst immer noch als verletzlich und begrenzt belastbar. Vor einiger Zeit schrieb er mir, er sei guten Mutes, obwohl er keine Arbeit finde. Er erhalte jetzt Hartz IV, sodass er wenigstens nicht von seinen Eltern abhängig sei.
Privat habe er nicht so Erfreuliches zu vermelden. Seine Freundschaft mit einer Kollegin, die in letzter Zeit ohnehin etwas abgekühlt sei, sei nun wohl endgültig vorbei. Sie habe Kinderwünsche und unternehme gern lange Reisen. In beiden Punkten könne er ihre Erwartungen nicht erfüllen. Außerdem habe sie etwas gegen seine »gesundheitliche Vergangenheit«.
Holger hat sich »gefangen«. Er lebt selbstständig in einer kleinen Wohnung und nimmt jeden Aushilfsjob an. Aber die Krankheit hat Spuren hinterlassen, sie hat seinen Lebensweg bis heute geprägt. Er weiß, er muss sie auch für die Zukunft in Rechnung stellen. Er hat gelernt, mit ihr zu leben und seine Lebensziele darauf einzustellen – das mag man als traurig ansehen, aber alle Beteiligten wissen, dass es auch schlimmer hätte kommen können.
Für mich ist in den ganzen zwanzig Jahren die Frage offengeblieben, ob ich die Krise schon früher als beginnende Psychose hätte erkennen müssen, ob meine abwartende Haltung richtig war oder ob ich schon früher hätte intervenieren müssen – letzten Endes, ob der Krankheitsverlauf bei einem früheren Eingreifen vielleicht milder ausgefallen wäre.
Die Krankheit
»Schizophrenie ist ein von Eugen Bleuler erfundenes Wort.«
Thomas Szasz
»Schizophrenie (griech.) von E. Bleuler eingeführter Name für die bis dahin nach E. Kraepelin Dementia Praecox genannte Gruppe verschiedenartiger, in ihrem Wesen noch wenig erforschter Krankheitszustände. Die meisten Erkrankungen heilen nach wenigen ›Schüben‹ aus.«
Brockhaus Lexikon 1992
Die Schizophrenie ist eine unverstandene psychische Störung. »Schizophrenie« steht für ein Leiden, das Angst macht. Sie ist zudem die schillerndste aller psychischen Störungen. Schizophrenie ist gleichwohl – entgegen einem weitverbreiteten Vorurteil – eine zwar ernste, aber gut behandelbare Krankheit. Die Schizophrenie ist nicht selten. Sie ist so häufig wie die insulinpflichtige Zuckerkrankheit. Jeder Hundertste von uns erkrankt daran. In jeder Nachbarschaft gibt es jemanden, der daran leidet.
Das zentrale schizophrene Syndrom
Jenseits aller Vielfalt, der ich in späteren Kapiteln nachgehen werde, gibt es Krankheitserfahrungen, die ein »zentrales schizophrenes Syndrom« (Wing) abbilden, das bei Kranken überall in der Welt anzutreffen ist. Es ist gekennzeichnet durch das Erleben der Eingebung von Gedanken, der Gedankenübertragung und des Gedankenentzugs, durch Stimmen, die der oder die Betroffene über sich sprechen hört oder die seine Handlungen und Gedanken begleiten, durch die veränderte Wahrnehmung seiner physischen Umgebung. So kann beispielsweise die ganze Welt in einen so intensiven persönlichen Bezug zu ihm treten, dass sich jedes Geschehen speziell auf ihn zu beziehen scheint und eine besondere Mitteilung an ihn enthält.
Es ist leicht einzusehen, dass die davon Betroffenen alle geläufigen Erklärungen ihres kulturellen Hintergrunds abrufen, um diese Störung zu erklären: etwa Hypnose, Telepathie, Radiowellen oder Besessenheit. Mit einiger Fantasie kann man sich vorstellen, was sich zu Beginn einer schizophrenen Psychose abspielt, und verstehen, weshalb Angst, Panik und Niedergeschlagenheit so häufig sind, warum das Urteilsvermögen so oft beeinträchtigt ist. Menschen, die unerschütterlich von der Wirklichkeit dessen, was sie sehen und hören, überzeugt sind, haben aus Sicht der Mitmenschen »Wahnideen«. Sie erleben, dass andere ihnen zu nahetreten, sie bedrohen; sie fühlen sich verfolgt. Die Außenwelt nimmt das als »Verfolgungswahn« wahr.
Andere Kranke isolieren sich. Ihre eigenen Gefühle werden ihnen fremd. Sie brechen ihre sozialen Kontakte ab. Sie verlieren ihren Antrieb. Sie kommen nicht mehr aus dem Bett. Sie vernachlässigen sich. Sie können gleichsam nicht mehr wollen. Sie kommen ihren persönlichen und sozialen Verpflichtungen nicht mehr nach. In der Folge geraten sie in vielfältige Schwierigkeiten.
Das Erleben, insbesondere aber das Verhalten der Erkrankten sind für andere oft nicht nachvollziehbar. Es leuchtet ein, dass eine Verständigung zwischen verschiedenen Wahrnehmungswelten nur schwer möglich ist, manchmal sogar unmöglich. Vor allem solange die Krankheit nicht als solche erkannt ist, reagieren Mitmenschen mit Unverständnis. Sie erwarten, dass die anderen – die Kranken – die Regeln des üblichen mitmenschlichen Umgangs einhalten, dass sie sich »normal« verhalten. Sie kommen gar nicht auf den Gedanken, sie könnten es mit psychisch gestörten, verstörten Menschen zu tun haben. Sie verstehen deren Angst und Schreckhaftigkeit nicht und reagieren mit Gereiztheit, wenn sie mit ihrem Wunsch nach früher üblicher Nähe und sozialem und emotionalem Umgang zurückgewiesen werden. Auch das Gefühlsleben der Kranken ist oft gestört, ohne dass die Menschen aus ihrer Umgebung dies wissen können.
Im Alltag gehen langwierige Leidensphasen dem Begreifen voraus, dass eine Krankheit vorliegt: heftige Konflikte zwischen den Kranken und ihren Angehörigen, Abbrüche von Freundschaften, sozialer Rückzug, Ausschluss aus Vereinigungen und Gruppen, in denen sie lange gelebt haben, Berufs- und Wohnungsverlust, wenn nicht gar Verwahrlosung. Dem Scheitern der normalen psychologischen Bewältigungsversuche folgt die krisenhafte Zuspitzung, der psychische Zusammenbruch, der die Diagnose und die psychiatrische Behandlung oft erst möglich macht (HÄFNER 2018, 2010).
Aber mit der Therapie ist es nicht getan, denn die Schizophrenie ist eine Krankheit, die den Kern der Persönlichkeit berührt und das psychosoziale Beziehungsgeflecht verändert. Unabhängig vom weiteren Verlauf muss das Psychoseerleben reflektiert und bewältigt werden. Und die Verwerfungen im sozialen Netzwerk müssen überwunden werden – in der Familie, im Freundeskreis, in Ausbilddung und Beruf. Dabei bedarf der Genesende jenseits der Therapie auch der Unterstützung durch die Gemeinschaft der Gesunden.
Schizophrenie als Metapher
Schizophrenie ist nicht nur eine Krankheit; sie ist zugleich eine Metapher. Sie ist ein Symbolbegriff und steht im sprachlichen Gebrauch für alles mögliche andere – und nichts davon ist gut. Das Wort »Schizophrenie« wird somit zu einer Metapher der Diffamierung, des Vorurteils und der Diskriminierung. Seine metaphorische Verwendung hat entscheidenden Anteil an der Stigmatisierung, der Beschädigung der Identität der von der Krankheit Betroffenen. Und das hat verheerende Folgen: »Jeder, der mit Psychosekranken und ihren Angehörigen zu tun hat, weiß, welchen Schrecken die bloße Erwähnung des Wortes ›Schizophrenie‹ hervorruft. Er hat gelernt, es nur sehr vorsichtig oder überhaupt nicht zu verwenden. Offenbar hat der Begriff«, so der Wiener Psychiater Heinz KATSCHNIG (1989), »ein Eigenleben entwickelt, das der heutigen Realität der Krankheit Schizophrenie in keiner Weise entspricht.«
Das ist nicht das Ergebnis eines Versagens der Psychiatrie im Umgang mit ihrer zentralen Krankheit, sondern eine direkte Folge der Instrumentalisierung des Begriffs als Metapher der Diffamierung. Als solche hat sie nichts mit jener Krankheit zu tun, deren besonderes Kennzeichen darin liegt, dass »das Gesunde dem Schizophrenen erhalten bleibt« (E. BLEULER 1911/1988). Schizophrenie als Metapher wird ausschließlich abwertend gebraucht. Sie nährt Vorstellungen von Unberechenbarkeit und Gewalttätigkeit, von unverständlichem, bizarrem oder widersinnigem Verhalten und Denken. Ob Teenager etwas »schizo« finden oder ob politisch Tätige das Handeln des Gegners als »schizophren« brandmarken, macht da keinen Unterschied. Das Wort »schizophren« eignet sich hervorragend zur diffamierenden Verkürzung.
Was hilft es da, wenn der englische Sozialpsychiater John Wing mahnt, Schizophrenie habe nichts mit Gewalttätigkeiten bei Fußballspielen zu tun oder mit dem Verhalten gestresster Politiker, mit Drogenabhängigkeit oder Kriminalität, mit der Kreativität von Künstlern oder nicht nachvollziehbaren Umtrieben von Wirtschaftsmanagern und Generälen: »Es ist nicht einmal richtig, dass alle Menschen mit der Diagnose Schizophrenie ›verrückt‹ sind; sie können aus der Sicht des Laien vollkommen gesund sein« (WING 1978/2010, S. 133).
Dieser Missbrauch des Wortes »Schizophrenie« leitet sich von vagen, vorurteilsbehafteten Vorstellungen von der Krankheit Schizophrenie ab. Aber diese prägen das Bild der Allgemeinheit von der Krankheit und den daran Erkrankten. Wen kann es da wundern, dass die Diagnose Angst und Schrecken und heftige Abwehr auslöst? Man will sie nicht wahrhaben. Schizophrenie ist deshalb keine Krankheit wie andere. Sie ist eine »verrufene« Krankheit (SONTAG 1978).
Die zweite Krankheit
Zum Leiden an der Krankheit, ihren Symptomen und sozialen Folgen kommt das Leiden an Vorurteilen, Diskriminierung und Schuldzuweisung, am Stigma der Krankheit Schizophrenie, das auf diese Weise zu einer zweiten Krankheit wird, die um alles in der Welt verborgen werden muss. Deshalb wird immer wieder gefordert, die Medizin möge den Schizophreniebegriff aufgeben. Leider zeigt die Erfahrung, dass solche Unternehmungen regelmäßig scheitern. Aber nichts spricht dagegen, im Alltag den weniger belasteten – wenngleich ungenaueren – Begriff der Psychose zu verwenden.
Wer versucht, Schizophreniekranke und ihre Angehörigen zu verstehen und ihnen zu helfen, wird mit Betroffenheit feststellen, in wie schrecklicher Weise das Bild der Allgemeinheit von der Krankheit ihr Leiden verstärkt. Es verzerrt die Selbstwahrnehmung der Kranken und ihrer Angehörigen, untergräbt ihr Selbstbewusstsein und prägt den Umgang der Gesunden mit ihnen in fataler Weise. So bleibt es nicht aus, dass die Diagnose Schizophrenie von allen Betroffenen und Mitbetroffenen in doppelter Weise als Katastrophe erlebt wird. Daraus folgt, dass sich alle Ansätze zur Bewältigung der Schizophrenie nicht auf die Behandlung der Krankheit selbst beschränken dürfen. Sie müssen den Betroffenen – den Kranken wie den Angehörigen – zugleich dabei helfen, die verletzenden und ungerechten Folgen von Diskriminierung und Stigmatisierung zu überwinden (FINZEN 2013, 2010 a).
Ich werde in den folgenden Kapiteln versuchen, dieser doppelten Aufgabe gerecht zu werden. Dabei wende ich mich zunächst den psychosozialen Auswirkungen des Einbruchs der Krankheit in die Lebenswelt der Betroffenen zu. Erst danach werde ich mich mit dem Verlauf der Krankheit und dem Umgang mit ihr beschäftigen. Ich beginne mit der Darstellung der Folgen des Einbruchs der Psychose für das Erleben und das Zusammenleben aller Beteiligten – auch weil deren Bewältigung darüber entscheidet, welche menschliche Unterstützung die Kranken in ihrem Leben mit der Krankheit und bei ihrer Bewältigung erfahren werden.
Die schizophrene Erkrankung: eine Katastrophe für die ganze Familie
Die Erkenntnis, dass ein Familienmitglied an einer Schizophrenie erkrankt ist, wird von Angehörigen einhellig als Katastrophe erlebt, als eine Katastrophe, die alles verändert. Wenn nichts mehr ist, wie es war …, hieß der Titel eines sehr erfolgreichen Buches, in dem Angehörige psychisch Kranker über ihre erschütternden, bedrückenden Erfahrungen und über demütigende Erlebnisse berichten. Aus diesem Buch resultierte in den Achtziger- und Neunzigerjahren viel Ermutigung, nicht zuletzt für die Selbstorganisation der Angehörigen. Heute ist der Angehörigenverband längst professionell organisiert und eine verlässliche Anlaufstelle.
Stigma und Schuldzuweisung
Was ist es, das die Erkrankung eines Angehörigen für den Rest der Familie zur Katastrophe macht? Ich bin überzeugt davon, dass das viel mit zwei sozialen Faktoren zu tun hat, die mit dem Krankheitsgeschehen selbst gar nicht zwingend verknüpft sind: mit der Stigmatisierung der Kranken und der Schuldzuweisung an die Angehörigen.
Wir alle leben in der Gewissheit, dass wir am Ende sterben müssen. Wir alle wissen, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit an einer Herzkreislauferkrankung oder an Krebs sterben werden und dass es vielfältige andere Krankheiten gibt, die vielen von uns Schmerzen und Leid, Einschränkungen und Verlust an Lebensqualität bringen können. Dennoch lassen wir das Wissen darum in gesunden Tagen nicht allzu nah an uns herankommen. Wir tun meistens so, als gehe uns das alles nichts an. Wahrscheinlich müssen wir das tun, um nicht aus beständiger Angst vor kommendem körperlichem Leiden unsere psychische Gesundheit zu verlieren.
Psychische Krankheit allerdings liegt uns noch ferner als körperliche. Sie geht uns in unserem Selbstverständnis nun wirklich gar nichts mehr an. Das ist rational schwer verständlich, weil psychische Krankheiten ja keineswegs selten sind: Jeder Hundertste von uns erkrankt im Lauf seines Lebens an einer Psychose. Die phasisch verlaufenden Depressionen und die manisch-depressive Krankheit sind annähernd ebenso häufig. Und zwischen fünfzehn und zwanzig Prozent der Bevölkerung befinden sich zu jedem gegebenen Zeitpunkt wegen Störungen der psychischen Befindlichkeit in ärztlicher – meist in hausärztlicher – Behandlung.
Aber schwere psychische Störungen haben einen völlig anderen gesellschaftlichen Stellenwert. Schizophreniekranke sind stigmatisiert. Sie gehören nicht zu uns. Dennoch wird an ihnen deutlich, wie unmittelbar stigmatisierte Menschen unserer Mitte entstammen und wie unverschuldet das geschieht. Ihre Angehörigen sind diejenigen von uns, die sich in nächster Nähe dieses gesellschaftlichen »Unfallortes« aufhalten. Sie sind Zeugen und Mitbetroffene zugleich. Oft benötigen sie lange Zeit, um zu erfassen, was sich da vor ihren Augen inmitten ihrer Familie zuträgt. Sie erleben Rat- und Hilflosigkeit. Die Stigmatisierung der Kranken trifft auch sie. Aber nicht nur das; sie müssen erfahren, dass sie, die Eltern, für die Krankheit ihres Kindes verantwortlich gemacht werden: falsche Erziehung, mieses Familienklima …
Wenn wir die Statistik betrachten, dürften schizophrene Psychosen eigentlich niemandem fremd sein. Die Erfahrung von Schizophrenie in der Familie, in der Nachbarschaft, im Bekannten- und Freundeskreis oder an der Arbeitsstelle müsste uns vertraut sein. Wenn einer von hundert im Lauf seines Lebens an Schizophrenie erkrankt und einer von zweihundert aktuell krank ist, dann müsste bei zwei Eltern mit durchschnittlich zwei Kindern in jeder 25. Familie ein Krankheitsfall auftreten – zählen wir die Großeltern hinzu, in jeder zwölften.
So darf man natürlich nicht rechnen, schon deswegen nicht, weil es – leider – familiäre Häufungen gibt. Dennoch, wenn schon nicht in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis oder in der Nachbarschaft, so müsste doch jeder von uns hier und da einem Schizophreniekranken begegnen. Wenn das nicht der Fall ist, so kann das nur einen Grund haben: Stigmatisierung und Diffamierung, Ausgrenzung und Zurückweisung sind auch heute noch so gewaltig, dass die meisten Familien die Krankheit ihres Angehörigen sorgsam verstecken. Und das erschwert die Bewältigung des gemeinsamen Schicksals ungemein.