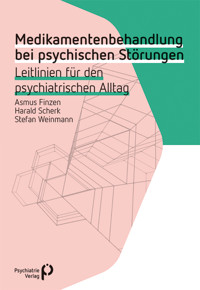Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychiatrie Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Welche normativen Konzepte liegen psychischer Gesundheit und Krankheit zugrunde? Was ist eigentlich »normales« Verhalten? Ausgrenzungsphänomene sind in der Gesellschaft an vielen Stellen zu beobachten. Die Begriffe »normal« und »nicht normal« stehen oft für »nachvollziehbar« und »unverständlich«, aber auch für »seelisch gesund« und »psychisch krank«. Asmus Finzen zeigt auf, wie sehr die Vorstellungen sowohl in der Gesellschaft als auch in psychiatrischen Argumentationen zutiefst von Normalitätsannahmen geprägt sind. Von der Soziologie ausgehend, arbeitet er sich über unser Verständnis von Gesundheit und Krankheit vor zur Psychiatrie – erhellend, gründlich, manchmal angriffslustig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Asmus Finzen
Normalität
Die ungezähmte Kategoriein Psychiatrie und Gesellschaft
Prof. Dr. Asmus Finzen ist Psychiater, Soziologe und Publizist.
Er hat psychiatrische Kliniken geleitet, war ein Pionier der Tageskliniken, hat an der Psychiatrieenquete mitgearbeitet und anschließend ein psychiatrisches Krankenhaus reformiert.
Asmus Finzen
Normalität. Die ungezähmte Kategorie in Psychiatrie und Gesellschaft
Zur Sache: Psychiatrie
1. Auflage 2018
ISBN Print 978-3-88414-939-3
ISBN PDF 978-3-88414-942-3
ISBN ePub 978-3-88414-948-5
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Psychiatrie Verlag, Köln 2018
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne Zustimmung des Verlags vervielfältigt, digitalisiert oder verbreitet werden.
Umschlagkonzeption und -gestaltung: studio goe, Düsseldorf
Lektorat: Uwe Britten, Eisenach
Typografiekonzeption und Satz: Iga Bielejec, Nierstein
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2018
Cover
Titel
Über den Autor
Impressum
Vorwort
Einführung
Diffuse Begrifflichkeiten: normal, merkwürdig, krank
Negative Bewertungen
Alles relativ – Normen und Erwartungen
Gegenreaktionen
Zunehmende Bereitschaft zur Psychopathologisierung
Das Dilemma
Regeln der Mode
Bewertung sozialen Verhaltens relativ
Schussbemerkung
»Normal« ist »gesund«
Normal ist gesund – gesund ist normal
Nicht normal ist krank
Der psychiatrische Krankheitsbegriff
Soziokulturelle Bewertungen
Schwierige Grenzen
Wie erkennen wir »unnormales« Verhalten?
Orientierungsmaßstäbe
Seelische Gesundheit und psychische Krankheit – taugliche Normalitätsmodelle?
Was ist gesund? Was ist krank?
Probleme der Abgrenzung
Subjektives Erleben und »objektive« Maßstäbe
Häufigkeit psychischer Störungen
Medizinische Moden
Werden psychische Störungen häufiger?
Gemessene Häufigkeit: psychiatrische Epidemiologie
Schussbemerkung
Normales Verhalten? Zeichen und Symptome
Ein Symptom macht noch keine Krankheit
Beurteilungsprozesse
Schussbemerkung
Normalität, Befund und Befindlichkeit
Der Psychiater übernimmt – der Befund
Das Instrumentarium
Von Symptomen und Zeichen zum Befund
Schussbemerkung
Die Kolonisierung des Normalen durch Diagnostik und Klassifikation?
Die internationalen Klassifikationen psychiatrischer Störungen
Historische Entwicklung
Alte und neue Unzulänglichkeiten
Klassifikation statt Diagnostik
Medizinfremde Zwecke so mancher Diagnosen
Die neue Unübersichtlichkeit
Die Kolonisierung des Normalen durch die Psychiatrie
Krank zu sein ist normal – auch psychisch krank zu sein
Trügerische Statistik
Auch »Severe Mental Illness« normal?
Die Sprache: Stereotyp »Irrer Mörder«
Tendenziöse Darstellung
Schussbemerkung
Die Rückeroberung des Normalen durch Prävention?
Vor Präventionsutopien sei gewarnt
Ein früher Irrweg der Sozialen Psychiatrie
Früh- und Risikodiagnostik
Ausweitung der medizinischen Zuständigkeit
Schussbemerkung
Die Nagelprobe: forensische Psychiatrie
Die forensische Perspektive als Modell?
»Normale deutsche Männer«
Grenzsetzungen
Schussbemerkung
Das Normale ist das Normale – Schlussfolgerungen
»Rasanter Anstieg« psychischer Krankheiten
Das Diagnosendilemma
Das Normale ist das Normale
Literatur
Zum Inhalt
Vorwort
Das Normale hat kein gutes Image. Es gilt als langweilig. Das Außergewöhnliche, das Bizarre, kurz: das Nichtnormale beherrscht den Diskurs. Die Medien als Repräsentanten der Öffentlichkeit sind voll davon. Wohlverhalten ist keine Meldung wert, Verbrechen schon – selbst wenn es sich auf der anderen Seite der Erde zuträgt. Der Journalistenkalauer: »Hund beißt Mann« ist für den Papierkorb, »Mann beißt Hund« schafft es in überregionale Medien. Das für den Betroffenen tragische Ereignis, dass eine Wildsau einen Jäger erlegt hat, schaffte es in die Abendnachrichten des Fernsehens. Niemand weint den ungezählten erlegten Wildschweinen des letzten Winters auch nur eine Träne nach. Das ist ein triviales Beispiel, aber es zeigt, wie verzerrt unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit oft ist.
Was also ist »das Normale« eigentlich? Legen wir uns damit vielleicht eine Wahrnehmungsschablone zu, die völlig hohl und leer ist? Oder anders: Führt die Kategorie des Normalen vielleicht dazu, dass wir das Vielfältige darin nicht mehr wahrnehmen? Reduzieren wir etwas auf eine diffuse Formel, um vieles Mögliche als Abseitiges diffamieren und es anschließend als »behandlungsbedürftig« erklären zu können? Die Gefahr ist groß, denn bei psychischen Erkrankungen fehlt uns jene Objektivität, auf die sich die somatischen Fächer zumindest meistens beziehen können.
Für den Bestsellerautor und Psychiater Manfred Lütz ist das Normale verdächtig. Im Untertitel seines hunderttausendfach verkauften Buches Irre von 2009 meint er: »Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen.« Das ist natürlich Unsinn. Und es ist übergriffig. Psychiater sind allenfalls Experten für das Unnormale, das Pathologische, das Kranke. Vom Normalen haben sie von ihrer Profession her keine Ahnung, wenngleich gesagt werden muss – und auch darum soll es in diesem Buch gehen –, dass sich Normalitätsvorstellungen bei psychischen Auffälligkeiten erschreckend oft in unsere fachlichen Wahrnehmungen mischen.
Lützs Kollege, der amerikanische Psychiater und Bestsellerautor Allen Frances (2013) ruft im amerikanischen Originaltitel seines Buches – Saving Normal – dazu auf, das Normale zu retten. Auch das ist übergriffig. Wir Psychiater sind, Trüffelschweinen vergleichbar, auf der Suche nach psychisch gestörtem Verhalten zur Selbstdisziplinierung aufgerufen. Damit haben wir viel zu tun. Wir können uns auch in den gesellschaftlichen Diskurs über das Normale einmischen, aber eben nicht als Psychiater, so reizvoll das manchmal auch sein mag.
Wenn überhaupt, sind wir Experten für das Nichtnormale, das Auffällige, das Krankhafte. Das Normale erkennen wir allenfalls durch Ausschluss von etwas Nichtnormalem – wie alle Ärzte. Wenn wir bei unserer ärztlichen Untersuchung auf etwas Normales stoßen, reden wir von einem negativen Befund, abgekürzt protokollieren wir »o. B.« für »ohne Befund«. Das ist entlarvend. Wenn wir aber etwas Krankes, etwas Nichtnormales gefunden haben, sprechen wir von einem positiven Befund. Im üblichen Sprachgebrauch steht »positiv« für etwas Gutes, für etwas, das unter einem positiven Vorzeichen steht. Wenn der Arzt von einem positiven Befund spricht, glaubt der Patient deshalb in aller Naivität an eine positive Botschaft. Aber dahinter verbirgt sich nicht ganz selten eine Diagnose, die geeignet ist, ihn aus der Bahn zu werfen.
Der vorliegende Text stellt meinen Versuch dar, alles dies zu reflektieren. Ich versuche das, obwohl ich als Psychiater vor allem Experte für das Nichtnormale bin. Und weil das so ist, wähle ich den Zugang zu unserem Problem auf dem Weg über meine professionelle Sichtweise als Arzt und Psychiater. Dabei mag die wichtigste Grundregel unseres Berufs hilfreich sein: Wir brauchen einen Anlass, einen Grund, um tätig zu werden. Wir dürfen nicht herumlaufen und Menschen, mit denen wir in Kontakt treten, über die wir lesen oder die wir über das Fernsehen wahrnehmen, nicht diagnostizieren oder klassifizieren. Das ist ein berufsethisches Gebot, das für uns Psychiater noch rigoroser gilt als etwa für den Hausarzt oder den Internisten. Das hilft bei einer offenen Weltwahrnehmung. Denn unsere beruflichen Kategorien sind Konstruktionen, sind Versuche, die Vielfalt menschlichen Verhaltens zu ordnen und überschaubar zu machen.
Ich versuche, mich dem Normalen auf scheinbar paradoxe Weise zu nähern: indem ich diese Konstruktionen der Psychiatrie nutze, um die Grenzen gestörten Verhaltens zu erkunden. Dabei wird rasch klar, dass wir es mit einem System der Bewertung und des Ermessens zu tun haben, gelegentlich unvermeidbar auch mit Willkür. Eindeutigkeit gibt es dabei nur, wenn eine Verhaltensabweichung durch eine schwere psychische Störung bedingt ist. Das ist der Ort für Diagnostik und Klassifikation. Man mag dem entgegenhalten, dass von Objektivität auch dann nicht die Rede sein kann, aber die psychiatrische Diagnostik und Kategorisierung menschlichen Verhaltens wird durch die Systematik psychiatrischer Befunderhebung und Diagnostik nachvollziehbar und transparent. Solche Transparenz fehlt in den meisten anderen gesellschaftlichen Bereichen, wenn es um Normalität und Nichtnormalität geht.
Das überraschendste Ergebnis meines Ansatzes ist die Erkenntnis, dass wir es bei den meisten Menschen, denen wir eine sogenannte psychische Störung attestieren, mit ganz normalem Verhalten zu tun haben. Eine erschreckende Erkenntnis?
Einführung
Im Umgang mit anderen Menschen verlassen wir uns darauf, dass unsere Kommunikationspartner sich »normal« verhalten. Dass wir das können, ist eine Grundvoraussetzung menschlichen Zusammenlebens. Nur wenn das Verhalten und die Reaktionen der Menschen, mit denen wir zu tun haben, berechenbar sind, ist geordnetes soziales Leben möglich. Wenn das nicht der Fall ist, entsteht Chaos. Das bedeutet nicht, dass wir unseren Kommunikationspartner in jedem Fall im ersten Anlauf verstehen müssen. Es bedeutet auch nicht, dass er unsere Erwartungen an ihn in jedem Fall erfüllt. Es bedeutet aber, dass es normalpsychologische Erklärungen dafür geben muss, wenn das nicht der Fall ist. Das kann beispielsweise seine soziale und kulturelle Herkunft sein, seine Gesinnung, seine ideologische Orientierung, sein mangelndes Sprachverständnis, sein Unwille, sich an die geltenden Regeln zu halten, oder seine Persönlichkeit.
Wenn wir den anderen trotz Berücksichtigung seines Hintergrundes und bei redlichem Bemühen nicht verstehen, geraten wir in Schwierigkeiten, sind wir ratlos. Dann nehmen wir zu Erklärungsmodellen Zuflucht, die jenseits des »Normalen« liegen. Dafür bieten sich Vorurteile an, etwa: »typisch Unterschicht«, »typisch Italiener«, »typisch Politiker« oder auch nur »typisch Mercedes-Fahrer«. Wenn das nicht reicht, ist es nicht weit bis zu der Reaktion: »Der ist ja nicht normal!« Oder in der nächsten Stufe: »Der ist ja verrückt!« Damit begeben wir uns aufs kommunikative Glatteis, denn die Klassifikation des Verhaltens anderer Menschen als »nicht normal« oder gar als »verrückt« ist das Ende jeglicher konstruktiven Auseinandersetzung. Dann bleibt nur die Distanzierung, schlimmstenfalls der Ausschluss aus der Bezugsgruppe oder gar aus der Gesellschaft. Das aber ist in mehrfacher Hinsicht problematisch.
Zum einen ist ein solcher Wechsel der Kommunikationsebenen allzu oft nur eine andere Form des Vorurteils. Zum anderen sind »normal« und »nicht normal« ungenaue Begriffe. Sie stehen jeweils für »nachvollziehbar« oder für »unverständlich«. Sie stehen aber auch für »seelisch gesund« oder für »psychisch krank«. Damit werden sie in ihrer Negativform zu Problemwörtern. Sie eignen sich bestens zur Beschimpfung, zur Abwertung, zur Diffamierung und in ihren Steigerungsformen zur Abqualifizierung als »geisteskrank«, eben als verrückt.
Diffuse Begrifflichkeiten:normal, merkwürdig, krank
Nun geschehen in unserem Alltag viele Dinge, die uns auf den ersten Blick als »nicht normal«, die uns als merkwürdig, ja »verrückt« erscheinen. Es kommt natürlich auch vor, dass wir mit Menschen zu tun haben, die in der Tat psychisch krank sind. Aber wenn wir ihnen begegnen, ist unsere erste Reaktion meist keineswegs das Aha-Erlebnis: »Ach ja, ist ja klar.« Im Gegenteil, wir »normalisieren« zunächst einmal. Wir interpretieren das Verhalten des Kranken in normalpsychologischen Kategorien, bis das irgendwann, oft nach Monaten oder Jahren, nicht mehr geht. Wir tun das, eben weil unser soziales Zusammenleben darauf beruht, dass wir uns auf die »Normalität« unseres Gegenübers verlassen können – und wollen.
Die Zeichen einer psychischen Erkrankung sind für den Laien meist kaum erkennbar. Selbst Fachleute denken in ihrem Privatleben auch bei deutlichen Symptomen erst dann an eine Krankheit, wenn die sozialen Umstände es ihnen erlauben (oder verlangen), mit diagnostischem Blick an jemanden heranzutreten (Goffman 1971, S. 151). Außerhalb des medizinischen Rahmens muss schon viel passieren, bis eine solche Situation eintritt.
Stattdessen neigen wir dazu, Menschen für nicht normal, für gestört, ja für krank zu halten, wenn uns das, was sie tun, zugleich unverständlich und verabscheuungswürdig erscheint. Aber Jugendliche, die in der U-Bahn ohne Anlass Rentner zusammenschlagen, oder Hooligans, die Konzerthallen oder Sportstadien kurz und klein schlagen, sind nicht krank. Sie mögen angetrunken sein. Aber das ist etwas anderes: Nein, sie sind böse, aber sie sind normal.
Generäle, die in Bürgerkriegen ihre Landsleute abschlachten lassen, oder in ethnischen Konflikten zu Massenmördern werden, sind ebenso wenig krank wie es die Nazi-Schergen waren, die hinter der Front oder in Lagern millionenfach gemordet haben. Sie waren normal – »ganz normale Männer«, wie ein Buchtitel von Christopher Browning (1993) lautet.
Wenn ein besonders brutales und abstoßendes Verbrechen geschieht, lesen wir immer wieder in der Presse von einem »irren« Täter. Aber wenn die Tat aufgeklärt wird, stellt sich oft heraus, dass es sich um einen »normalen« Täter mit nachvollziehbaren Motiven gehandelt hat. Es scheint fast so, als müssten die sogenannten Normalen einen Abstand zwischen sich und barbarischen, für sie unverständlichen Verbrechen herstellen, weil sie die Vorstellung nicht aushalten, dass so etwas unter bestimmten Voraussetzungen von vielen von uns selbst begangen werden könnte.
Aber so einfach ist das nicht: Allenfalls drei von hundert schweren Straftaten werden wegen schwerer psychischer Krankheiten begangen; bei leichteren Delikten sind es noch weniger. Das muss nicht bedeuten, dass die anderen Täter seelisch gesund sind, aber sie sind auch nicht krank. Zwischen Gesundheit und Krankheit gibt es ein breites Band von Störungen der Befindlichkeit und der Persönlichkeit, ohne dass diese im medizinischen oder juristischen Sinn »Krankheitswert« haben oder gar zur Schuldunfähigkeit wegen psychischer Krankheit führen. Oft bedarf es eines komplexen Sachverständigengutachtens, um zu klären, ob eine schwerwiegende psychische Krankheit vorliegt, die die Einsichts- oder die Steuerungsfähigkeit im Tatzusammenhang beeinträchtigt hat, oder nicht. Meistens wird eine solche ausgeschlossen.
Das hindert manche Medien nicht daran, beim nächsten schlimmen, scheinbar unverständlichen Verbrechen erneut den »geisteskranken Täter« zu bemühen. Schließlich verlangen ihre Leser ein einfaches und plausibles Erklärungsmodell. Die Vorstellung vom nicht normalen, vom »verrückten« Verbrecher ist dazu bestens geeignet.
Negative Bewertungen
Es mag auffallen, dass die Worte »nicht normal« und »verrückt« durchgehend negative Bewertungen implizieren. Das muss aber nicht so sein. Man kann auch »verrückt vor Freude« sein oder übermäßig heiter und freundlich. Das wäre dann unter Umständen nicht normal, aber in diesem Zusammenhang scheint das keine Rolle zu spielen. Verhalten, das nicht normal ist, ist fast immer unverständliches, aggressives oder kriminelles Verhalten, nicht zugewandtes oder nicht menschenfreundliches Gebaren. Deshalb ist es wenig erstaunlich, dass das mit einer psychischen Krankheit assoziierte »nicht normale« Verhalten ebenfalls einer negativen sozialen Bewertung unterliegt. Da solches Verhalten in der Realität selbst von nahen Angehörigen und Freunden vor einer psychiatrischen Diagnose in der Regel nicht erkannt wird, lässt sich das nur als Vorurteil erklären, als Vorurteil allerdings, das allzu oft zu Diskriminierung und Stigmatisierung führt.
Unter diesem Aspekt müssen wir der Frage nach der Normalität noch einmal nachgehen. Zum einen gilt die soziale Unterstellung, dass die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, normal sind – wie bereits betont: eine Grundvoraussetzung für das soziale Zusammenleben. Zum anderen gibt es Situationen, in denen wir das Verhalten anderer Menschen so wenig verstehen, dass es uns schwerfällt, es für normal zu halten, und es uns deshalb als nicht normal erscheint.
Dabei ist es ein Kurzschluss, abnormes und »verrücktes« Verhalten gleichzusetzen. Der Begriff des Normalen als soziale Kategorie ist sehr viel breiter angelegt. Er bezieht sich nicht allein auf seelische Gesundheit. Nicht normal zu sein, ist entsprechend auch nicht gleichbedeutend mit mangelnder seelischer Gesundheit beziehungsweise mit psychischer Krankheit. Dass wir diese Gleichsetzung dennoch vollziehen, hängt damit zusammen, dass andere Formen nicht normalen Verhaltens uns weniger unverständlich erscheinen als »psychisch krankes« Verhalten. Wir können mehr und auch Konkreteres damit anfangen – und wir benennen es entsprechend anders: Ein Dieb ist ein Dieb; ein Heiratsschwindler ist ein Betrüger und so fort.
Allerdings enthalten solche Überlegungen ein Paradox, denn unsere Gleichsetzung von Anomalität, Verrücktheit und psychischer Krankheit erfolgt aufgrund eines kategorialen Missverständnisses. Sie erfolgt auf der Grundlage unserer Vorstellung davon, was psychosoziale Anomalität ist, und nicht aufgrund konkret vorliegender Symptome und Zeichen psychischer Störungen. Wir konstruieren eine solche Anomalität nicht, weil sie wirklich vorhanden ist, sondern weil wir sie zur Erklärung für ein Problem des Zusammenlebens benötigen, das wir anders nicht verstehen und nicht bewältigen zu können glauben.
Damit stehen wir vor einem Dilemma: Wir sind einerseits mit einer Fantasie konfrontiert, mit einem virtuellen Bild von psychischer Krankheit, das mit der Wirklichkeit nichts oder fast nichts zu tun hat, das in den Augen des Betrachters aber dennoch real ist. Und andererseits haben wir es gelegentlich mit realer psychischer Krankheit zu tun, was die Beteiligten aber nicht als solche wahrnehmen oder erkennen (können).
Alles relativ –Normen und Erwartungen
Die klassische Sozialpsychologie (HOFSTÄTTER 1959) unterscheidet ein abgestuftes System sozialer Regeln – sozialer Normen –, die ein unterschiedliches Maß an Verbindlichkeit haben und bei Verletzungen entsprechend abgestufte Sanktionen nach sich ziehen:
• individuelle Freizügigkeit,
• Moden,
• Konventionen, Sitten und Gebräuche,
• tabuiertes Verhalten wie
• kriminell und
• krankhaft,
• unumstößliche Selbstverständlichkeiten.
Im Rahmen des jeweils geltenden Regelsystems kann man ein unbeschwertes Leben führen, wenn man es beachtet. Tatsächlich fällt es den meisten Menschen nicht schwer, die vorgegebenen Regeln einzuhalten. Wenn sie sozial angepasst sind, fühlen sie sich frei. Sie nutzen den Spielraum ihrer individuellen Freizügigkeit mit Umsicht. Sie freuen sich am Modischen, an den Strömungen des Zeitgeistes. Konventionen, Sitten und Gebräuche engen sie nicht ein. Sie empfinden sie eher als Orientierungshilfen. Sie vermeiden Gesetzesverletzungen, besonders aber jenes Verhalten, das von anderen als krankhaft, als nicht normal empfunden werden könnte. Sie halten das, was in ihrem Rahmen als selbstverständlich gilt, schon deshalb nicht für einengend, weil sie sich damit identifizieren. Wer die in seinem Umfeld geltenden Regeln für so plausibel hält, dass er sie nicht einmal reflektieren muss, ist subjektiv ein freier Mensch. Er käme nicht im Traum auf den Gedanken, etwas anderes zu tun, als er darf.
Eine solche Übereinstimmung von Regeln, tatsächlichem Verhalten und subjektivem Empfinden ist ein Merkmal traditionaler Gesellschaften, in denen sich sozialer Wandel eher in Jahrhunderten als in Jahrzehnten vollzieht. Die scheinbare Idylle täuscht allerdings, denn der Toleranzspielraum solcher Gesellschaften ist gering. Die Menschen halten sich an die vorgegebenen Regeln, weil sie das nicht anders kennen, aber wenn sie davon abweichen, sind die Sanktionen oft drakonisch. Individuelle Freizügigkeit in unserem Sinne gibt es ebenso wenig wie wechselnde Moden. Wo sich über lange Zeit nichts verändert, werden Konventionen, Sitten und Gebräuche zu Selbstverständlichkeiten. Und wer diese infrage stellt, rührt an sozialen Tabus. Wir würden heute von Dissidententum sprechen, sofern das bewusst geschieht. Totalitäre Gesellschaften sind ähnlich rigoros, nur dass sie die Einhaltung der von ihnen geschaffenen Regeln erzwingen.
Die traditionale Gesellschaft unterscheidet meist nicht einmal zwischen krankhaftem – nicht normalem – und kriminellem Verhalten. Als verbrecherisch gelten dann beide. Erst im Mittelalter finden sich Ansätze zur Differenzierung zwischen gemeinen Verbrechern und Hexen – mit eher zweifelhaften Folgen für die Betroffenen.
Was selbstverständlich ist, was als Mode angesehen wird, was den Regeln der Konvention und der Sitte unterworfen und was tabuisiert ist, das alles folgt nicht Naturgesetzen. Es variiert von Kultur zu Kultur. Je schneller eine Gesellschaft sich verändert, je vielfältiger – multikultureller – und je nivellierter sie ist, desto breiter sind die Bereiche der individuellen Freizügigkeit und der Mode, desto weniger verbindlich sind Konventionen, Sitten und Gebräuche, desto mehr scheinbare Selbstverständlichkeiten werden infrage gestellt. Allerdings lösen solche Entwicklungen bei einem Teil der Mitglieder Ängste aus: etwa vor dem Zerfall von Kultur und Gesellschaft, vor Regellosigkeit, vor »Überfremdung« oder vor »dunklen Mächten«, die im Hintergrund ihre Fäden spinnen. Solche Ängste führen zu Gegenreaktionen, zu Forderungen nach der Rückkehr zu den alten Werten oder etwa zu einer »deutschen Leitkultur«. Aber kulturelle Entwicklungen lassen sich kaum zurückdrehen. Die Folge ist der Ruf nach gesetzlichen Regelungen oder »härteren« Strafen – mit dem scheinbar paradoxen Ergebnis, dass die Zonen tabuierten Verhaltens in der freizügigen Gesellschaft ausgeweitet werden können. Das betrifft sowohl die Kriminalisierung bestimmter Verhaltensweisen wie die Definition von normalem und nicht normalem Verhalten.
Bei uns in Mitteleuropa sind die sozialen Spielräume an sich recht breit. Die Entwicklung dahin begann im Zeitalter der Aufklärung und kulminierte nach zahlreichen Rückschlägen vorerst in den »permissiven« Siebziger- und Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Unsere Zeit ist gekennzeichnet durch weitgehende Individualisierung, rasch wechselnden Moden, Nivellierung von Konventionen, Sitten und Gebräuchen bis zur Unkenntlichkeit und Infragestellung zahlreicher kultureller Selbstverständlichkeiten innerhalb der pluralistischen »multikulturellen Gesellschaft«. Scheinbar können wir heute tun und lassen, was wir wollen. Aber das stimmt nicht.
Gegenreaktionen
Seit Mitte der Achtzigerjahre sind gesetzliche, auch strafrechtliche Regelungsversuche sozialer Konflikte ausgeufert. Zur Begründung halten Sicherheitsaspekte ebenso her wie der Kampf gegen die »Ausländer-« oder die Jugendkriminalität. Das schlägt sich unter anderem darin nieder, dass die Zahl der angezeigten Bagatelldelikte, die noch vor dreißig Jahren ohne Polizei und ohne Gericht aus der Welt geschafft worden wären, geradezu explodiert ist. Die amtliche Polizeistatistik bildet das in schöner Regelmäßigkeit ab. Die beeindruckenden Zahlen lassen uns übersehen, dass die Häufigkeit tödlicher Gewalttaten in den vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen ist.
Gravierender ist die Tatsache, dass sich die Zahl der Gefängnisinsassen im gleichen Zeitraum etwa in den USA vervielfacht hat. Bei uns hält sich die Zunahme in Grenzen, vor allem weil seither vermehrt Bewährungsstrafen und Geldstrafen ausgesprochen werden – aber auch, weil die Justiz vor bestimmten Delikten kapituliert, etwa Kaufhausdiebstählen oder »Fahrgelderschleichung«.
In diesem Zeitraum hat sich bei uns aber die Zahl psychisch kranker Rechtsbrecher in besonderen Einrichtungen vervielfacht, ohne dass sich die Zahl psychisch kranker Menschen, die Straftaten begehen, erkennbar vermehrt hat! Lediglich die Bewertung hat sich verändert. Auch das ist ein Zeichen erhöhter Sicherheitsbedürfnisse in Zeiten gesellschaftlicher Pluralität.