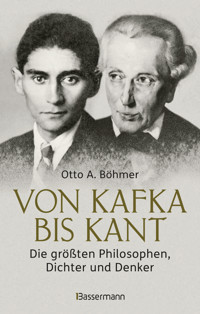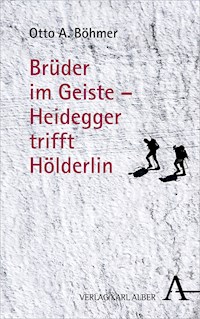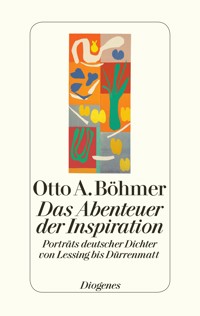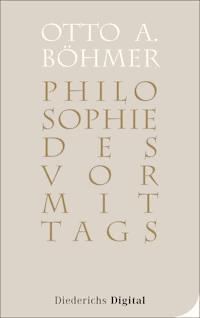Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Faust
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Böhmers Prosa ist wundersame leichte Wehmut und doppelbödige Heiterkeit, ein intellektuelles Vergnügen.« ORF Ein Mann auf der Suche nach sich selbst. Als der Protagonist, Peter Knebel, von Fragen über das Leben und die eigene Identität geplagt, zufällig die Praxis des eigensinnigen Philosophen Dr. Emile Emeyer betritt, ahnt er nicht, dass diese Begegnung sein Denken verändern wird. Zwischen Spaziergängen durchs Gedächtnis, überraschenden Einsichten und feinsinniger Lebensklugheit entfaltet sich ein literarischer Dialog über Bewusstsein, Alter, Selbstüberschätzung – und das Glück, manchmal nicht alle Antworten zu kennen. Mit subtilem Witz, philosophischer Tiefe und poetischer Leichtigkeit erzählt Otto A. Böhmer von der Kunst, das eigene Leben wie ein Werk im Werden zu betrachten – unvollkommen, aber auf eigentümliche Weise wahr. Die Suche nach Sinn im Alter und im Wandel der Zeit und Selbsterkenntnis im Spiegel philosophischer Gespräche »Otto A. Böhmer gehört zu der hierzulande nicht besonders verbreiteten Art des Humoristen ... In Böhmers Texten klingt alles neu und unverbraucht, sorgfältig wahrgenommen, elegant durchdacht. Böhmer gehört zu den wenigen Autoren, die, selbst wenn sie über das Wetter sprechen, bislang Unerhörtes sagen und Entdeckungen machen.« Deutschlandradio
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Otto A. Böhmer
Schlafe, träume, flieg
Roman
Für Christel und Mareike
Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bis alsobald und fort und fort gediehen Nach dem Gesetz, wonach du angetreten. So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen, So sagten schon Sibyllen, so Propheten; Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.
Goethe
Was uns umtreibt, ist nicht die bloße Ruhelosigkeit, ist nicht nur das Ungenügen, das wir an der Welt empfinden, sondern das Wissen von uns selbst. Es spricht uns zu, unaufhörlich; auch im Schlaf gibt es keine Ruhe und durchzieht uns mit Träumen, die manchmal den Tag über noch anhalten. Wir leben, und wir wissen, dass wir leben.
Das ist das Problem, das wir haben, und die Zumutung, mit der wir umzugehen lernen, ohne sie in ihrem Grunde begreifen zu können. Das Bewusstsein, breit hingelagert über die unendlich vielen Köpfe, macht jeden Einzelnen von uns, macht jedes kleine Ich zu einem Problemfall, an dem Selbsttherapie zu üben ist. Glaubt das Ich, sich gefunden zu haben, darf es seine Selbstbestimmung versuchen; eine Aufgabe, die dem Bemühen des Ungeübten gleichkommt, im schnellströmenden Wasser Fische mit den bloßen Händen zu fangen. Man kann dabei fündig werden, für überraschende, glückliche Momente; eine Beschäftigung, die auf Solidität und auf Dauer angelegt ist, lässt sich daraus nicht gewinnen. Das Bewusstsein, das uns als Begleiter gegeben wurde, werden wir nicht los, was auch bedeutet, dass wir von unserem Dasein wie aus einer Geschichte erfahren, die wir uns ständig neu erzählen müssen – selbstredende Mutmaßungen über eine Existenz, die sich vermutlich nur abstellen lässt, wenn das kleine Ich jenen großen Schritt wagt, der als Ausweg gilt, ohne dass mit ihm eine Resultats- oder gar Erlösungsgarantie gegeben werden könnte: die eigenmächtige Beförderung vom Leben zum Tode.
Das Ich, mit dem wir umgehen, mag gelegentlich Großes leisten – gemessen an seiner natürlichen Ausstattung ist und bleibt es kleinlich bis klein. Das Wissen, das es erwirbt, hält sich am Leben durch den produktiven Gegensatz von Subjekt und Objekt, den es auszuhalten gilt, will man der zulässigen Wahrheit nicht mehr auferlegen, als sie zu leisten imstande ist. Für den Menschen erweist sich sein Bewusstsein als ein Überraschungen aufbietendes Geschenk, das zwiespältige Gefühle hinterlässt: Zum einen eröffnet es ihm den Zugang zur Welt, zum andern macht es ihm deutlich, dass er von den Gegenständen seines Wissens getrennt bleiben wird. Das Ich arbeitet sich an einem lebenslangen Suchspiel ab, das einer Identität gilt, die nicht herzustellen ist. So erweist sich das wackere und in sich durchaus berechtigte Bestreben, zu sich selbst zu finden, letztlich als zweifelhaftes Vergnügen, mit dem man die Zeit hinbringen kann; am Ende hat die Selbsterfahrung jedoch ihre Bestimmung nicht im Gelingen, sondern im produktiven Ungenügen: Das kleine Ich trägt dem Rechnung, es ergeht sich in der fortwährenden Arbeit seines Bewusstseins und nimmt dafür existentielle Erschöpfung in Kauf. Wirkliche Selbstfindung, das heißt Ankunft und Heimkehr in sich selbst, wird dem Ich nur selten gewährt; eher schon Glücksmomente, Ahnungen, Einsichten, welche eine wunderbar-trügerische Besinnung erlauben, die uns wichtig sein sollte – lässt sie doch, im bedachten Augenblick, aufscheinen, was, unter dem unendlichen Himmel, das Gewährende und das Menschenmögliche ist. – Was es sein kann, das Ich, wenn es sich selbst sucht und den Menschen findet, davon soll hier erzählt werden. Es ist, so wahr ich hier sitze und mit Ihnen auf bessere Zeiten hoffe, eine wahre Geschichte.
»Wir werden angeweht von einem fremden, vertrauten, uns einleuchtenden Geist. Es gibt im glücklichsten Fall einen Kurzschluss wie in der Liebe zwischen zwei Individuen, die bisher ganz gut ohne einander ausgekommen sind und sich auf einmal fragen, wie sie das so lange geschafft haben. Noch in den scheinbar beliebigsten Abschweifungen und düstersten Assoziationen spüren wir eine Bezauberung, eine Zuversicht, die Fatalität des Lebens durch deren Formulierung besiegen zu können.« Brigitte Kronauer
IWer wir waren, wer wir sind
Später vielleicht
Ich bin, aber wir haben uns nicht. Also werden wir. Diesen einleuchtenden Satz des Philosophen Ernst Bloch habe ich lange beherzigt, beherzige ihn, auf meine Art, immer noch, aber dazwischen lag eine knapp bemessene Zeit, in der ich mich auf die Suche nach mir selbst begab und dabei unwesentlich älter wurde, was für mich ein Problem bedeutete. Für andere jedoch nicht, wie es schien, die mir gelegentlich meinen Tag mit Bemerkungen wie »Sie haben sich aber gut gehalten!« aufhellten. Noch besser war, wenn beim Bäcker eine neben mir stehende Dame reiferen Jahrgangs zu der Verkäuferin sagte: »Der junge Mann ist vor mir dran!« Ich schaute mich um, ungläubig, aber kein Zweifel, ich musste gemeint sein, denn es war kein anderer da. Das Alter machte mir zu schaffen, ich wollte es, wie die meisten, nur nicht so recht wahrhaben. Als ich einen runden Geburtstag zu begehen hatte, bat ich darum, von Beileidsbekundungen abzusehen. Ich zog mich eine Woche auf eine Nordseeinsel zurück, wo ich, sagte mir die alte Frau Erinnerung, als junger Mann einigermaßen glücklich gewesen war. Lang, lang ist’s her, dachte ich, aber nur auf dieser Insel, lief den menschenleeren Strand ab und hatte dabei den jungen Mann von damals an meiner Seite, der kaum mehr war als eine verhuschte Gestalt, auf die sich eine bekannte Redewendung anwenden ließ: Kannst du vergessen. Heute weiß ich, dass Selbstsuche die besondere Gunst der Umstände braucht, eine hochgradige Empfänglichkeit und Neugier, die auch den Kreisgang in Kauf nimmt und sich vom Alter nicht mehr beeindrucken lässt als unbedingt nötig. Wenn alles stimmt, kann man sich selbst finden – eine beglückende, fast zeitlos anmutende Gewissheit, in der der Verzicht so schwer wiegt wie das Gefühl, angekommen zu sein. Dass man bei alledem nicht jünger wird, wiegt weniger schwer, als man meinen sollte – es kommt, wie bei so vielen Dingen des Lebens, nur auf den Blickwinkel an.
An einem mäßig schönen Frühlingstag stand ich vor zwei, drei Jahren an einem jener fabelhaften Anwesen, die in Hamburg hoch über dem Elbufer liegen und auf Geheimnis und Wohlstand verweisen. Draußen, an der Grundstücksmauer neben einer großen, schmiedeeisernen Tür, die wirkte, als liege sie in der Einsichtsschneise eines verborgenen Beobachters, befand sich ein Schild: Dr. Emile Emeyer, Lebensberatung – Alterstherapie – Letztes Bedenken. Darunter in deutlich kleinerer, etwas verschämter Schrift: Selbstzahler. Ich blieb stehen, überlegte, schaute zum Himmel, es sah nach Regen aus. Die Tür, die mehr ein Tor war, stand einen Spalt weit offen; ich ging hinein. Das war mein Glück oder mein Fehler, wie man’s nimmt. Durch einen parkähnlichen Garten mit gebeugten, leise seufzenden Bäumen ging ich, es war wie in einem Erkenntnismärchen. Kein Mensch weit und breit, auch kein Hund, der anschlug; selbst die Vögel waren hier auf andächtige Ruhe bedacht. Drinnen im Haus, auch dort stand die Tür einen Spalt weit offen, ging ich über eine teppichbewehrte Treppe in den ersten Stock. Ich betrat einen als Wartezimmer ausgewiesenen Raum, der schon deshalb auffällig war, weil sich dort kein Mensch aufhielt und statt der betagten Lesemappen-Illustrierten, die man aus sonstigen Praxisräumen kennt, gelbe Reclam-Heftchen auf einem Tisch lagen, allesamt philosophische Titel, die mir, das sei zu meiner Ehrenrettung gesagt, mehr oder weniger bekannt vorkamen. Ansonsten aber war ich allein, allein mit den Geistesgrößen und weiteren Büchern, die an der Wand in Regalen untergebracht waren. Ich setzte mich in einen der schweren Ledersessel, die herumstanden; eigentlich sollte ich lieber gehen, dachte ich noch, aber da war es zu spät. Der Hausherr stand vor mir, Emile Emeyer, den ich, falls ich weiterhin Glück habe und es mir nicht so ergeht wie ihm, in diesem Leben nicht mehr vergessen werde. Er sah so aus, wie man sich, einem bewährten Klischee folgend, den verdienten Philosophen vorstellt: Graues, reichlich fallendes Haupthaar schmückte einen massiven Kopf unschätzbaren Alters; er spähte durch eine randlose Brille, trug braune Cordhosen und eine feuerrote Weste, am Kinn wuchs ihm ein kleiner Spitzbart, den ich auf Anhieb vollkommen lächerlich fand. »Entschuldigen Sie«, sagte ich, »ich glaube, ich bin versehentlich in Ihr eindrucksvolles Haus geraten. Es ist wohl besser, wenn ich wieder gehe.«
»Nichts geschieht versehentlich«, sagte er und lächelte. Seine Stimme hatte es in sich, ich hatte dergleichen noch nicht gehört. Einschmeichelnd klang sie, dunkel, ja, so albern es sich anhört: fast ein wenig verführerisch. Der Mann hätte aus einem Telefonbuch vorlesen können, und es wäre wie eine behutsame, tief nach innen reichende Anzüglichkeit gewesen. Er gab mir die Hand. »Emile Emeyer«, sagte er, »ich bin Philosoph und betreibe diese Praxis.«
»Eine Goldgrube, nehme ich an«, sagte ich.
»Eher ein Geheimtipp. Wenn ich ehrlich sein soll: Sie sind der erste Klient.«
»Seit wann?«
»Seit Wochen.«
Diese Antwort war nicht nur entwaffnend, sie überzeugte mich. Ich blieb. Warum, wusste ich damals nicht, es war eine spontane Entscheidung, die, meine ich heute, ihre Richtigkeit hatte. Emeyer führte mich in sein Sprechzimmer, das zugleich sein Wohnzimmer war. Wir traten hinaus auf den Balkon. Der verwunschene Garten ging hinter dem Haus weiter, senkte sich unmerklich ab; über alte Baumwipfel hinweg sah man einen freigeschlagenen Himmel und den glitzernden Strom. »Dafür, dass Ihnen die Leute nicht gerade die Bude einrennen und Sie mit den Nöten anderer vermutlich nur kärglichste Einkünfte erzielen, wohnen Sie einigermaßen privilegiert«, sagte ich. »Respekt.«
»Ich habe geerbt«, erklärte er. »Auf den gewöhnlichen Verdienst bin ich nicht angewiesen.«
»Schön für Sie. Das hat man selten.«
Er verwickelte mich dann in ein Gespräch. Geschickt machte er das, denn eigentlich wollte ich ja längst wieder gegangen sein. Er aber fragte nach, er sei neugierig von Berufs wegen, aber seine Neugier sei anders, dezenter, sie respektiere die Person, ja, sie diene dazu, die Person zu finden und ihr zur vollen Einsichtnahme zu verhelfen. »Erzählen Sie mir, wer Sie sind«, sagte er. »Ich höre Ihnen zu. Bedingungslos.«
»Später«, sagte ich. »Später vielleicht.«
Natürlich hätte ich ihm aus meinem Leben berichten können, aber in meinem Leben überwiegen die unwichtigen Ereignisse, warum soll es mir da besser ergehen als anderen. Ich hatte die ungünstige Erfahrung gemacht, dass mir die eigene Person im Erzählen abhandenkam. Sie duckte sich weg unter den Worten und blieb in Deckung. Wenn ich hingegen schwieg und mir eine gewisse Andächtigkeit gönnte, so als lebte ich auf Bewährung und mir selbst zur Feier, war es besser. Dennoch wurde man immer wieder aufgestört, hatte das Gefühl, dass immer noch etwas kommen könnte. Zur Sicherheit trägt das nicht bei. Dennoch glaubte ich, vor allen Befragungen ein vergleichsweise sicheres und feststehendes Selbstbewusstsein zu haben.
»Wenn man sich selbst finden will, muss man sich zuvor verlieren«, sagte Emeyer. »Das Ich entdeckt sich erst dann, wenn es auf Freigang ist und seinen Weltinnenraum verlässt.«
»Versteh’ ich nicht.«
»Ich kann es auch ein wenig zackiger ausdrücken, zeitgemäßer, wenn Sie so wollen. Selbstfindung ist kein Solotrip. Sie müssen die anderen mit einbeziehen, das Menschsein an sich.«
»Dunkel ist Ihrer Rede Sinn.«
»Sie werden es verstehen, wenn Sie mir Gelegenheit geben, Ihnen ein wenig auf die Sprünge zu helfen.«
»Das machen Sie doch nicht umsonst«, sagte ich misstrauisch. »Sie haben seit hundert Jahren keinen Patienten mehr gehabt, und ich soll es jetzt ausbaden.«
»Wie gesagt: Ich bin auf den gewöhnlichen Verdienst nicht angewiesen. Wir werden ein Gespräch führen, und danach bekommen wir beide, was wir verdienen. Außerdem nenne ich die Menschen, die zu mir kommen, nicht Patienten, eher schon: Klienten. Am liebsten aber sage ich, dass sie meine Gäste sind.«
»Gästen bietet man etwas an«, sagte ich. »Wenn ich Ihr Gast werden soll, sollten Sie mir schleunigst ein stärkendes Getränk offerieren. In Ihrem Haus lastet viel Wissen; dadurch staubt es, und man bekommt heftigen Durst.«
So kam es, dass ich in die Lebensberatungspraxis des Dr. Emile Emeyer geriet und dort zu einer Selbstfindung angeleitet wurde, die ich nicht wollte. Ich habe es nicht bereut, es war mir von Nutzen und hat mich auf andere Gedanken gebracht; mehr kann man dazu, vorab, wohl nicht sagen – der Umgang mit sich selbst bleibt ein prekäres Vergnügen.
Wir vereinbarten, dass ich zunächst einmal die Woche bei ihm erscheinen sollte; er mache nur Vorschläge, biete Überlegungen an, sagte Emeyer, es sei an mir, daraus meine eigenen Schlüsse zu ziehen. Zudem gebe es keinerlei Zwänge; ich müsse keinen Vertrag unterschreiben, mich zu nichts verpflichten. Wenn ich genug hätte, könnte ich gehen.
»Einfach so?«
»Einfach so.«
»Gut, ich habe genug!«, sagte ich. Das war zu Beginn der ersten Stunde, als Emeyer mich in einen tiefen Ledersessel gesetzt hatte, von dem aus ich einen feinen Blick über den Garten zum Strom hatte, der sich an diesem Tag nur grau und träge dahinwälzte. Überhaupt war der ganze Tag grau, keine Konturen, keine Farben, die Menschheit sah aus wie die verbiesterte alte Frau, die ich beim Aussteigen aus der S-Bahn versehentlich angerempelt hatte, woraufhin sie mich mit einem osteuropäisch klingenden Fluch bedacht hatte, der in mir nachschwang. Vielleicht fühlte ich mich auch ein wenig schuldig, weil ich der alten Dame daraufhin den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt hatte.
»Bitte«, sagte Emeyer.
»Bitte was?«
»Sie dürfen gehen, wenn Sie genug haben.«
»Ein Scherz«, sagte ich. »Ein kleiner Scherz zur grauen Stunde. Ich habe möglicherweise einen etwas seltsamen Humor.«
»Allerdings«, sagte er. »Ich möchte zu Beginn unserer Gespräche ein Bild des Menschen entwerfen, wie ich ihn sehe. Es dient dazu, realistisch zu bleiben, die Ansprüche nicht zu hoch anzusetzen. Die Selbsterfahrung nämlich hat eine feindliche Schwester, die Selbstüberschätzung. Mit ihr wollen wir nichts zu tun haben.«
»Wollen wir nicht«, sagte ich und unterdrückte ein Gähnen.
»Es stört Sie hoffentlich nicht, wenn ich im Verlauf unseres Gesprächs ein wenig umhergehe. Ich halte es da mit Nietzsche, dem die besten Gedanken, behauptete er zumindest, auf strammen Märschen kamen. Gelegentlich darf ich auch aus dem einen oder anderen Buch zitieren, möglicherweise sogar aus einem eigenen. Und, bitte sehr: Es mag so scheinen, als wolle ich, ein begründet einsamer Mensch, hier nur ausgedehnte Monologe halten. Das ist in keinem Fall beabsichtigt. Ich diene Ihnen als Anreger, als Gedankenanimateur; unterbrechen Sie mich, wann immer Ihnen danach ist.«
»Laufen Sie, zitieren Sie«, sagte ich, »aber fangen Sie endlich an.«
»Also gut«, sagte Emeyer. Er legte los, redete auf mich ein, mit dieser Stimme, die nicht nur ansprechend, sondern schlaffördernd war. Ich bin dann wohl ein wenig eingenickt, hatte aber trotzdem ein gutes Gefühl dabei, weil ich wusste, dass der Herr es den Seinen im Schlafe gibt. Der Himmel riss auf, es wurde heller. Das Licht hatte es eilig, überzog Land und Strom. Ein Vogel setzte sich auf das Balkongeländer und schaute nachdenklich zu mir herein.
Emeyer beendete seine Wanderung und setzte sich, er war etwas außer Atem. »Die Bekenntnisse zur Gegenwart, die uns abverlangt werden, haben sich als nützlich erwiesen«, sagte er. »Dennoch macht sich, mit zunehmenden Jahren, eine stille, in Maßen sogar gewinnbringende Vergangenheitslastigkeit in unserem Denken breit. Sie hat mit der Erinnerung zu tun, mit dem, was von einer unentwegt vorbeiziehenden Gegenwart bleibt, auf die wir uns einlassen müssen wie pflichtbewusste Überlebenskünstler. Einer meiner Hausheiligen, der Philosoph Schopenhauer, schreibt: In der Vergangenheit hat kein Mensch gelebt, und in der Zukunft wird nie einer leben, sondern die Gegenwart allein ist die Form alles Lebens, ist aber auch sein sicherer Besitz, der ihm nie entrissen werden kann. Die Gegenwart ist immer da, samt ihrem Inhalt: beide stehn fest, ohne zu wanken; wie der Regenbogen auf dem Wasserfall … Wir können die Zeit einem endlos drehenden Kreise vergleichen: die stets sinkende Hälfte wäre die Vergangenheit, die stets steigende die Zukunft; oben aber der unteilbare Punkt, der die Tangente berührt, wäre die ausdehnungslose Gegenwart: wie die Tangente nicht mit fortrollt, so auch nicht die Gegenwart, der Berührungspunkt des Objekts, dessen Form die Zeit ist, mit dem Subjekt, das keine Form hat, weil es nicht zum Erkennbaren gehört, sondern Bedingung alles Erkennbaren ist. Oder: die Zeit gleicht einem unaufhaltsamen Strom und die Gegenwart einem Felsen, an dem sich jener bricht, aber nicht ihn mit fortreißt.«
Flach auf den Boden
Bevor ich meine zweite Stunde bei Emeyer antrat, hatte ich schwer zu kämpfen. Eine üble Nacht steckte mir in den Knochen, ich fühlte mich wie gerädert. Am Morgen, der so grau war wie meine Gedanken, hatte ich mit Selbstfindung nichts im Sinn, eher schon wollte ich mich verlieren, und zwar auf immer. »Das trifft sich gut«, sagte Emeyer, der unanständig guter Laune war, obwohl ich ihn gleich zur Begrüßung barsch ersucht hatte, mich nicht zu belästigen. »Bevor Sie sich nämlich finden können, müssen Sie sich verlieren, das sagte ich Ihnen, glaube ich, schon in unserer ersten Stunde. Erinnern Sie sich?« »Nein«, sagte ich. »Aber da ich mich nun doch dazu aufgerafft habe, zu Ihnen zu kommen: Walten Sie Ihres Amtes.«
Ich hatte wieder im Sessel Platz genommen, schaute hinaus in den Garten. Die Elbe war nicht zu sehen.
»Sie sollten mal Ihre Fenster putzen, Meister«, sagte ich. »Man sieht ja gar nichts.«
»Das höchste Interesse des Menschen, wusste schon der Philosoph Johann Gottlieb Fichte, ist das Interesse für den Menschen«, sagte Emeyer und nahm seine Wanderung auf. Wie in der ersten Stunde ging er auf und ab, umkreiste den Tisch, wanderte an den Buchreihen entlang, die alten Dielen knarrten. Eigentlich hätte er mich nervös machen müssen, aber das Gegenteil war der Fall. Der Mann hatte eine ausgesprochen beruhigende Wirkung auf mich. Ich schloss die Augen.
»Nicht einschlafen«, sagte er.
»Ich bitte Sie«, sagte ich, »ich und einschlafen, das ist ein Widerspruch in sich. Sie sind mein Hörbuch, und ich höre Ihnen zu.«
»Im Menschen arbeitet das Bewusstsein«, sagte Emeyer, »es arbeitet unaufhörlich, kennt keine Ruhe, murmelt sogar noch im Schlaf vor sich hin, der uns mit Träumen und dunklem Zuspruch versorgt. In seinem Bewusstsein, genauer: in seinem Selbstbewusstsein macht sich der Mensch klar, wer er ist; er errichtet eine Identität, die indes so klar nicht ist. Wir fühlen uns mal so und mal so, wir sind stimmungs- und launenabhängig, wir deuten die Erinnerungen, die wir mit uns herumtragen, im Licht unserer merkwürdig schnell wechselnden Bewusstseinszustände. Ist der Mensch also nur ein Ensemble von Stimmungen, ein Durchlauferhitzer für Gefühls- und Gedankenprozesse, die, ohne dass wir das eigentliche Verursacherprinzip dafür kennen, aus dem Unterbewusstsein aufsteigen, für maximal drei Sekunden im Fenster der Bewusstheit erscheinen und dann wieder absinken, um entweder in Vergessenheit zu geraten oder, bei Bedarf, als persönlich geprägte Erinnerungen präsent zu werden?«
»Ja«, sagte ich schläfrig. »Das ist er, der Mensch, ein Durchlauferhitzer. Bei mir allerdings läuft im Moment nicht allzu viel durch, und besonders heiß wird es auch nicht.«
»Wenn dem so wäre«, sagte Emeyer, »hätten alle Sinn- und Selbstsucher einen wahrhaft schweren Stand; sie würden nur einem Verflüchtigungskünstler nachjagen, den wir Ich nennen. Und doch glaube ich, dass es ein solches Ich gibt, eine Identität, eine Persönlichkeit, in der wir uns finden, vor allem auch: wiederfinden können, ohne uns an uns selbst zu überheben – ein Ich, das aus dem schönen Schein der uns überlassenen Momente lebt und daraus sein Wissen und sein Beharrungsvermögen inmitten eines steten Wechsels gewinnt. Von ihm wollen wir im Folgenden reden: vom selbstbewussten, bescheidenen Ich, das sich an sich selbst erfreut und dennoch nicht wichtiger nimmt, als es ist. Zu diesem Ich gibt es einen Weg, den jeder begehen kann – jeder, der an sich selbst interessiert ist, wobei die persönlichen Umstände, die der Einzelne um sich versammelt hat, erst später ins Bedenken geraten – dann nämlich, wenn der Weg der Selbsterkenntnis bereits beschritten ist.«
Ich dachte an den alten Spruch, den jeder mal zu hören bekommt: Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ich hatte diesen Spruch besonders oft zu hören bekommen, so dass ich eines Tages beschloss, mich nicht mehr verbessern zu wollen, womit mir auch das Thema Selbsterkenntnis erledigt schien. Ich war nicht traurig darüber, allerdings auch nicht sonderlich glücklich. Wovon ich eine Ahnung hatte, war, dass es Geheimnisse gibt, die besser ungelöst bleiben.
»Versuchen wir also zu diesem Ich vorzudringen, das uns ebenso vertraut wie fremd erscheint«, sagte Emeyer. »Ich wähle dafür einen Ausgangspunkt, den mein Kollege, der britische Psychologe David Fontana, so beschrieben hat: Jeder von uns lebt in zwei Welten. Die eine Welt ist ganz augenfällig. Schauen Sie sich um, und Sie sehen sie. Nehmen Sie wahr, wie vertraut sie ist, wie wohlbekannt. Bemerken Sie, wie Sie jedem Gegenstand, den Sie sehen, einen Namen geben können … Beobachten Sie, wie Sie Menschen unterteilen können in Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, Alte und Junge, Freunde und Fremde, geliebte Menschen und Bekannte, Hell- und Dunkelhaarige, Landsleute und Ausländer. Nehmen Sie wahr, wie leicht Dinge sich in Kategorien untergliedern, Aufschriften bekommen und verständlich und voraussagbar werden. Die Welt, die unseren Sinnen begegnet, ist die meiste Zeit unseres Lebens klar und begreifbar; sie ist voller Formen und Geräusche, voller Gerüche und Empfindungen, die für uns definieren, was es heißt, lebendig zu sein. Darf ich fragen, warum Sie so süffisant lächeln?«
»Bitte um Nachsicht«, sagte ich, »aber besonders lebendig ist es in diesem Hause ja wohl nicht.«
»Sehen Sie es so«, sagte Emeyer. »Ich bediene die Theorie. Die Theorie ist die höchste Form der Praxis. Das gilt nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für das Leben selbst. Und eine vertraut anmutende Momentaufnahme des Lebens ist es, von der wir ausgehen. Der Welt, die wir sehen, steht allerdings ein anderer Aspekt gegenüber, der seinen Spielraum im Innern, in uns selbst hat: Da ist noch eine andere Welt, bisweilen ebenso lebendig, doch weit weniger leicht zu beschreiben und zu verstehen. Eine innere Welt der Gedanken und Gefühle, eine Welt der Vorstellungen und Träume, eine Welt, die ein schattenhaftes ›Ich‹ enthält; eine geheimnisvolle Person, die wir nie wirklich sehen, die aber in der Lage zu sein scheint, die äußere wie die innere Welt wahrzunehmen und zu beobachten. Eine Person, deren Existenz wir gelegentlich sogar vergessen können, wenn wir beispielsweise vollkommen in einer Tätigkeit aufgehen, uns in einer Beethoven-Symphonie verlieren, oder die fest auftaucht, indem wir erneut beginnen, unsere Gedanken zu denken, oder indem wir morgens erwachen und wieder zu uns kommen.«
»Morgens erwachen und zu sich kommen«, sagte ich. »Das ist harte Arbeit, Meister.«
»Wem sagen Sie das. Darf ich weitermachen? Danke. Innen- und Außenwelt kommen im Bewusstsein zusammen, das der eigentliche Ort jeder Erfahrung ist«, sagte Emeyer, »ich denke, Sie können mir da folgen. Diesen Ort können wir auch als Geist bezeichnen: Geist ist ein nützlicher, allgemeiner Begriff, der all das umfasst, was in unserer inneren Welt geschieht, auf der Ebene des Bewussten wie des Unbewussten. Unser ›Geist‹ besteht (unter anderem) aus unseren Gedanken, Gefühlen und Erinnerungen. Es sind die Bilder und Vorstellungen, die wir visualisieren, die Lieder, die wir uns selbst singen, der Sinn, den wir der äußeren Welt geben; – unser Geist ist das Bewusstsein, das wir von unserer eigenen Existenz haben, die Hoffnungen und Träume, die wir für die Zukunft hegen, die Moralvorstellungen und Werte, die wir in uns tragen und nach denen wir leben, die Erwartungen, die wir haben, und die Forderungen, die wir an uns und andere stellen. Und gleichzeitig reicht er in jene tiefen, verborgenen Bereiche, die jenseits der unmittelbaren Bewusstheit liegen und die dennoch unsere Gedanken, unsere Handlungen und Gefühle tiefgreifend beeinflussen. Der Geist ist tatsächlich das innere magische Theater, auf dessen Bühne wir unsere Lebensdramen inszenieren … Wie aber lässt sich der Geist begreifen, wie kommen wir an ihn heran oder, noch besser, wie kommen wir, uns selbst befragend, in ihn hinein?«
»Genau das wollte ich schon immer wissen«, sagte ich. »Wie komme ich in meinen hochgeschätzten Geist hinein? Wichtiger aber ist: Wo sind die Notausgänge?« Vor meinen geschlossenen Augen war es heller geworden, das Grau löste sich auf, vorsichtig kam die Helligkeit zum Vorschein. Die Wirklichkeit musste nachziehen, sie ergab sich dem besseren Wissen. Als ich die Augen aufschlug, sah ich Emeyer, der mich an jemanden erinnerte – ich wusste nur nicht, an wen. Er beugte sich zu mir herab, ich hätte ihn, kleine Auflockerung der Selbstfindung, beim Bart ziehen können. Beim Bart des Propheten, dachte ich und freute mich, dass es wenigstens eine Konstante in meinem belanglosen Leben gab: meine Einfältigkeit. Draußen, im sich lösenden Dunst, trat der Garten hervor, der Strom lag schon im Licht.
»Bis jetzt war ich möglicherweise ein wenig zu theoretisch«, sagte Emeyer, »aber jetzt wird es praktisch. Wir wollen uns einer besonderen Anstrengung unterziehen.«
»Wollen wir nicht«, sagte ich.
»Keine Angst, Sie werden es überleben. Es geht nur um das Hineinhören in sich selbst, um eine Versenkung in das eigene Ich, die wir auch als Meditation kennen. Meditation schafft einen Ruhe- und Vergegenwärtigungsraum, der wie das Vorspiel, ja sogar wie das Konzentrat glücklicher Vergessenheit anmutet. Bevor wir uns einem solchen Meditationsversuch unterziehen, möchte ich jedoch fürs Protokoll noch einmal festhalten, was unser gegenwärtiger Erkenntnisstand besagt: Uns selbst zu erkennen, zu wissen, wer wir sind, heißt, unseren Geist auf beiden Ebenen zu erkennen, auf der bewussten und der unbewussten Ebene … Dieses Wissen ist ein unmittelbares Innewerden dessen, was unser Geist tatsächlich ist. Eine Art des Erkennens, welche die – auf den ersten Blick unmögliche – Aufgabe umfasst, beides zugleich zu sein, der Geist, der erkannt wird, und der Geist, der erkennt. Eine Art des Erkennens, die zunächst so undenkbar zu sein scheint wie die Aufforderung, uns selbst in die Augen zu sehen …«
»Schau mir in die Augen, Kleiner«, sagte ich. Emeyer schüttelte den Kopf. Konnte es sein, dass ich ihn, den mit Abstand geduldigsten, klügsten und verständnisvollsten Menschen in diesem Raum, schon ein wenig nervte?
»Bleiben wir im Bild«, sagte er, »wir versuchen, uns selbst in die Augen zu sehen. Dies ist das Wesen der Meditation, die sich indes weniger über Definitionen als über den bildhaften Vergleich erschließen lässt:
Meditation sei eine Lotusblume, die aus ruhigem Gewässer emporwächst; oder ein Mönch oder eine Nonne, in der Stille hoch aufragender Berggipfel sitzend; oder eine Baumreihe, die sich gegen den Horizont abhebt; oder eine Frau, die voller Frieden inmitten einer geschäftigen Stadt sitzt, oder ein Wanderer, der auf einem Pfad dahinschreitet, der sich zwischen den Bäumen eines großen Waldes dahinschlängelt; oder die ruhigen Töne einer Flöte an einem Sommerabend … Und noch eine abschließende Metapher: Wie die Welt aussieht, wenn Sie still stehen und Sie all das sehen, was sie ist, statt sie durch Ihre ständigen Bewegungen zu verschwommener Wirrnis zu machen – das ist Meditation.«
»Schon gut«, sagte ich. »Fangen Sie an, Meister. Meditieren Sie.«
»O nein«, sagte Emeyer, »Sie haben mich falsch verstanden. Wir werden zusammen meditieren.«
»Auf keinen Fall«, sagte ich. »Sie können mir viel erzählen, aber ich mache nicht alles mit.«
»Seien Sie nicht so verbohrt, geben Sie mir und sich eine Chance. Meditation ist nicht die Fortsetzung der Philosophie mit gymnastischen Mitteln, sondern nur eine nützliche Entspannungsübung. Die traditionelle asiatische Meditationshaltung, der Lotussitz, volkstümlich auch Schneidersitz genannt, vor dem Sie mir, deute ich Ihr Abwehrverhalten richtig, Angst zu haben scheinen, vermutlich weil Sie vom jahrelangen Untätigsein arg steif geworden sind – er bedeutet kein Muss für das Meditieren; man kann im Prinzip in jeder Körperhaltung die Sammlung und Konzentration seiner Gedankenkräfte versuchen, die, richtig angewendet, zu wohltuenden Ergebnissen führen. Also, sind Sie bereit?«
»Nein«, sagte ich.
»Bitte!«
Nun gut, ich lasse ja mit mir reden und bin besser als mein Ruf, weshalb ich dann doch tat, was Herr Dr. Emeyer von mir verlangte: »Legen Sie sich flach auf den Boden. Schließen Sie die Augen und richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Atem. Sind Sie ganz konzentriert, dann gleiten Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit von den Zehen aufwärts, und suchen Sie Ihren Körper nach Spannungsherden ab. Haben Sie einen entdeckt, sagen Sie still: ›Loslassen‹, und fühlen Sie, wie die Muskeln sich entspannen. Stellen Sie sich nun vor, dass Sie in einem hohen Gras oder an einem Sandstrand liegen (was Ihnen angenehmer ist). Verstärken Sie die Vorstellung, indem Sie sich das Gras oder den Sand, auf dem Sie liegen, genau vorstellen. Lauschen Sie den Wellen oder den Vögeln. Hören Sie das Flüstern des Windes. Betrachten Sie den blauen, unendlichen Himmel über Ihnen. Bei jedem Ausatmen wiederholen Sie: ›In Frieden schweben.‹ Fühlen Sie, wie Ihr Körper mit jeder Wiederholung immer leichter und leichter wird, bis er so leicht geworden ist, dass Sie in das Blau über Ihnen hineinzuschweben scheinen. Erleben Sie unermesslichen Frieden, als lösten Sie sich in den Raum hinein auf, so dass Sie eins mit dem Himmel werden. Und Sie schweben noch weiter und weiter hinauf, jenseits von Zeit und Entfernungen, zu einem Zustand hin, in dem es nur Frieden gibt.«
»Amen«, wollte ich sagen, aber es war nichts zu hören. Stattdessen hörte ich mich selbst. Ich klang wie eine lautlose Uhr am Meer.
»Wenn Sie sich dazu bereit fühlen«, flüsterte Emeyer aus hundert Kilometer Entfernung, »kehren Sie ganz allmählich wieder in Ihr endliches, schwebendes Ich zurück; die Gelöstheit, die Sie gerade erfahren haben, bringen Sie in jeder Faser von Geist und Körper mit. Sie sinken sachte hinab, bis Sie wieder im Gras oder im Sand liegen. Spüren Sie dann, wie sich diese Oberfläche allmählich in die beruhigende Stabilität des Bodens verwandelt. Zum Schluss fordern Sie sich auf, die Augen zu öffnen und wieder im Raum anzukommen. Öffnen Sie die Augen und verweilen Sie ein paar Minuten in dieser entspannten Position.«
Als ich mich danach mühte, wieder hochzukommen, knackten meine Knochen. Sie knackten laut, es zerriss förmlich die so bedachtsam angerichtete Stille. »Darf ich fragen, wie alt Sie sind?«, sagte Emeyer.
»Dürfen Sie«, sagte ich.
»Und? Wie alt sind Sie?«
»Das geht Sie nichts an!«
»Lassen Sie mich raten«, sagte Emeyer. »Ich schätze Sie auf Mitte –.«
»Sagen Sie nichts, Meister«, knurrte ich. »Es könnte gegen Sie verwendet werden.«
Dafür erhalten Sie eine Quittung
Das Alter also. Schon wieder. Ich glaube noch zu wissen, wie es bei mir losging. Eines Tages kam ein Brief, ausgestellt von meiner Heimatgemeinde. Erst dachte ich, es handele sich dabei um eine weitere maßlose und völlig ungerechtfertigte Gebührenerhöhung, die bis in die letzten Nischen meiner undurchsichtigen Existenz reichen würde. Aber es war schlimmer. »Sehr geehrte(r) Frau/Herr«, las ich, »zu dem diesjährigen Ganztagesausflug der *** Senioren laden wir Sie herzlich ein. Teilnehmen können alle Personen, die ihr *** Lebensjahr im Jahr *** vollenden oder vollendet haben. Ihr Partner/Ihre Partnerin ist selbstverständlich mit eingeladen. Wie in jedem Jahr organisieren wir die Fahrt und sorgen für Ihr leibliches Wohl. Zur Deckung eines Teils der Unkosten erheben wir einen Unkostenbeitrag in Höhe von 18,– € pro Person, der bei Anmeldung gezahlt wird. Dafür erhalten Sie eine Quittung, die Sie dann auf dem Schiff vorlegen müssen, um Ihr Mittagessen zu erhalten.« Welches Schiff? Ich wollte auf kein Schiff, zumindest auf keines, das von Senioren besetzt gehalten wurde. Noch einmal schlich mir eine Reminiszenz an meine ewige Jugend durch den Kopf, die nun aber endgültig auf der Durchreise war und keine Abschiedsszenen mochte. Was vorbei ist, ist vorbei, dachte ich noch. Und: Wer spricht von Siegen, Überstehn ist alles. Das hatte, glaub’ ich, der Kollege Rilke mal gesagt, den es dann aber auch erwischte. Kann man nichts machen. Mir war ein wenig schlecht. Feuchte Augen und so, Sie wissen schon. Dann aber nahm ich mich zusammen. Man würde sich um mich kümmern und mir manches abnehmen, was ich ohnehin nie machen wollte. Das war auch aus dem Brief herauszulesen, der nun in den Anweisungsmodus wechselte: »Denken Sie an Spazierstock, Regenschirm, Fotoapparat, Medikamente etc. und vergessen Sie nicht, gute Laune mitzubringen!« Daran sollte es nicht scheitern; ich bin ja zur Frohnatur gereift, ohne dass es jemandem aufgefallen wäre: »Nachfolgend der Programmablauf. Die Reise, von der wir nicht hoffen wollen, dass es Ihre letzte ist, führt dieses Jahr nach Wiesbaden-Biebrich. Dort besteigen Sie das Schiff msFranconia der fps Fränkische Personen-Schifffahrt zu einer Fahrt durch den Rheingau.« Und sonst? »Das Mittagessen werden Sie auf dem Schiff einnehmen. Auch in diesem Jahr bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich zwischen drei Gerichten zu entscheiden. Um 12.45 Uhr legt das Schiff in Mainz an. Bis 15.30 Uhr haben Sie Zeit, die Stadt zu erkunden. Zurück auf dem Schiff, wird dann eine Stärkung mit Kaffee und Kuchen angeboten. Gegen 17.30 Uhr legen Sie in Rüsselsheim an, um die Heimfahrt nach *** anzutreten.« Auf Seite 2 des insgesamt recht freundlich gehaltenen Anschreibens, mit dem ich offiziell Aufnahme in die komplizierte, aber eigentlich sehr einfache Welt der Senioren fand, stand weiter unten noch zu lesen: »Ich/Wir nehmen am Ganztagesausflug der Gemeinde mit *** Person(en) teil. Ich/Wir wählen als Mittagessen folgendes Gericht: Schweinebraten mit Blaukraut und Kartoffelklöße. Putengeschnetzeltes mit Champignonrahmsauce, Leipziger Allerlei, Reis. Quiche Lauch-Mozzarella ›Franconia-Vielfalt‹.« Soweit ich mich erinnere, habe ich versehentlich alle drei Gerichte angekreuzt, was aber an dem Sachverhalt, der schon vorher in Gang gesetzt wurde, nichts mehr änderte.
Ich sah mich ohnehin gezwungen, die Altenfahrt, für die ich die kümmerlichen Reste meiner guten Laune gebraucht hätte, nicht mitzumachen. Man kam auch ohne mich zurecht; hier, dort und anderswo. Ich war als Auslaufmodell zur Welt gekommen; seither hielt ich mich aber auf anerkennenswerte Weise mit im Betrieb. In der nächsten Nacht schlief ich wie ein Sack, darin hatte ich eine gewisse Übung. Dann aber: Dann kam nach der nächsten Nacht, die unfallfrei verlief, eine übernächste Nacht. Ich lag erst wach, wälzte mich in meiner Furzkiste, bis sich ein fürchterlicher Traum auf mich senkte. Ich wurde zum Schriftsteller. Für mich eine wahrhaft abschreckende Vorstellung. Schriftsteller mochte ich nicht, hatte sie nie gemocht. Warum, weiß ich nicht genau; manchmal hatte ich schon gedacht, dass das einen tieferen Grund haben musste. War ich etwa selbst mal auf Abwege geraten und hatte mich als Autor versucht? Der Traum ließ nicht locker. Er hielt mich nicht nur im Klammergriff, sondern sorgte auch dafür, dass mir eine Zwangsverschickung zugemutet wurde. Ich kam in einen Ort namens Friedrichskoog-Spitze, in dem es, ungelogen, ein aaw, ein Autorenaufbewahrungswerk, gab, das sich um halbvergessene Schriftsteller kümmerte. Nach Art des Hauses. Das aaw, äußerlich noch ganz gut in Schuss, gehörte zu einer sogenannten Künstlerbetreuungsanstalt (kba) und hielt vor allem Kollegen unter Verschluss, die mit einem Buch erfolgreich gewesen waren, dann aber, auf individuelle Weise, vom großen Vergessen ereilt wurden. Ungerecht, vielleicht auch gerecht; wer weiß das schon. In meinem Traum, einem absolut hässlichen Gespinst, wurde ich in Handschellen der lauernden Gemeinschaft zugeführt. In Friedrichskoog-Spitze, das zu einem öden Landstrich namens Frittmarschen gehört, in dem jeder Bürger die Pflicht hat, eine oder zwei Leichen im Keller oder im Schuppen zu halten, regnete es.
»Sie sind ungerecht«, sagte Emeyer. »Und unangenehm gehässig. So sprechen alte weiße Männer, auf die keiner mehr hört.«