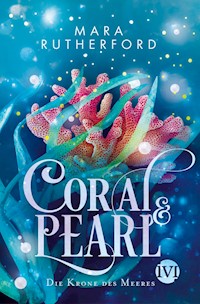17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arctis Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Romance und gefahrliche Geheimnisse, ein verrottendes Schloss und brodelnde Spannung. Mara Rutherfords Erzahlung ist so durchzogen von Schrecken und Hoffnung, dass sie noch lange nachhallt.« Rebecca Ross, Autorin des New York Times-Bestsellers Divine Rivals Sie haben die blutige Pest überlebt – doch der Horror hat noch lange kein Ende. Seit Jahren wütet in Goslind eine tödliche Seuche; der König hat sich mit seinem gesamten Hofstaat im Schloss verbarrikadiert. Während er langsam dem Wahnsinn verfällt, versuchen alle anderen verzweifelt, das Maskenspiel aufrecht zu erhalten und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Doch die Vorräte schwinden und Prinzessin Imogens Sorge, dass ihr größtes Geheimnis auffliegen könnte, wächst mit jedem Tag. Bei einem Fluchtversuch aus dem Schloss trifft sie auf Nico Mott, einen jungen Totengräber auf der Suche nach Überlebenden. Gemeinsam beginnen sie, das Netz der Lügen, das sie umgibt, zu durchbrechen – doch die Pest hat Monster geschaffen, die nur auf frisches Blut warten … »Diese wunderbar schaurige Erzählung verbindet Mystery, Horror und Romance miteinander. [...] Herrlich stimmungsvoll, Gänsehaut pur.« Kirkus Reviews »Rutherford verbindet Romance, gestohlene und falsche Identitäten und eine Atmosphäre voll schwelender Angst zu einer unheimlichen, apokalyptischen Lektüre.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mara Rutherford
Schloss der Lüfen
Aus dem Englischen von Claudia Max
© Atrium Verlag AG, Imprint Arctis, Zürich 2025
Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag untersagt ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung die Nutzung dieses Werkes im Sinne des §44b UrhG für das Text- und Data-Mining.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit realen Personen oder Gegebenheiten sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Copyright © 2023 by Mara Rutherford
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition is published by arrangement with Harlequin Enterprises ULC.
Übersetzung: Claudia Max
Lektorat: Leonie Teckenburg
Covergestaltung: Niklas Schütte
Coverillustration © Elena Masci
Zitate im Kapitel "Motto" übersetzt von Claudia Max (Petrarca) und Theodor Etzel (Poe)
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Alle Rechte vorbehalten. Der Verlag untersagt ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung die Nutzung dieses Werkes im Sinne des §44b UrhG für das Text- und Data-Mining.
ISBN978-3-03880-194-8
www.arctis-verlag.com
Folgt uns auf Instagram unter www.instagram.com/arctis_verlag
Für Will, Gerechtigkeit muss sein.
Hab dich lieb, Kleiner.
»O glückliche Nachwelt, die ihr solch entsetzliches Leid nicht erfahren und unsere Zeugnisse als Fabeln betrachten werdet.«
– Francesco Petrarca, 1349, über die Pest
»Es gab viel Schönes und viel Üppiges, viel Übermütiges und viel Groteskes und auch manch Schauriges – aber nichts, was irgendwie widerwärtig gewirkt hätte. In der Tat, es schien, als wogten in den sieben Gemächern eine Unzahl von Träumen durcheinander.«
– Edgar Allan Poe, Die Maske des roten Todes
Kapitel 1
Eldridge Hall war auf Lügen gebaut.
Seraphina stand am Sims des einzigen Fensters in der obersten Kammer des höchsten Schlossturmes, wo es sogar an den windstillsten Tagen zog. Doch selbst das Fenster war eine Lüge – vor Jahren war es in aller Hast mit Brettern vernagelt worden, und ein Fenster, durch das man nichts sah, war eben nur eine weitere Wand. Jeden Augenblick würde die Ebenholzuhr im Großen Saal drei dröhnende Schläge von sich geben und ein weiteres verschwenderisches Mahl ankündigen, das sich das Königreich nicht leisten konnte.
Die tatsächliche Uhrzeit spielte kaum noch eine Rolle; der Uhrmacher war schon vor Jahren an der Mori Roja gestorben, und falls es noch jemanden außerhalb des Schlosses gab, der sie reparieren konnte, würde der König niemals die Gesundheit seiner geliebten jüngsten Tochter aufs Spiel setzen, um denjenigen zu finden.
Als Seraphina die Treppe zum Speisesaal herunterstieg, summte sie die Melodie eines Kinderliedes aus der Zeit bevor die Pest die Stadt erreichte. Am Königshof wurde sie als Mori Roja bezeichnet, doch jenseits der Schlossmauern nannte man sie die Blutigen Drei.
Es war eine Tatsache: Die Drei war die unseligste aller Zahlen. Drei war die Anzahl der missgünstigen älteren Schwestern, die Seraphina hatte, es war die Anzahl der Besuche, die sie dem wahnsinnigen König täglich in seinen Gemächern abstatten musste, drei war die Anzahl der Tage, die es brauchte, bis ein Mensch an der Mori Roja starb.
Und drei war die Uhrzeit, die die Ebenholzuhr, ebenso hartnäckig in ihrer Realitätsverweigerung wie der König, schon seit Jahren stündlich schlug.
Als sie den Speisesaal betrat, straffte Seraphina die Schultern und reckte das königliche Kinn. Stühle schabten über den Boden, die Lords und Ladys erhoben sich zum Gruß. Hinter dem exquisit geschliffenen Kristall und dem feinen, beinahe durchscheinenden Porzellan war der König schon halb von seinem Stuhl aufgestanden, um sie mit einem seiner Küsse zu beglücken, die gleichzeitig zu feucht wie auch zu trocken waren.
»Vater.« Sie verneigte sich mit dem leichten Knicks, den sie nur mit Mühe gelernt hatte. »Ihr seht gut aus heute Abend.«
»Nicht so gut wie du, Liebes. Ist sie nicht bezaubernd, Lord Greymont? Lord Greymont?« Der König lief wankend im Kreis, als er unter den jungen Edelmännern nach seinem Favoriten suchte. »Ah, da seid Ihr ja. Sieht meine Tochter heute Abend nicht bezaubernd aus?«
»Blühend wie eine Rose«, versicherte Lord Greymont Seraphina mit einer Verbeugung. »Bitte erlaubt mir, Euch zu Eurem Stuhl zu geleiten.«
Sie biss sich in die Wange, die schon ganz wund war von ihren Anstrengungen, nicht jedes Mal aufzustöhnen, wenn sie sich verstellen musste. Lord Greymont war wie alle anderen jungen Männer auf Eldridge Hall, will heißen, er war gut aussehend, reich und todlangweilig.
»Ihr seht immer bezaubernd aus«, flüsterte er; sein Atem auf ihrer bloßen Schulter war ebenso unangenehm wie Haut auf warmer Milch. »Aber ich muss sagen, dieses rosa Kleid schmeichelt Eurem Teint.« Seine Augen verweilten einen Moment zu lange auf ihrem grazilen Dekolleté.
Sie hob eine sorgfältig gezupfte Augenbraue. »Und Ihr seht so schneidig aus wie immer. Obwohl wir alle ein wenig blass sind, findet Ihr nicht?«
»Das ist eben unvermeidlich, wenn man jahrelang nicht an die frische Luft geht.« Er verscheuchte eine getigerte Katze von Seraphinas Stuhl. Ohne Zugang zur Außenwelt, wo Raubtiere ihre Zahl in Schach gehalten hätten, hatten sich die Katzen in den letzten Jahren hemmungslos vermehrt und waren überall im Schloss. Seraphina setzte sich und gestattete Greymont, ihren Stuhl heranzurücken. Ohne zu fragen, nahm er neben ihr Platz. »Freut Ihr Euch auf das Fest zu Eurem zwanzigsten Geburtstag?«
»Eine Dame schätzt es nicht, an ihr Alter erinnert zu werden.« Es klang wie etwas, das eine Prinzessin erwidern würde. In Wahrheit war sie siebzehneinhalb und feierte ihren Geburtstag am liebsten mit einem Picknick.
Warum Lord Greymont ihr in letzter Zeit so viel Aufmerksamkeit schenkte, galt es noch herauszufinden. »Verzeiht, Eure Hoheit. Aber, wenn ich mich erdreisten darf, Ihr seid jetzt noch schöner als an dem Tag, an dem ich Euch kennengelernt habe.«
Sie erinnerte sich noch gut daran. Sie war kaum vierzehn gewesen, ungeschliffen und unterernährt, und war vor Schatten zurückgeschreckt, als handle es sich um Gespenster. Obwohl sein Kompliment kaum dreist zu nennen war, zeigte sie mit Schmollmund und niedergeschlagenen Augen angemessen weibliches Verhalten – eine groteske Kombination aus Sittsamkeit und Geziertheit, wie sie gelernt hatte.
»Habt Ihr bereits ein Kostüm gewählt?«, fragte er.
»Nein, aber meine Schwestern schmieden bestimmt schon Pläne.« Sie blickte zu den jungen Frauen am Ende der Tafel. Wie erwartet kicherten sie hinter vorgehaltener Hand, das Rouge auf ihren Wangen wirkte im Kerzenschein beinahe grell.
Lord Greymont räusperte sich und rückte näher. »Ich weiß, es ist ein wenig verfrüht, aber dürfte ich um den ersten Tanz bitten?«
»Mein Geburtstag ist erst in drei Wochen.«
»Wohl wahr, aber in zwei Wochen seid Ihr bestimmt ausgebucht. Ich möchte nicht riskieren, Euch an unseren geschätzten Lord Spottington zu verlieren.«
Seraphina seufzte. »Lord Pottington fragt doch nur, weil sein Vater es verlangt. Er selbst ist ungefähr so ehrgeizig wie eine Gartenschnecke.«
Lord Greymont grinste. »Unterschätzt ihn nicht, Eure Hoheit. Selbst eine anspruchslose Gartenschnecke hat Ziele, so langsam sie auch sein mag.«
»Wenn Lord Pottington eine Schnecke ist, was bin ich dann? Ein Blatt?«
Lord Greymonts Augen wanderten zu seinem adligen Konkurrenten, der Seraphinas ältester Schwester wild gestikulierend etwas erklärte. Er war unbeholfen und plump – und ja, auch mit fünfundzwanzig hatte er noch unreine Haut – aber Seraphina gab nicht viel auf den äußeren Schein. Auch er war nur eine Lüge, wie alles hier.
»Ihr, Prinzessin, seid weit davon entfernt, Blattwerk zu sein.«
»Ihr habt mich bereits mit einer Blume verglichen«, erwiderte sie.
Als er seinen Wein in dem geschliffenen Kristallkelch schwenkte, fiel Seraphina auf, dass der Goldrand angeschlagen und abgeblättert war. »Ist blühend wie eine Rose etwa kein Kompliment?«
»Das kann ich nicht sagen. Ich habe ewig keine Rose mehr gesehen.«
»Dann werde ich es zu meiner Lebensaufgabe machen, Euch eine zu bringen.«
Fast hätte sie geschnaubt, doch dann erinnerte sie sich daran, dass eine Prinzessin niemals schnauben würde. »Bitte vergeudet Eure Zeit nicht mit etwas so Trivialem wie einer Rose.«
»Womit sollte ich sie Eurer Meinung nach denn sonst verschwenden? Es ist ja nicht etwa so, dass ich hier im Schloss etwas Sinnvolles tue.«
Seraphina trank einen Schluck ihres Weins, der stark mit Wasser verdünnt war. Allmählich ging der Wein wohl zur Neige. Wehe dem armen Diener, der dem König diese Nachricht überbringen musste. Sie sprach leiser, damit Lord Greymont sich zu ihr herüberbeugen musste. Nicht, weil sie seine Nähe suchte – sondern weil sie es genoss, andere ihrem Willen zu unterwerfen, nachdem sie es selbst so viele Jahre lang hatte tun müssen. Außerdem roch er gut nach parfümierter Seife, und das war schon mehr, als sie von den Jungen in ihrer Kindheit behaupten konnte.
»Und was würdet Ihr tun, wenn Ihr nicht im Schloss festsitzen würdet?«
Er sah sich um, und sie bemerkte grüne Sprenkel in seinen braunen Augen. Sie überlegte, ob er sie fragen würde, was sie mit festsitzen meinte. Niemand durfte auf die Posse anspielen, die sie alle aufführten, schon gar nicht in Anwesenheit des Königs. Doch als Lord Greymont antwortete, waren seine Mundwinkel leicht nach oben gezogen. »Ich würde gern die Welt bereisen. Ich glaube, Segeln würde mir gefallen. Nein, ich weiß, dass mir Segeln gefallen würde.«
Sie wurde unwillkürlich lebhafter. »Habt Ihr den Ozean schon einmal gesehen?«
»Ja. Sogar mehr als einmal.«
Also doch nicht so langweilig, wie sie angenommen hatte. »Euch stand ein Schiff zur Verfügung?«
Er nickte. »Tanzt an Eurem Geburtstag mit mir, dann werde ich Euch alles erzählen.«
Sie hatte schon vor langer Zeit gelernt, ihre Verärgerung in neckische Worte zu kleiden, den spitzen Unterton konnte sie jedoch nicht lange unterdrücken. »So lange würdet Ihr mich warten lassen?«
Etwas in seinen Augen veränderte sich, sein Lächeln bekam etwas Boshaftes. Er wusste etwas, das sie auf der Stelle erfahren wollte, aber er würde es als Lockmittel einsetzen. Keine Lüge, bloß noch mehr Spielchen. Zum Glück war Seraphina gut im Spielen und konnte geduldig sein, wenn der Preis etwas war, das sie wollte.
»Das Warten wird sich lohnen«, säuselte er. »Versprochen.«
Der Wein war wohl doch stärker, als sie angenommen hatte, Seraphina war warm und leicht schwindlig. Was würden die Mädchen zu Hause sagen, wenn sie sie so sehen könnten, in dem schönen rosa Kleid und in Gesellschaft eines gut aussehenden Mannes?
Unter dem Tisch zwickte sie sich fest ins Handgelenk; das tat sie immer, wenn sie sich dabei ertappte, dass sie auch nur einen Moment ihrer Zeit auf Eldridge genoss. Glücklich zu sein, war Bequemlichkeit, und Bequemlichkeit bedeutete Akzeptanz. Doch solange sie noch atmete, würde sie dieses Leben niemals als ihres akzeptieren.
Abgesehen davon spielte es mittlerweile keine Rolle mehr, was die Mädchen zu Hause von irgendetwas hielten. Die Mädchen zu Hause waren alle tot.
Nach dem Abendessen zog sich Seraphina in die Gemächer zurück, die sie mit ihren älteren Schwestern teilte.
»Ein Maskenball!« Rose, die Jüngste und am leichtesten Erregbare der drei, ließ sich theatralisch quietschend auf eine der sieben Brokat-Chaiselongues fallen, die scherzhaft auch Ohnmachtssofas genannt wurden – als wäre das alles, was Damen taten: essen, schlafen, ohnmächtig werden und dann wieder von vorn. Dabei scheuchte sie eine Katze mit langem roten Fell auf. »Ich kann mich nicht entscheiden, als was ich gehen soll!«
»Wir haben noch wochenlang Zeit, uns zu entscheiden«, erklärte Seraphina ihrem Abbild im Spiegel des Frisiertischs. Hinter ihr lächelte Jocelyn, ihre Hofdame und der einzige Mensch auf Eldridge Hall, den Seraphina ertragen konnte.
»Lord Greymont wird umwerfend aussehen mit einer Maske«, sagte sie und zupfte an Seraphinas kastanienbraunen Locken. »Meint Ihr nicht?«
Seraphina reichte Jocelyn die silberne Bürste, die mehr wert war als das Leben der meisten Menschen, wich dabei jedoch ihrem Blick aus. Sie zu frisieren, war eigentlich die Aufgabe eines Dienstmädchens, doch Jocelyn behauptete, es entspanne sie. Und Seraphina konnte nicht leugnen, dass es auch auf sie beruhigend wirkte.
»Lord Greymont würde in allem umwerfend aussehen«, sagte Rose kichernd.
»Oder ohne alles.« Nina, die älteste der Schwestern, grinste anzüglich.
Seraphina verdrehte die Augen, während ihre Schwestern mit ihren Hofdamen wie ein kleiner Spatzenschwarm vor sich hin trällerten und trillerten. Ob es wohl draußen noch Vögel gab? Dalia, die ihre beste Freundin gewesen war, als sie noch den Luxus hatte, sich ihre Freundinnen aussuchen zu können, hatte Singvögel geliebt. Vor allem Goldammern. Doch nachdem der König begonnen hatte, Nahrungsmittel und Vieh zu horten, aßen die Menschen alles, was ihnen in die Finger kam. Sie hatte schon ewig keinen Vogel mehr vor ihrem Fenster gehört.
»Denkst du an deine Familie?«, flüsterte Jocelyn in Seraphinas Ohr.
Seraphina kniff die nach unten gerichteten braunen Augen zusammen, Augen, die ihnen so bekannt vorkamen, dass ihren »Schwestern« der Atem gestockt hatte, als sie Seraphina das erste Mal sahen. Sie konnte immer noch Giselle hören, die mittlere Schwester, wie sie den anderen im Eingang von Seraphinas Elternhaus zugeflüstert hatte: Sie ist perfekt. Oder wird es sein, wenn wir erst mal den ganzen Dreck abgeschrubbt haben.
Seraphina würde nicht weinen. Sie hob sich ihre Tränen für später auf, wenn sie in ihre Turmkammer hinaufging. Ein Raum, der so vollgestopft und düster war, dass sie jeden Morgen einen bittersüßen Moment lang glauben konnte, sie sei zu Hause.
In ihrer Anfangszeit auf dem Schloss hatte sie in ihrem eigenen königlichen Gemach geschlafen, das verschwenderischer und luxuriöser war als alles, was sie sich je hatte vorstellen können. Doch nach einigen Monaten hatte sie den leer stehenden Turm entdeckt und war nachts hinaufgeschlichen. Je mehr sie sich gestattete, Gefallen an den wunderschönen Kleidern und den üppigen Gelagen zu finden, je mehr sie zuließ, dass die Schmeicheleien von Männern wie Lord Greymont ihre Wangen glühen – oder noch schlimmer, ihren Magen flattern ließen – umso leichter war es, die Menschen zu vergessen, die sie dem Tod an der Mori Roja überlassen hatte, als sie fortging. Nicht nur ihre Familie, sondern die ganze Gemeinde. Die ganze Welt, soweit sie wusste. Soweit man auf dem Schloss wusste.
»Ich werde als Schmetterling gehen«, erklärte Rose. »Als wunderschöner rosa Schmetterling.«
»Es gibt keine rosa Schmetterlinge.« Nina nahm eine Kirsche aus der Schale kandierter Früchte, die den Prinzessinnen überall hinterhergetragen wurde. Seraphina rührte die Früchte nicht an, so verlockend sie auch aussahen. Sie schien die Einzige zu sein, der bewusst war, dass sie irgendwann aufgebraucht sein würden. So wie alles.
Obwohl sie schon seit fast vier Jahren abgeschottet im Schloss lebten, wusste sie immer noch nicht, woher die Früchte kamen. Niemand durfte das Schloss verlassen, niemand durfte es betreten. Jocelyn glaubte, dass die Bediensteten einen Geheimtunnel benutzten, denn der König verlangte zwar nach seinen Delikatessen, hatte ihnen jedoch nie erklärt, wie sie in diesem belagerungsähnlichen Zustand frische Lebensmittel beschaffen sollten. Da Seraphina – dafür hatte Giselle gesorgt – nur in ihrem Turm allein war, hatte sie allerdings keine Vorstellung, wo sich der Tunnel befinden könnte.
»Natürlich könnte es rosa Schmetterlinge geben«, beharrte Rose. »Du hast Goslind schließlich nie verlassen.«
Nina nahm sich noch eine Kirsche und äffte Rose nach, als diese ihr den Rücken zudrehte. »Ich werde als Sirene gehen.«
»Wie sieht das Kostüm einer Sirene aus?«, fragte Jocelyn.
»Tiefer Ausschnitt«, gab Rose zurück, bevor Nina antworten konnte, was sogar Seraphina zum Lachen brachte. Gewöhnlich war Rose weder schnell noch geistreich.
»Ha, ha«, sagte Nina, obwohl sie besagten Ausschnitt gerade im Spiegel bewunderte. »Ich werde ein langes blaues Kleid tragen, dazu offenes wallendes Haar und bloße Füße.«
»Pass auf, dass du am Ende nicht mit einem der Archer-Brüder tanzen musst«, warnte Jocelyn. »Die sind ungefähr so anmutig wie eine Kuhherde.«
»Als was wirst du gehen?«, fragte Rose Seraphina und setzte sich auf deren Armlehne. »Als Meerjungfrau? Schwan? Oder wie wäre es mit Elfe? Du würdest bezaubernd aussehen mit Flügeln.«
»Das entscheidet sicherlich Giselle für mich.« Giselle hatte sich mit ihren Hofdamen in ihr Gemach zurückgezogen. Sie mied Seraphina und überließ anderen die schmutzige Aufgabe, sie zu mäßigen.
»Kommt schon, irgendeine Vorliebe müsst Ihr doch haben«, drängte Jocelyn.
Seraphina zuckte gleichgültig mit der Schulter. Da ihr ganzes Leben eine endlose Maskerade war, konnte sie keine Begeisterung für eine weitere aufbringen. Jocelyn hatte die Bürste auf den Schminktisch zurückgelegt und etwas Schimmerndes weckte Seraphinas Aufmerksamkeit. Sie zupfte eine goldene Haarsträhne aus der Bürste und hielt sie Jocelyn entgegen.
»Wir müssen es diese Woche wieder färben«, sagte Jocelyn leise. »Ich weiß, dass du es hasst.«
»Henna reizt meine Kopfhaut.« Seraphina runzelte die Stirn und legte den Kopf schräg, bis das Licht auf die durch Perlenpuder fast unsichtbar gemachte Narbe an ihrem Kiefer fiel.
»Es tut mir leid, Liebes. Aber was bleibt uns anderes übrig?«
Die Frage war rein rhetorisch. Sie wussten beide, dass sie keine Wahl hatten, was ihr Leben auf Eldridge Hall anging. Jocelyns gesamte Familie war an den Blutigen Drei gestorben, sogar ihre kleine Schwester. Jocelyns Kindermädchen hatte ihr, mehrere Monate nachdem die Schlosstore verbarrikadiert worden waren, einen Brief geschrieben und ihr geraten, nicht zurückzukommen. Ihr war nicht bewusst gewesen, dass Jocelyn nicht gehen konnte, selbst wenn sie es gewollt hätte. Doch im Gegensatz zu Seraphina schätzte sich Jocelyn glücklich, dass sie gesund und munter und sicher vor der Mori Roja im Schloss leben durfte, und fand, dass Seraphina derselben Meinung sein sollte.
Sicher mochte zutreffen, aber von munter konnte nicht die Rede sein. Das Leben auf Eldridge Hall ähnelte dem hölzernen Bauklötzchenturm eines Kindes, nur waren die Bauklötzchen in diesem Fall Lügen, und der König war das Kind, und eine falsche Bewegung bedeutete mehr als nur ein paar weinerliche Minuten auf dem Knie des Kindermädchens. Sie bedeutete Tod.
»Ich denke, ich werde schlafen gehen«, erklärte Seraphina und stand von der Frisierkommode auf.
»Warte, ich helfe dir aus dem Kleid.« Jocelyn war keine Schönheit wie Rose, auch keine Kokette wie Nina, aber sie war freundlich und intelligent. Sie war die Einzige, die Seraphinas wahre Gedanken kannte, auch wenn diese fand, dass sie die Rolle der Prinzessin mittlerweile recht gut beherrschte.
»Das kann ich alleine«, erklärte sie sanft. »Ruh dich ein wenig aus.«
»Nimm wenigstens eine zusätzliche Decke mit«, beharrte Jocelyn und küsste sie auf die Wange. »Es ist so zugig dort oben.«
Niemand dachte gern an Seraphina im Turm. Es lenkte von der Posse ab, die sie spielten. Rose winkte schläfrig von der Chaiselongue. »Mögest du von Lord Greymont und einer königlichen Hochzeit träumen.«
»Und einer königlichen Hochzeitsnacht«, fügte Nina hinzu.
»Gute Nacht, Prinzessin Imogen«, sagte Jocelyn, als sie die Tür hinter Seraphina schloss.
Diese stieg die Treppe zum Turm barfuß hinauf und genoss, wie der kalte Stein an ihren verzärtelten Füßen brannte – das Ritual erinnerte sie daran, wo sie herkam. Nachdem sie die dünne Holztür hinter sich geschlossen hatte, ging sie zum Fenstersims und presste das Auge an den schmalen Spalt in den Brettern. Sie war erleichtert, als sie sie sah: ein Mädchen in einem weißen Kleid, ihre feinen Gesichtszüge waren aus dieser Entfernung nichts weiter als ein Fleck. Sie war für Seraphina die beste Erinnerung an ihr Zuhause. Jeden Tag fürchtete sie, das Mädchen würde nicht kommen, doch sie kehrte jede Nacht zurück. Dalia, ihre beste Freundin.
Seraphina wartete, dass sie winken würde, nur eine erhobene Hand, bevor sie zum Schlag der Uhr wieder im Wald verschwand. Dalia war das einzig Wahrhaftige, was sie noch hatte, das letzte Überbleibsel einer Welt, in die sie eines Tages zurückkehren würde. Denn sie war weder eine Prinzessin noch die Tochter des Königs, nicht einmal eine Lady.
Ihr Name lautete Seraphina Blum. Sie war eine Jüdin, die die Pest nur überlebt hatte, weil sie ein hübsches Mädchen mit traurigen Augen war, das zufällig einer toten Prinzessin ähnelte.
Und das war die schönste Lüge von allen.
Kapitel 2
Nico stieß seine Schaufel in die zum Glück noch nicht gefrorene Erde. Tote zu begraben war immer eine traurige Angelegenheit, aber sie bei Schnee und Eis zu begraben, war noch eine ganz andere Tortur. Er warf Erde auf den verwesten Arm eines Leichnams, von dem im Gegensatz zu seinem erst kürzlich gestorbenen Nachbarn kaum mehr als das Skelett übrig war.
Sein verstorbener Vater, ein Metzger, der einer Adelstochter – sehr zum Leidwesen ihres Vaters – den Kopf verdreht hatte, war es nicht müde geworden, Nico daran zu erinnern, dass er aus weicherem Holz geschnitzt war als seine älteren Brüder. Dass er zumindest den robusten Magen von Jeremiah geerbt hatte, kam Nico beim Ausheben von Gräbern zugute.
Ansonsten ähnelte er in jeder Hinsicht seiner Mutter, auch er war groß und schlank und legte ständig die Stirn in Falten. Er war immer Lucindas Liebling gewesen, eine Rolle, an die er sich geklammert hatte, bis sie in seinen Armen an der Mori Roja gestorben war.
Er hob die Schaufel und stieß sie heftiger als nötig in die Erde, als wolle er sich beweisen, dass er nicht mehr so verzärtelt war wie früher. Sein Vater und seine Brüder würden ihn kaum noch wiedererkennen. Oh ja, sie würden –
Die Schaufelspitze traf einen Stein und sandte Schockwellen durch Nicos Arm. Er schüttelte ihn und blickte mit finsterer Miene zum Himmel. Irgendjemand da oben hatte einen schrägen Sinn für Humor.
»Das ist der Letzte«, erklärte Colin und stellte sich neben Nico. Colin Chambers war vor der Pest Schornsteinfeger gewesen, aber nun arbeitete Nico – von edlerer Herkunft, allerdings ohne das entsprechende Gehabe – mit ihm Seite an Seite. Der Tod machte alle gleich.
Nico nickte. »Nur drei Leichen diese Woche. Das sind drei weniger als letzte Woche.«
Als Colin sich mit dem Unterarm über die Stirn rieb, wurden – wie bei Nico – verästelte rote Male auf der Innenseite seines hellbraunen Handgelenks sichtbar. Mit seiner langen schmalen Statur war Colin wie geschaffen für das Leben eines Schornsteinfegers, Arbeit, die er zwar verabscheute, die ihm aber letztendlich erspart hatte, das Schlimmste der Pest mitzuerleben. Kurz bevor sie zugeschlagen hatte, war er von seinem Dienstherrn für einige Wochen an die Küste geschickt worden. Er hatte Mitleid mit Colin gehabt, nachdem er ihn den ganzen Winter hatte husten hören. Als die Pest ausbrach, hielt sich Colin noch immer an der Küste auf, und die Familie seines Dienstherrn erlaubte ihm, unter der Bedingung, sich um das Haus zu kümmern, zu bleiben, während sie in noch sicherere Gefilde davonsegelten.
Schließlich hatte sich die Pest in ganz Goslind und über die Grenzen hinweg in benachbarten Königreichen ausgebreitet, doch als sie die Küste erreichte, hatte Colin, ebenso wie Nico, herausgefunden, dass er zu den wenigen Glücklichen gehörte, die immun waren. Nach einer Weile war er zurückgekommen, um nach seiner Familie zu sehen, aber sie waren alle »tot oder weg«.
Nicos Familie hatte keine Möglichkeit gehabt zu fliehen, und er war derjenige gewesen, der sich während ihrer letzten blutigen drei Tage um sie gekümmert hatte. Seine Brüder mochten zwar stämmig und robust sein wie sein Vater, doch sie waren auf dieselbe Weise gestorben wie seine Mutter: aus ihren Poren, ihren Augen, ihren Ohren, ihren Nasen und jeder anderen denkbaren Körperöffnung war Blut gequollen. Ob sein Vater ebenfalls immun gewesen war, würde er nie erfahren. Er war kurz vor Ausbruch der Pest verstorben.
»Die meisten dieser Leichen liegen schon seit Monaten hier draußen. Die Pest ist vorbei«, sagte Colin und klopfte Nico gegen die Stirn. »Dreimal auf Holz.«
»Autsch.« Nico rieb sich die braunen Haare, die mittlerweile lang genug waren, um sie im Nacken zu einem Pferdeschwanz zusammenzubinden. Der Friseur, der ihn früher immer nach der neuesten Mode frisiert hatte, war tot, ebenso wie sein Schneider, sein Schuhmacher, der Bäcker und der schreckliche Kerzenzieher.
»Wir sollten zum Haus zurückgehen. Es wird bald dunkel.« Colin drehte die leere Schubkarre in Richtung des vornehmen steinernen Gutshauses auf dem Hügel. Dem Ort, den sie nun ihr Zuhause nannten.
Nachdem Nico viele Jahre lang Dienstboten gehabt hatte, war es seltsam, nun selbst Diener zu sein. Trotzdem verging kein Tag, an dem er nicht seinem Glücksstern für seinen Retter, Lord Crane, dankte. Gleich nach Ausbruch der Seuche war er, in der Hoffnung, mit seinen medizinischen Kenntnissen von Nutzen zu sein, zu seinen Nachbarn gegangen, aber alle hatten ihm verängstigt die Tür vor der Nase zugeschlagen. Da nie jemand Hilfe oder Zuflucht bei ihm gesucht hatte, musste er davon ausgehen, dass ein großer Teil der Bevölkerung gestorben war.
Eine Weile hatte er überlegt, nach Esmoor zu gehen, der Hauptstadt und dem Epizentrum der Seuche. Wenn ihn auch dort niemand brauchte, konnte er vielleicht mehr über die Mori Roja herausfinden und wie sich die Krankheit ausbreitete. Er war nicht brillant genug, um ein Heilmittel zu finden, aber es bestand immer noch die Möglichkeit, jemandem zu helfen. Die Möglichkeit, nicht so jämmerlich zu versagen wie bei seiner Familie.
Nachdem Nico alles Essbare und auch eigentlich schon nicht mehr Essbare in seinem Haus verzehrt hatte, hatte er sich auf die Suche nach anderen Überlebenden gemacht, traurigerweise aber nur Leichen gefunden. Manchmal lagen sie noch mitten auf der Straße, wo sie zusammengebrochen waren. Es gab nicht einmal genug Menschen mehr, um sie zu begraben.
Lord Crane hatte Nico halb verhungert und im Delirium ungefähr zwanzig Meilen von Crane Manor im Wald gefunden. Crane war ebenfalls immun gegen die Pest. Da die meisten Dienstboten und Bauern auf seinen Ländereien gestorben waren, begann er mit seinen Streifzügen durch die Umgebung.
Bisher hatte er mehr als ein Dutzend Überlebende aufgenommen, die auf Crane Manor zusammen lebten und arbeiteten. Wäre er mutiger gewesen, hätte Nico das auch gern getan. Nun rettete er zwar keine Leben, aber er half den anderen im Haushalt mit seinen medizinischen Kenntnissen, was seinem Leben einen Sinn gab, den er vermisst hatte, seit seine Familie tot war.
Nico wurde für seine Arbeit nicht bezahlt, aber er bekam alles, um bescheiden zu leben. Und vielleicht – vorausgesetzt, Plünderer oder Tiere hatten ihn nicht übernommen – würde er eines Tages auf den Familiensitz zurückkehren. Für den Moment war es einfach angenehm, nicht allein zu sein. Bis er zum ersten Mal wirklich allein gewesen war, hatte er sich immer als unabhängigen Einzelgänger betrachtet. Nun war ihm klar, dass die Gesellschaft, mit der er sich früher umgab, weder so geistreich noch so charmant war, wie er geglaubt hatte.
Colin und er klopften den Schlamm von den Stiefeln und gingen die Treppe zum Dienstbotentrakt hinunter, immer dem Duft von gekochtem Fleisch folgend.
»Beeilt euch und wascht euch fürs Abendessen«, sagte Mrs Horner, die Köchin, die geschäftig in der Küche hantierte. »Der Herr hat heute Abend einen Gast und wünscht um acht ein förmliches Abendessen.«
Jeder im Gutshaus übernahm mehrere Aufgaben: Nico diente als Lakai, Kammerdiener, Bestatter und Krankenpfleger, je nachdem, was am betreffenden Tag gerade gebraucht wurde. Heute würde er im Speisezimmer das Essen auftragen.
»Wer ist der Gast?«, erkundigte sich Colin und kaute geräuschvoll eine wilde Möhre, die er vom Schneidebrett stibitzt hatte, als Mrs Horner ihm den breiten Rücken zudrehte.
»Ein Mädchen«, erklärte Abby, eine junge Frau, die Colin vor über zwei Jahren gefunden hatte. Sie war klein und drall und hatte ein engelsgleiches Gesicht – Colin hatte sich auf der Stelle in sie verliebt. Doch Abby wollte höher hinaus und hatte ein Auge auf den einzigen anderen jungen Adligen im Gutshaus geworfen: Clifford Branson.
Nicht, dass es eine Rolle spielte. Lord Crane duldete kein Getändel zwischen dem Personal. Es war eine seiner Bedingungen, wenn man im Haus leben wollte. Nico kümmerte es wenig, denn eine Romanze war so ungefähr das Letzte, was er in diesen Tagen im Sinn hatte.
»Eine Unbefleckte?«, fragte Colin.
Abby nickte. Immune und Unbefleckte waren nicht dasselbe. Immune waren in Kontakt mit der Pest gekommen, zeigten aber außer den roten Malen entlang der Adern auf der Innenseite ihrer Handgelenke keine Symptome. Unbefleckten hingegen war es gelungen, jeden Kontakt mit der Seuche zu vermeiden. Sie waren selten, vor allem jetzt und vor allem in dieser Gegend, wo die Pest hart zugeschlagen hatte. Manchmal tauchten welche auf – sie kamen zurück, um nach Überlebenden zu suchen, oder wagten sich nach jahrelangem Rückzug in ihren Herrenhäusern erst jetzt nach draußen. Soweit Nico wusste, überlebte niemand, der sich mit den Blutigen Drei angesteckt hatte. Nach seiner Einschätzung waren in den letzten dreieinhalb Jahren mindestens drei Viertel der Bevölkerung von Goslind ausgelöscht worden.
»Sie kam genau in dem Moment zum Gutshaus, als Lord Crane zur Jagd aufbrechen wollte«, erklärte Abby. »Sie sagte, sie sei auf dem Heimweg. Während der Pest war sie im Ausland, aber sie ist überzeugt, dass die Seuche vorbei ist. Sie weiß nicht, wer überlebt hat.«
Nico schlug mitleidig die Augen nieder. Er konnte sich vorstellen, wie verängstigt eine junge Dame sein musste, die ganz auf sich gestellt war und nicht wusste, was sie zu Hause erwartete. Anfangs war Nico überzeugt gewesen, dass man auch ohne Heilmittel Vorsichtsmaßnahmen ergreifen konnte, um die Ausbreitung der Mori Roja zu verzögern. Quarantäne hatte in der Vergangenheit Dörfer vor anderen Seuchen bewahrt. Die Juden beispielsweise, die ihr von Mauern umgebenes Stadtviertel nicht hatten verlassen dürfen, starben meist als Letzte. Es führte allerdings häufig dazu, dass sie beschuldigt wurden, die Seuche ausgelöst zu haben, und so war ihr Überleben nicht der Segen, für den man es hätte halten können. Vor die Wahl zwischen den Blutigen Drei und einem Pogrom gestellt, wollte Nico lieber von der Natur verraten als von den eigenen Nachbarn gemeuchelt werden.
Allerdings hatte er immer noch keine Kenntnis darüber, wie sich die Krankheit ausbreitete, ob sie über die Luft oder durch Körperflüssigkeiten übertragen wurde. Er wusste nur, dass der Seuche – wie es bei allen Epidemien der Fall war – irgendwann die Wirtskörper ausgehen würden. Ein kleiner Teil von ihm fürchtete trotzdem, sie könnte immer noch dort draußen wüten und nur warten, bis sich die Bevölkerung so weit erholt hatte, dass sie sich erneut ausbreiten konnte.
»Bestimmt findet sie Goslind sehr verändert«, sagte Colin. »Sie hatte Glück, dass sie auf Lord Cranes Ländereien gestoßen ist.«
Abby nickte. »Sie wird einige Tage bleiben und sich dann wieder auf den Weg machen. Ich soll ein Gästezimmer herrichten.«
»Als ob sie das bräuchte«, sagte Branson hinter ihr. Er hatte die unangenehme Angewohnheit, mit seinem fettigen schwarzen Haar und höhnischem Grinsen aus dem Nichts aufzutauchen. Abby kicherte hinter vorgehaltener Hand, um den schiefen Zahn zu verbergen, der ihr in Bransons Anwesenheit peinlich war.
»An die Arbeit mit euch!«, sagte Mrs Horner und schlug leicht mit dem Löffel nach Branson. Doch selbst sie stand in seinem Bann und kicherte wie ein Schulmädchen, als er mit einem geschickten Ruck ihre Schürzenbänder aufzog.
Colin und Nico verdrehten nur die Augen und gingen, um sich zu waschen und fürs Abendessen umzuziehen. Nico hatte einige Sachen seiner Brüder mitgebracht, als er von zu Hause fortging, doch mittlerweile waren sie ihm fast zu klein. Der Beweis, dass er gewachsen war. Colin zog ihn gern damit auf, dass er – hätte er »den Körper eines Gottes und die Seele eines Dichters« gehabt, von der vornehmen Herkunft ganz zu schweigen – Amy längst geheiratet hätte. Vor allem aber sagte er es, um Nico zum Erröten zu bringen, was nicht weiter schwer war: Nico wurde jedes Mal rot, wenn ihm jemand ein Kompliment machte, ihn neckte oder zu lange ansah.
Sie verließen das Zimmer gemeinsam, Colin ging in die Küche und Nico ins Speisezimmer. Auf dem Weg durch die unzähligen Flure von Crane Manor wäre er auf dem schwach erleuchteten Gang beinahe gegen jemanden geprallt.
»Holla«, sagte Nico, ganz der Dichter.
»Wer ist da?«, fragte eine verängstigte Stimme.
Vor Nico stand eine zierliche junge Frau. Sie musste Cranes Gast sein. »Ich bitte um Nachsicht, Miss. Kann ich Euch behilflich sein?«
»Das wäre wunderbar.« Sie drehte sich im Kreis. »Dieses Haus ist ein wahres Labyrinth.«
»Mit Vergnügen. Ihr erlaubt?« Es war eine Weile her, dass Nico sich in der Gesellschaft einer Dame befunden hatte, und es dauerte einen Moment, bis er sein neues, eher bäuerliches Ich abgeschüttelt hatte. Die Jugend und Schönheit besagter Dame machten es nicht einfacher, und Nico wurde puterrot. Mit einem Mal war er dankbar, dass sie im Gutshaus nicht genug Talg für Kerzen auf allen Fluren hatten.
»Seid Ihr ein Verwandter von Lord Crane?«, fragte das Mädchen. Sie hatte weit auseinanderstehende braune Augen, was sie wie ein erschrockenes Rehkitz aussehen ließ.
»Nein, Miss …«
Sie lächelte ihn an. »Elisabeth Talbot.«
»Nein, Miss Talbot. Ich bin einer der vielen, die Lord Crane nach der Pest bei sich aufgenommen hat. Ich komme aus Mayville.«
Sie musterte ihn mit ihren Rehaugen, und ihr Blick verriet, dass sie noch nie von dem kleinen Dorf gehört hatte.
»Die Familie meiner Mutter stammt aus Esmoor«, fügte er hinzu. »Lucinda Templeton.«
»Ach ja?«, sagte sie lebhafter. Die Templetons waren in Goslind wohlbekannt. Etliche von ihnen waren Berater am Königshof gewesen, und Nicos Onkel hatte als Richter den Vorsitz über die Mordanklage eines berühmten Opernsängers geführt. »Und wie soll ich Euch ansprechen?«
»Ihr braucht mich nicht anzusprechen, Miss Talbot. Ich bin hier bloß ein Diener.«
Bevor sie das Ende des Gangs erreichten, legte sie ihm eine kleine behandschuhte Hand auf den Arm. »Die Pest hat uns alle verändert, Sir. Aber das bedeutet nicht, dass wir alles aufgeben müssen, was wir zuvor waren.«
Er lächelte und neigte den Kopf. »Hübsch gesagt. Ich heiße Nicodemus Mott.«
»Nun denn, Mr Mott. Würdet Ihr mich bitte zum Abendessen führen?« Sie winkelte erwartungsvoll den Ellbogen an.
Er verbeugte sich, ein eleganter Kniff, um das längste Männer-Erröten der Welt zu verbergen. »Es ist mir eine Ehre.«
Crane Manor hatte seit einem halben Jahr keine Gäste mehr gesehen und Elisabeths Anwesenheit hob die Stimmung des gesamten Haushalts. Es lag nicht nur daran, dass sie schön und charmant war, es war auch das Wissen, dass es dort draußen Überlebende gab: Unbefleckte, die die Seuche überstanden hatten, ohne immun zu sein. Die Welt hatte sich verändert, aber nicht vollständig. Es ließ hoffen, dass alles eines Tages wieder sein würde, wie es gewesen war.
Als Nico den Stuhl für Miss Talbot heranrückte, fiel ihm auf, dass Crane für diesen Abend das gute Porzellan und das Silber verlangt hatte.
»Sagt, Mr Mott«, Elisabeth blickte zu ihm hoch. Im Kerzenschein war sie sogar noch schöner, ihr olivfarbener Teint strahlte vor Gesundheit und Lebendigkeit. »Was würdet Ihr mit Eurem Leben anfangen, wäre die Mori Roja nicht dazwischengekommen?«
Nico war sechzehn gewesen, als die Pest ausbrach. Als jüngster von drei Söhnen hätte er Glück haben müssen, um etwas zu erben, andererseits waren keine Erwartungen an ihn gestellt worden. »Ich hätte gern Medizin studiert«, sagte er. Sein Vater hatte die Idee lächerlich gefunden, aber nun stand es ihm frei, von solchen Dingen zu träumen. Es gab niemanden mehr, der es ihm verbieten konnte.
»Mott ist einer der intelligentesten jungen Männer, denen ich je begegnet bin.« Crane kam durch den Raum auf sie zu. »Er versorgt sämtliche Verletzungen hier auf dem Gut, menschliche wie tierische. Er wäre ein ausgezeichneter Arzt geworden.«
»Dann wird er einer.« Elisabeth lächelte Nico an. »Die Welt braucht sicherlich noch Ärzte.«
Nico wollte gerade etwas Scharfsinniges wie »Danke« antworten, als Crane Platz nahm und ihm mit einem Zeichen bedeutete, das Essen aufzutragen.
Nicos Magen verkrampfte sich vor Verlegenheit und er verschwand mit einer Verbeugung in die Küche. Seit Jahren hatte er sich eingeredet, dass in seinem Leben kein Platz für Romantik war, und er hatte recht damit. Einer Frau wie Miss Talbot hatte er nichts zu bieten. Nicht einmal eine schlagfertige Antwort.
Als er mit der Möhrensuppe zurückkehrte, fand Nico Elisabeth und Crane zu seiner Überraschung in verlegenem Schweigen vor. Crane konnte streng zu den Dienstboten sein, allerdings nie ohne Grund. Mit Gästen war er eigentlich im Allgemeinen umgänglich. Aber vielleicht war er ja ein wenig bäurisch geworden, weil er so lange niemanden empfangen hatte.
Nico servierte die Suppe und wandte sich ab, um in Dienermanier im Hintergrund zu warten, doch da legte ihm Elisabeth die Hand auf den Unterarm.
»Erzählt mir mehr über Eure Familie«, sagte sie. »Ich bin neugierig, warum jemand von so hoher Geburt hier auf dem Gut arbeitet.«
Nico spürte Cranes Blick, mit einem Mal war sein Mund trocken. Er leckte sich über die Lippen.
Zum Glück rettete ihn ein lautes Klopfen an der Eingangstür.
»Wer zum Teufel ist das?« Crane klang äußerst erbost über die Störung.
»Ich gehe«, erklärte Nico und verließ, dankbar für die Ausrede, den Raum. Da normalerweise nie jemand vorbeikam, überlegte er, ein Jagdgewehr zu holen. Doch als weiter mit der Faust gegen die Tür gehämmert wurde, öffnete Nico lieber, um Crane den Lärm zu ersparen.
Auf der Schwelle stand ein Fremder. Er sah wie Mitte zwanzig aus, hatte dunkles schulterlanges Haar und trug die elegante Kleidung eines Gentleman.
»Kann ich Euch helfen, Sir?«, fragte Nico.
»Das hoffe ich sehr«, erwiderte der Mann. »Ich suche meine Frau. Ich habe sie im Wald verloren.«
Nico unterdrückte einen Schauder, als er ins Haus zurückspähte. Der Fremde konnte unmöglich Elisabeth meinen.
»Mein Name ist Adrien Arnaud«, stellte sich der Mann vor und lenkte Nicos Aufmerksamkeit auf sich. »Ich lebe nur wenige Meilen von hier. Könnte ich vielleicht hereinkommen? Es ist schrecklich kalt heute.«
»Lass diesen Mann nicht ins Haus, Mott.«
Als Nico sich umdrehte, sah er Crane hinter sich stehen. Er hatte seinen Herrn nicht kommen hören, aber er hatte sowieso kaum etwas wahrgenommen, weil ihm das Blut in den Ohren pochte.
»Dieser Gentleman sucht nach seiner Frau«, erklärte Nico. Crane war etliche Zentimeter größer als Arnaud, doch der Fremde hatte das sehnige Aussehen von jemandem, der viel Zeit mit körperlicher Betätigung verbrachte. Nico wollte gegen keinen von beiden kämpfen müssen.
»Ihr seid hier nicht willkommen«, erklärte Crane dem Mann. Sie standen sich gegenüber, jeder auf seiner Seite der Schwelle.
»Nun aber. Wir können das bestimmt höflich regeln.«
Crane wollte gerade antworten, als sie ein leises Hüsteln hörten. Elisabeth stand hinter ihnen und beobachtete alles mit anmutig verschränkten Händen. »Das Abendessen wird kalt.«
Als sie Arnaud ansah, wirkte sie nicht, als würde sie ihn kennen. Er war also nicht ihr Ehemann. Doch wer war dieser Mann dann, und warum hatte Nico das Gefühl, dass Crane und er sich kannten?
»Geht, bevor ich Euch von meinem Land vertreiben lasse«, knurrte Crane und schlug die Tür mit Wucht zu. Es grenzte an ein Wunder, dass er Arnaud nicht die Nase brach. Er zog seine Jacke zurecht, drehte sich zu Elisabeth um und ergriff ihren Arm.
»Nico«, sagte er über die Schulter, »beobachte vom Fenster aus, ob er wirklich geht. Und öffne ihm auf keinen Fall mehr die Tür.«
Nico nickte, die bizarre Begegnung hatte ihm die Sprache verschlagen.
Lord Crane führte Elisabeth ins Speisezimmer zurück und sprach leise und beruhigend auf sie ein. »Kommt, meine Liebe. Eure Hände sind eiskalt. Da gibt es nichts Besseres als eine warme Mahlzeit, um die Durchblutung anzuregen.«
Kapitel 3
Es war Seraphinas mittäglicher Besuch beim König. Er unterhielt sich mit Lord Greymont, sie saß mit ihren Schwestern und den Hofdamen an der Seite und bestickte ein Kissen. In der Enge des jüdischen Ghettos hatte sie als junges Mädchen davon geträumt, eine Lady zu sein. Nicht, weil sie sich ein müßiges Leben gewünscht hätte, sondern weil sie frei sein wollte.
Mittlerweile hätte sie alles für ihr altes Leben gegeben. Die Juden in abgeschlossene Viertel zu drängen, sollte die Nichtjuden vor ihrem Einfluss schützen, aber sie hatte sich dort sicher und als Teil der Gemeinschaft gefühlt. Damals konnten Dalia und sie in den Wald gehen und im Sommer Beeren, im Winter Pilze sammeln, oder im Fluss schwimmen, obwohl sie eigentlich die Wäsche hätten waschen sollen. Sie konnte noch immer Dalias Gekicher hören, wenn sie von den Jungen erzählte, für die sie schwärmte.
»Woran denkt Ihr, Prinzessin Imogen?«, fragte Lord Greymont und setzte sich neben sie. Jocelyn erhob sich und zog sich diskret in eine Ecke zurück, bevor Seraphina sich durch Blicke mit ihr verständigen konnte.
Seraphina sah ihn nur kurz an. »Ich denke gerade daran, wie wundervoll dieses Kissen zwischen den Dutzenden fast identischer Kissen in meinem Zimmer aussehen wird, Lord Greymont.« Eine alte schwarze Katze, die sie Fig getauft hatte, rekelte sich träge neben ihr und schlich dann davon.
Greymont beugte sich vor, als wolle er sich das Kissen genauer ansehen, doch Seraphina glaubte, dass seine Augen eher ihr Dekolleté betrachteten als das Kissen. »Sehr hübsch«, erklärte er, bevor er sich wieder zurücklehnte.
»Nicht wahr«, erwiderte sie affektiert. »Aber seid Ihr nicht hier, um meinen Vater zu unterhalten?«
»Er scheint bestens ohne mich auszukommen.«
Seraphina drehte sich um. Der König sah in der Tat zufrieden aus; er spielte gerade eine Partie Schach mit Giselle, was Nina mit unverhohlener Langeweile beobachtete. Sie war noch immer verbittert, weil sie nicht das Sirenen-Kostüm tragen durfte, das sie sich zum Maskenball an Seraphinas Geburtstag ausgesucht hatte. Aber eine Sirene passte nun einmal nicht zu dem Engelskostüm, das der König für Seraphina vorgesehen hatte. Am Vormittag hatte sie eine Anprobe für ihr weißes Kleid, die Federflügel und das goldene Diadem gehabt, das auf ihrem frisch mit Henna gefärbten Haar sitzen würde.
Giselle entschied, dass Nina, Rose und ihre Hofdamen als Blumen gehen würden. Nachdem der König Seraphinas Kostüm ausgesucht hatte, ohne sich mit ihr zu beraten, war sie entschlossen, die Dinge wieder in die Hand zu nehmen. Nina mochte die Älteste sein, aber Giselle war die Gewiefteste und hatte ihren Vater von ihrem Plan überzeugt, bevor Nina auch nur Gelegenheit gehabt hatte, ihre Meinung zu äußern. Nina würde eine Iris sein, Giselle eine Hyazinthe und Rose ihre namensgebende Blume. Zumindest sie war glücklich, weil sie immer noch Rosa tragen konnte.
»Nun denn«, fuhr Lord Greymont fort. »Wir wissen alle, dass Ihr der Stickerei nichts abgewinnen könnt, und der König ist in guter Hand. Worüber denkt Ihr wirklich nach?«
Sie hätte ihm gern die Wahrheit gesagt. Nicht, weil sie ausgerechnet mit Lord Greymont Vertraulichkeiten teilen wollte, sondern weil ihren Namen auszusprechen Dalia realer gemacht hätte. Dass sie seit fast vier Jahren die Existenz aller leugnete, die sie liebte, erschien Seraphina als die schlimmste Form von Verrat. Sie hoffte, dass es für ihre Eltern eine Erleichterung gewesen war, dass man sie aus der Unbedeutendheit ins Schloss geholt hatte – zumindest wären sie mit dem Gedanken gestorben, dass ihr einziges Kind die Pest überleben würde. Doch vorzugeben, sie hätten nie existiert, beschmutzte ihr Andenken.
Die wahre Prinzessin Imogen hatte sich auf der Reise in ein benachbartes Königreich mit der Mori Roja infiziert und war noch vor ihrer Rückkehr nach Eldridge Hall verstorben. Als Nina, Giselle und Rose die Nachricht überbracht wurde, fürchteten sie, dass ihr ohnehin schon verwirrter Vater endgültig dem Wahnsinn verfallen würde – wie es auch der Bote vermutete, der daher zuerst den Prinzessinnen die Nachricht von Imogens Tod überbracht hatte. Aus Angst, mit ihrem unberechenbaren und manchmal gewalttätigen Vater in einem Schloss eingesperrt zu sein, dessen Mauern auf seine Anordnung hin geschlossen worden waren, damit die Pest nicht nach Eldridge Hall kam, hatten sie das Einzige getan, was ihnen einfiel: Sie veranstalteten eine der Maskeraden, die ihr Vater so liebte.
Seraphina erinnerte sich an ihren letzten Tag außerhalb des Schlosses, als sei es gestern gewesen. Dalia und sie waren durch den Wald gestreift und hatten nach etwas Essbarem gesucht, ihre Hände waren voll dunkler Erde gewesen. Eigentlich durften sie das jüdische Viertel nicht verlassen, aber die Pest rückte immer näher an Esmoor heran und die Wächter waren geflüchtet. Zu Hause herrschten Untergangsstimmung und Panik und alle warteten auf den unvermeidlichen Ausbruch der Seuche. Draußen im Wald schien sich hingegen nichts geändert zu haben.
Dalia, die in Seraphinas Erinnerung so lebhaft und fröhlich war, hatte im Scherz einen Pilz nach ihr geworfen, der einen Fleck auf der Wange ihrer Freundin hinterließ. Seraphinas Haar fiel wie üblich in einem lockeren Zopf über ihre Schulter, sie trug das abgetragenere ihrer beiden Kleider. Es war braun und schlicht, Welten entfernt von der buttergelben Robe, die sie nun anhatte und auf der man jeden Fleck sehen würde – hätte es denn noch einen Anlass für Flecken gegeben.
Als eine elegante Kutsche durch den Wald kam, folgten Dalia und sie ihr in die Stadt, und als sie das jüdische Viertel erreichten, sprachen die Leute bereits davon, dass drei adlige Damen ein Porträt herumreichten und fragten, ob jemand das in Öl gemalte Mädchen kenne.
Die Frauen boten eine großzügige Belohnung für die Information. Als Seraphinas Vater seine Tochter in der Menge entdeckte, hatte er ihr sofort befohlen, nach Hause zu gehen. Doch die Menschen starrten sie an und deuteten mit dem Finger auf sie. Da Seraphina das Porträt nicht gesehen hatte, verstand sie den Grund nicht. In guten Zeiten hätten sich die Nachbarn nie gegeneinander gewandt, aber nun waren alle verzweifelt. Seraphina blieb nur ein Moment, um sich von Dalia zu verabschieden, dann wurde sie nach Hause gebracht.
Kurz darauf kamen die Damen mit ihren Dienerinnen in ihr Haus, und Seraphina war entsetzt und gekränkt, als eine die anderen tuschelnd auf den Fleck auf Seraphinas Wange aufmerksam machte. Dass sie ihn schnell mit dem Ärmel abwischte, hatte die Damen nur noch mehr zum Kichern gebracht.
Giselle, schon damals unübersehbar die Rädelsführerin, flüsterte ihren Schwestern zu, dass Seraphina nach ein wenig Haarfarbe und einem Bad perfekt wäre. Konnten sie nicht einmal einen Moment über die Religion des Mädchens hinwegsehen? Rose schien Angst zu haben, etwas anzufassen, und sagte so gut wie nichts.
Schließlich trafen sie eine Entscheidung. »Sie wird genügen«, sagte Giselle, auch wenn Seraphina noch immer keine Ahnung hatte, wofür. Giselle reichte Seraphinas Vater eine große Börse, doch er schüttelte den Kopf und weigerte sich, das Geld anzunehmen. Angst bekam sie erst, als ihre Mutter zu weinen begann. Die beiden großen Wächter mussten den Kopf einziehen, um durch die Haustür zu passen. Einer packte sie wortlos am Arm. In diesem Moment begann ihre Mutter, Klagelaute auszustoßen, und ihr Vater fiel auf die Knie und flehte, ihre Tochter nicht mitzunehmen.
»Betrachte es einfach als einen Mund weniger, den du stopfen musst«, hatte Giselle erwidert und war mit gerafften Röcken aus der Tür geeilt. Die Wächter zerrten Seraphina hinter sich her.
»Vorsicht«, rief ihnen Giselle über die Schulter zu. »Passt auf, dass sie keine blauen Flecken bekommt. Das würde Vater nicht gefallen.«
Seraphina hatte diese Worte nie vergessen. Sie führten dazu, dass sie es umso mehr auskostete, sich Verletzungen zuzufügen. Gerade presste sie einen Daumen auf einen frischen blauen Fleck auf ihrem Handgelenk und lächelte Lord Greymont an.
»Ich denke an den Ozean. Ich frage mich, ob Ihr ihn tatsächlich gesehen habt oder ob Ihr Euch bloß an meinem Geburtstag den ersten Tanz sichern wolltet.«
»Ich würde Euch niemals anlügen.«
Sie legte ihre Stickarbeit beiseite und bemerkte den Blick eines Dienstmädchens, das sofort davoneilte, um Tee zu holen. »Nun gut. Lasst uns ein Spiel spielen. Es heißt ›Richtig oder falsch‹. Ich werde Euch etwas über mich erzählen, und Ihr müsst raten, ob es wahr oder gelogen ist.«
Als er die Stirn runzelte, wirkte er jünger als zweiundzwanzig, eher wie die Jungen, die Seraphina in ihrem Viertel gekannt hatte. Sie hatte damals zwei oder drei geküsst, und obwohl sie nicht so gut ausgesehen hatten, waren sie ihr so unendlich viel wirklicher vorgekommen als Lord Greymont und die anderen Adligen hier.
»Aber ich habe Euch doch gerade versichert, dass ich Euch niemals anlügen würde«, protestierte er.
»Es gehört zum Spiel. Und jetzt werde ich den Unterschied kennen, wie Ihr ausseht, wenn Ihr die Wahrheit sagt und wenn nicht.«
Er grinste, seine grün gesprenkelten braunen Augen leuchteten.
Seine Haut, die Seraphina von ihrer Ankunft als tiefbraun in Erinnerung hatte, war nun heller und erinnerte Seraphina an Dalias olivfarbigen Teint. Imogen war ebenso blass gewesen wie sie mittlerweile, sie hatte bloß mehr Sommersprossen gehabt. »Nun gut.«
Sie lächelte ihr bezauberndstes Lächeln. »Meine Lieblingsfrucht ist die Clementine.«
Er biss sich einen Moment auf die Lippe und überlegte. »Falsch.«
»Woher wisst Ihr das?«
»Weil Ihr immer Erdbeertörtchen als Dessert nehmt. Und Ihr esst zuerst alles andere von dem Törtchen, den Teig und die Sahne, bevor Ihr Euch die Erdbeeren schmecken lasst. Ihr esst sie, als könnten es Eure letzten sein.«
Seraphina spürte, wie ihr die Röte den Hals und die Wangen hinaufkroch. Es war schließlich nicht ihre Schuld, dass Prinzessin Imogen ihre Erdbeertörtchen wie ein lüsternes Eichhörnchen verspeist hatte. »Oh, da beobachtet aber jemand sehr genau.«
»Es ist schwer, den Blick abzuwenden«, erwiderte er mit leiser Stimme.
Seraphina hätte das Dienstmädchen am liebsten dafür geküsst, dass es genau in diesem Moment den Tee vor sie stellte und ihr eine Antwort ersparte.
Lord Greymont räusperte sich und lehnte sich zurück. »Jetzt bin ich an der Reihe«, sagte er und sah das Dienstmädchen an, das ihm den Tee reichte. »Vielen Dank, Miss.«
Als das Mädchen zusammenzuckte und Tee auf die Untertasse schwappte, tat er, als bemerke er es nicht. »Ich war elf, als ich auf einem Schiff mitgesegelt bin«, sagte er zu Seraphina. »Von hier zur Isle of Wye und zurück.«
»Wye? Wozu denn das in aller Welt?«
»Mein Vater importierte Wein vor der … Früher. Er reiste jedes Jahr nach Wye und sah nach seinem Weingut. Und einmal nahm er mich mit, nur das eine Mal.« Er nippte an seinem Tee und stellte ihn lächelnd ab. »Ihr habt jedes Wort geglaubt, oder?«
Sie blinzelte und merkte, dass sie gestarrt hatte. »Ich … ja, wohl schon. Vermutlich habe ich es geglaubt.«
»Weil es die Wahrheit war.«
Wenn die Gerüchte stimmten, hatte sich die Pest über den ganzen Kontinent ausgebreitet. Nur die Inseln waren sicher gewesen, vorausgesetzt, niemand schleppte die Seuche mit dem Schiff ein. »Ist Eure Familie nach Wye gegangen, als die –«
»Ihr seid dran, Prinzessin.«
Seraphina hätte ihn am liebsten dafür erwürgt, dass er sie mitten im Satz unterbrach, doch dann bemerkte sie, dass der König nicht mehr Schach spielte. Er war herübergekommen und hatte sich hinter sie und Lord Greymont gestellt, nun beobachtete er sie von oben und musterte sie kritisch unter seinem Bart. In seinen sonst so ruhigen blauen Augen lag Verärgerung. Ihr wurde bewusst, was sie im Begriff gewesen war zu sagen.
Sie stellte ihre Teetasse ab. Als sie sich erhob, strich sie ihr Kleid glatt, um die feuchten Handflächen abzuwischen. »Und, Vater, wer hat das Spiel gewonnen?«
Nina, die neben ihm stand, lächelte. »Warum fragst du, Vater natürlich. Wie könnte eine Prinzessin gegen einen Meisterstrategen ankommen?«
Es gab Lügen, denen selbst Seraphina gern frönte. Der König spielte grottenschlecht Schach. »Oh, gut gemacht, Vater«, sagte sie und küsste ihn auf die Wange. Die Prinzessinnen hatten ihr wochenlang beigebracht, ihre tote Schwester nachzuahmen: wie sie den Vater küsste, um sein berüchtigtes Temperament zu besänftigen, wie sie ihre Erdbeertörtchen aß. In Wirklichkeit machte sich Seraphina nichts aus Erdbeeren. Clementinen waren wirklich ihr Lieblingsobst, auch wenn sie seit Jahren keine mehr gegessen hatte. Der König war besänftigt, die Düsterheit wich aus seinen Augen, er hielt seiner ältesten Tochter den Arm entgegen. »Heute kann mich Nina begleiten. Amüsiere dich weiter mit Lord Greymont, meine Liebe. Ich sehe dich beim Abendessen.«
Nachdem er weg war, nahm Seraphina wieder Platz und atmete langsam aus. Sie hatte angenommen, dass es ihr mit der Zeit leichterfallen würde, jemand anderen darzustellen, doch sie fand es mit jedem Jahr beschwerlicher. Einfach sie selbst zu sein war ein Luxus, den sie für selbstverständlich gehalten hatte.
Es dauerte einen Moment, bis ihr auffiel, dass fast alle den Raum verlassen hatten. Rose und Giselle waren noch da und spielten in der Ecke gegenüber Karten. Jocelyn beobachtete sie heimlich aus einer anderen Ecke. Seraphina durfte niemals mit einem Mann allein gelassen werden, aber Jocelyn verstand sich darauf, sich unsichtbar zu machen.
Hatte Lord Greymont gerade sie vor dem König gerettet oder sich selbst? Im Schloss war es verboten, die Pest zu erwähnen, und jeder, der zu fliehen versuchte, wurde bestraft. Nachdem die ersten drei Dienstboten gehängt worden waren, hatten die Versuche bald aufgehört. Alle mussten so tun, als sei die Pest in Goslind nie ausgebrochen. Nur so konnte die Illusion aufrechterhalten werden und in Seraphinas Augen spielten alle ihre Rolle gern. Andererseits, wenn sie schauspielerte, taten es andere womöglich auch. Man konnte nie wissen.
Oder vielleicht doch.
»Wir können das Spiel ein anderes Mal fortsetzen.« Lord Greymont spürte ihren Stimmungsumschwung.
Sie hatte keine Ahnung, ob der König jemals bereit sein würde, die Schlosstore wieder zu öffnen, aber sie konnte nicht ewig so weiterleben. Sie hatte schon vor Jahren die Flucht erwogen, aber dann dachte sie immer wieder an die Worte, die ihr Vater ihr zugeflüstert hatte, als sie ihn das letzte Mal umarmt hatte. Es waren die Worte gewesen, die der Rabbi gesprochen hatte, als sich das koschere Essen im Ghetto dem Ende zuneigte und einige sich weigerten zu essen: Hütet euer Leben.
Wenn die Familie von Lord Greymont ein Weingut auf einer Insel besaß, gehörte ihnen womöglich auch ein Schiff. Und auf einem Schiff konnte Seraphina König Stuart und seinen Hof weit, weit hinter sich lassen.
»Noch eine Runde.« Sie straffte lächelnd die Schultern. Der König hasste es, wenn sie die Stirn runzelte.
Greymont senkte dienstbeflissen den Blick. »Ich stehe zu Eurer Verfügung.«
Der Tee war kalt geworden, sie nahm einen Keks und knabberte geziert an einer Ecke. Er war ungesüßt, wie sie erwartet hatte. Die Zuckervorräte gingen zur Neige, und wenn schon die trockenen Vorräte zu Ende gingen, sah es auch für frische Lebensmittel nicht gut aus. »Ich werde in zwei Wochen zwanzig.«
»Natürlich richtig.«
Er hatte nicht eine Sekunde gezögert. Sie sah ihn an und hielt seinem Blick stand, und zwar länger, als schicklich war. »Seid Ihr Euch Eurer Antwort sicher, Lord Greymont?«
Er wollte antworten, doch dann sah er sie fragend an und lehnte sich auf dem Sofa zurück. »Warum habe ich das Gefühl, dass Ihr ein anderes Spiel spielt als ich, Eure Hoheit?«
Etwas in seinem Blick ließ Seraphinas Puls schneller schlagen. Den König davon zu überzeugen, dass sie Imogen war, fiel ihr beinahe erschreckend leicht – er hatte keinen Grund, anzuzweifeln, dass sie seine Tochter war, und außerdem war er halb verrückt. Doch manchmal fragte sie sich, warum niemand sonst bei Hof auffiel, dass sie eine Doppelgängerin war. Ja, Imogen war die scheuste der Prinzessinnen gewesen, und als Vierte in der Erbfolge war ihr nicht die gleiche Aufmerksamkeit zuteilgeworden wie Nina und Giselle oder selbst Rose. Aber immerhin war Seraphina eine völlig andere Person, um Himmels willen.
»Wenn Ihr mich unbedingt etwas nennen müsst, sagt bitte Prinzessin Imogen. Eure Hoheit klingt so umständlich und formell.«
Er legte seine Hand zwischen sie auf das Sofa, so nahe, dass seine Finger den Stoff ihres Rockes streiften. »Nun denn, Prinzessin Imogen.« Er lächelte leicht. »Falls Euer Geburtstag nicht in zwei Wochen ist, kann ich Euch Eurer Geschenk ja vielleicht sogar früher machen.«
Ihr Blick wanderte von seinen Augen zu seinem Finger, der ihr Samtkleid berührte. Seraphina hatte nie über eine romantische Beziehung auf Eldridge nachgedacht. So ablenkend eine Liebelei auch gewesen wäre, jemanden zu nahe an sich heranzulassen, war gefährlich. Früher oder später würde ihr ein Fehler unterlaufen und sie würde ihre wahre Identität preisgeben.
Doch dieser Lord war nicht ganz so einfältig wie die anderen, und sie wusste genug von Männern, um sich sicher zu sein, dass er sie begehrte. Ein Verbündeter auf Eldridge Hall war vielleicht genau das, was sie brauchte. Jemand, der ihr half, wenn der Lügenturm einstürzte. Die Seuche würde irgendwann vorbei sein, wenn sie nicht sogar schon vorbei war, und wenn erst die Vorräte zur Neige gingen, würde das schlimmere Folgen haben als fade Biskuits.
Als sie sich erhob und die Röcke raffte, ließ sie ihre Hand einen kurzen Moment über seine streifen. »Ihr habt gewonnen«, sagte sie, als Rose und Jocelyn zu ihnen eilten.
Er stand auf und legte den Kopf schief. »Habe ich das?«
»Ihr hattet beide Male recht. Erdbeeren mag ich von allen Früchten am liebsten und in zwei Wochen werde ich zwanzig.«
»Beim Maskenball!« Rose lächelte charmant, doch Jocelyns Blick wanderte zwischen Lord Greymont und Seraphina hin und her.
»Ich glaube, das Spiel ist noch nicht vorbei, Prinzessin Imogen.« Er verbeugte sich übertrieben. Und im Gehen flüsterte er, sodass es sie an der Schulter kitzelte: »Ich bin Euch immer noch eine Lüge schuldig.«
Kapitel 4
Miss Talbot blieb mehrere Tage zu Gast bei Lord Crane. Kurz nach ihrer Ankunft war ein starker Sturm aufgezogen, unter solchen Umständen hätte der Herr eine Dame niemals fortgeschickt. Doch als Nico sie eines Nachmittags allein im Arbeitszimmer antraf, schien sie unbedingt aufbrechen zu wollen.
Nico staubte ein Bücherregal ab und tat, als würden ihn Elisabeths Seufzer und Gemurmel nicht ablenken, doch dann stellte sie sich neben seine Leiter.
»Wie haltet Ihr es hier aus?«, flüsterte sie und zog ein Buch aus dem Regal.
»Wie meint Ihr das, Miss Talbot?«
Sie blätterte abwesend durch die Seiten und wedelte den aufgewirbelten Staub weg. Hätte sie nachgefragt, hätte Nico ihr erklärt, dass das Buch in ihren Händen zweihundert Jahre alt war und recht ansprechende Prosa enthielt. »Offenbar kontrolliert Lord Crane alles und alle hier. Als ich ihm heute Morgen erklärte, dass ich abreisen möchte, hat er es mir untersagt. Er meinte, er würde mich festbinden, wenn ich auch nur einen Versuch unternähme.«
Sie war neunzehn, genauso alt wie Nico, aber ihre Stimme hatte einen kindlichen, bockigen Unterton.
»Er möchte Euch garantiert nur in Sicherheit wissen. Der Wald wird sich zwischenzeitlich in einen Sumpf verwandelt haben. Wenn Euer Pferd lahmt, bleibt Ihr dort stecken.« Als sie das Buch an den falschen Platz im Regal zurückstellen wollte, stieg er von der Leiter. »Hierher.« Er nahm ihr das Buch ab und stellte es ehrfürchtig an den richtigen Ort.
»Immerhin habe ich es allein bis hierher geschafft, oder?« Sie ließ sich auf ein Sofa fallen und verschränkte die Arme vor der Brust. »Wenn ich gut vorankomme, ist Eldridge Hall nur fünf Tagesreisen von hier entfernt. Und Locket würde niemals zulassen, dass mir etwas passiert.«
Nico hörte Elisabeths Kommentar nur mit halbem Ohr, die Schimmelstute war zwar lammfromm und gutmütig, aber eben trotzdem nur ein Pferd. Seine Aufmerksamkeit galt etwas anderem. »Eure Familie hält sich im Schloss auf?«
Elisabeth seufzte und spielte mit den goldenen Fransen eines Samtkissens. »Mein Bruder war dort, soviel ich weiß. Aber ich habe seit Jahren nichts mehr von ihm gehört.«
Nico legte den Staubwedel beiseite und setzte sich Elisabeth gegenüber auf ein Sofa. »Ich sage es Euch nicht gern, aber Gerüchten zufolge hat der wahnsinnige König den Adel bei sich eingesperrt. Sie hatten nicht annähernd genug Lebensmittel, um so lange durchzuhalten.«
Ihre Stirn legte sich in Sorgenfalten, doch dann reckte sie trotzig das Kinn. »Wenn dem so ist, reise ich weiter zu unserem Haus und sehe nach, ob noch jemand dort lebt. Mutter und Vater haben mich sofort weggeschickt, als sie von der Pest erfuhren. Eigentlich wollten sie nachkommen, aber vielleicht haben sie entschieden, dort abzuwarten. Vielleicht sind sie nun alle vereint.«
Nico fragte sich, ob ihr bewusst war, wie naiv sie klang, beschloss jedoch, nicht weiter nachzuhaken. Hätte die geringste Hoffnung bestanden, dass seine Familie noch am Leben war, hätte er genauso gehandelt. »Noch einen Tag zu warten, bis sich das Wetter bessert, kann sicher nicht schaden«, sagte er. »Und eine weitere Nacht in einem warmen Bett bestimmt auch nicht.«
Sie sah ihn an, ihre Augen waren noch größer als sonst. »Was soll das heißen?«