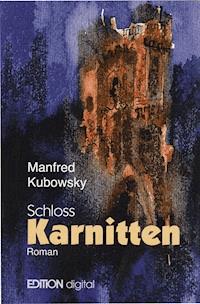
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vielfältige Recherchen führen den Autor zunächst in das Russland um 1700. Hier begegnet er dem russischen Landadligen Petrus Dobrovskij, dessen Nachkommen sich in halb Europa verstreuen. Ein zentraler Punkt ist das Schloss Karnitten eines walisischen Barons in Ostpreußen, wo der junge Schlossgärtner Gustav sein Vaterland verlässt, um in Potsdam Wildpark die Königlich Preußische Gärtner-Lehranstalt zu besuchen. Erst kaisertreu und später mit nationalsozialistischer Gesinnung wird er in der Prominentensiedlung Kolonie Alsen in Berlin-Wannsee leben. Sein Enkel wird im Osten Berlins geboren und wächst in die DDR und in das später wiedervereinigte Deutschland hinein. Es ist die überaus facettenreiche Geschichte einer ost-westlichen Familie über dreihundert Jahre, beeinflusst von den Ereignissen dieser Jahrhunderte und deren Protagonisten, von Katharina der Großen, über die Preußenkönige, Kaiser Wilhelm II., u.a. bis in die heutigen Tage hinein... INHALT: Prolog I. Buch: Erfrorene Sterne 1. Das gute Dorf 2. Geteilte Wege 3. Die Feuersbrunst 4. In alle Winde 5. Ein Jahrhundert beginnt mit Rumoren 6. Marie 7. Morgendämmerung II. Buch: Kreuzwege 1. Christoph 2. Karnitten 3. Schliemannstraße 16 4. Anna Marie Preuß 5. Verworrene Jahre 6. Andere Zeiten 7. Der Bruch 8. Der Kleinbürger 9. Der Schmied Pontek III. Buch: Der Jahrhundertsprung 1. Nachbeben 2. Der Flensburger Löwe 3. Glück im Unglück 4. Trümmer und Rosen 5. Der alte Nazi 6. Die Dolmetscherin 7. Wollen und Werden 8. Versuchsanordnungen 9. Die Freiheit bricht aus 10. Die neuen Untertanen 11. Angekommen 12. Karnity Anmerkung des Autors Die handelnden Hauptpersonen des Romans
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Impressum
Manfred Kubowsky
Schloss Karnitten Der Weg der Väter
Roman
ISBN:
978-3-931646-85-1 (E-Book)
EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Alte Dorfstraße 2 b 19065 Godern
Tel.: 03860-505 788 Fax: 03860-505 789 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.com
Dieses Buch widme ich meiner lieben Frau Astrid, ohne deren große Hilfe und produktive Kritik das Werk so nicht zustande gekommen wäre, sowie meinem väterlichen Freund und Förderer, Prof. Dr. Dr. Horst Kunze (†)
Für die vielfältige Unterstützung meiner Arbeit danke ich ganz herzlich: Gisela Pekrul, Godern, Dr. Margot Krempien, Schwerin, Prof. Dr. Benno Pubanz, Güstrow, Erika und Dr. Jürgen Borchardt, Schwerin, Marion und Peter Ruthner, Pingelshagen, sowie Petra und Rainer Stankiewitz, Schwerin.
Prolog
DAS DÖRFCHEN DOBROVO lag ungefähr 30 Kilometer nordwestlich von Moskau, an der Linie von Klin im Norden bis Istra im Süden. Südlich der Volokolamsker Chaussee gelangte man zunächst nach Visokovo, dann über Dobrovo nach Troitskoje oder Petrovskoje.
Von hier aus brauchte man zu Pferde knapp zwei Stunden um zum Novojerusalimski Monastir, dem Kloster Neujerusalem bei Istra zu gelangen. Das Kloster war eines der prächtigsten im alten Russland; 1656 von dem Patriarchen Nikon gegründet wurde es im Verlaufe der Jahre weitläufig ausgebaut. Es erhielt viele Gebäude mit goldenen und kupfernen Kuppeln und einen hohen Glockenturm. Im 17. Jahrhundert wurde das Kloster durch eine umfangreiche Bibliothek bereichert; prachtvolle Handschriften aus mehreren Jahrhunderten sowie frühe russische Drucke fanden hier ihre Heimstatt.
Das Gut Dobrovo und etliche der umliegenden Weiler und Dörfer, die zum Besitz der Familie Dobrovskij gehörten, existiert heute nicht mehr. Ende Oktober 1941, als die Hitlertruppen etwa sechzig Kilometer vor Moskau standen, hatten die deutschen Panzer den Ort vollständig niedergewalzt. Das Kloster Neujerusalem bei Istra war schwer beschädigt und von den Deutschen geplündert worden. Den Glockenturm hatte man gesprengt.
Die Deutschen hatten im Sommer 1941 in den gewaltigen Kesselschlachten von Wjasma und Brjansk zunächst gesiegt und 670 000 sowjetische Soldaten gefangen genommen. Bei diesen Schlachten und danach wurden unzählige Dörfer und Siedlungen dem Erdboden gleich gemacht, die Bewohner getötet oder vertrieben. Von Anfang Oktober bis Ende November waren die Deutschen bis zu der Linie Wjasma im Süden über Moshaisk und Istra bis Klin im Norden vorgestoßen; damit wurden auch Visokovo und Petrovskoje eingenommen, während Dobrovo vom Erdboden verschwand.
Das im barocken Stil erbaute kleine Landschlösschen, die weiße Kirche, die Speicherhäuser, Stallungen und die Häuser der Landarbeiter wurden vom Krieg gefressen. Übrig blieb eine Trümmerwüste, derer sich über Jahrzehnte hinweg die Natur erbarmte. Sechzig Jahre später fand man die Stelle, an der das Dorf stand, frei von Kriegsspuren; einige wenige Gebäudereste und Fundamente waren vom Grün überwuchert. Der kleine See aber glänzte wie eh und je silbern inmitten heller, leuchtender Birkenwälder, die hier und da von Kiefern und Buchen durchmischt waren. In der Mitte des Juni, zur Sonnenwendzeit, zeigte sich die Landschaft hell und strahlend, so als wollten sich aus den überwachsenen Steinresten die hellen Häuser, die Kirche, das Gutshaus wieder erheben, wie Phönix aus der Asche.
Doch dies geschah nur in der Fantasie des Nachfahren; das Dorf der Vorväter erstand in seinem Geiste wieder, mit ihm die Menschen und ihr Leben, auch Petrus Dobrovskij erstand wieder, ein unbedeutender russischer Landadliger aus der Zeit des Zaren Peter dem Großen. Während mit Petrus die eigentliche Geschichte der Familie beginnt, ist über dessen Vater Jewgenij nur wenig bekannt. Man weiß nicht einmal genau, ob er Jewgenij oder Jegor hieß, wann er geboren und wann gestorben war. Erzählt wird, dass er seine Ehefrau, eine Moskauer Dame, die einer Beamtenfamilie entstammte, durch eine Epidemie verlor. Die Cholera hatte damals auch fast die Hälfte der vierhundert Seelen, die seine Dörfer und Güter bevölkerten, dahin gerafft.
Seine Zugehfrau, die ihm das Essen servierte, das Bett mit heißen Ziegelsteinen wärmte, den Salon, der keine Gäste mehr empfing, entstaubte, sie servierte ihm mit der Zeit auch Zuneigung und mehr. So schuf Jewgenij oder Jegor in einer lauen Frühjahrsnacht die Voraussetzungen für die Geburt von Petrus.
Die Überlieferung besagt, dass die Kindsmutter sich zur Zeit der Geburt in Petrovskoje aufgehalten habe; dies wie auch die tiefe Frömmigkeit des Vaters, der oftmals das Kloster Neujerusalem besuchte, um in der Bibliothek zu stöbern und die Mönche zum Dank mit Kohl, Brot und frischem Kwas zu versorgen, - das seien die Gründe gewesen für den sehr religiösen und kaum russischen Namen des Knaben: Petrus.
Doch zwei Empfindungen quälten fortan Jewgenijs Brust, die sich heftigst bekämpften: er hatte Gott gelästert, indem er mit einer Niederen sich dem fleischlichen Genusse hingegeben hatte; andererseits dankte er Gott für den Sohn, der nun sein ein und alles war, und heiratete die Zugehfrau, was ihm die Missbilligung von benachbarten Bojaren und Grundbesitzern sowie der eisern-gottesfürchtigen Popen einbrachte. Glückwünsche und Besuche wurden ihm verweigert, in der Kirche war er gerade noch so geduldet, wenn auch das drohende Murmeln der Kirchgänger und die scheelen Blicke unter schwarzen Tüchern und dunklen Krempen nicht zu übersehen waren.
Jewgenij oder Jegor aber war offenbar nicht der Mann, der leicht einzuschüchtern war. Allzu hart hatte ihn das Leben angepackt, der schleichende Tod, kriegerische Horden, welche die Dörfer verwüsteten, die Dürren und die eisknarrenden russischen Winter, Stürme, die über das Land brausten und das Korn niederlegten, Feuersbrünste und Heuschreckenplagen, er konnte sich an nichts erinnern, an was er sich nicht erinnern konnte, was er nicht erlebt haben sollte an Widrigkeiten und Gottesprüfungen.
Mit großem Schauder aber dachte er noch oft an jenen sonnigen Sommertag in Moskau im Jahre 1671, als er noch ein kleiner Knabe war; sein Vater oder auch sein Großvater hatte ihn an der Hand zum Roten Platz geführt, wo gerade die Schergen des Zaren Stepan Rasin, den Führer der rebellischen Bauern zum Schafott führten. Wild und entschlossen hatte Stenka auf die Menge herab geblickt und keinerlei Angst gezeigt. Und konnte doch den Scharfrichtern nicht entkommen. Und während zwei ihn auf den Richtblock pressten und das Halseisen schlossen trennte der dritte mit einem gewaltige Hieb Stenkas Kopf ab, der mit dumpfem Schlag auf die Bretter fiel. Und als die Menge ringsum aufstöhnte, waren Furcht und blankes Entsetzen in Jewgenijs Augen und er fing an zu weinen. So wurde erzählt.
Er war heil heraus gekommen aus aller Unbill seines Lebens, hatte alles bestanden, mit zugegriffen, wenn es nötig war, wie ein Knecht, ein Holzfäller, hatte anderen Trost gespendet und manchen Rubel dazu, wenn Not und Hunger am schärfsten schnitten.
Und wenn man sagte, der Name Dobrovo bedeute eigentlich Gutes Dorf, so sagte man auch bald, Dobrovskij bedeute Guter Mensch. In der Tat war Jewgenij, wie erzählt wurde über Generationen hinweg, für seine Zeit ein besonders guter Herr, der ein Herz auch für den kleinsten seiner Knechte und Leibeigenen hatte; bei einem solchen Herrn musste kein Stenka die Bauern aufwiegeln und dafür seinen Kopf verlieren.
So schob er auch die Unbill, die von den anderen ausging, schlicht beseite, freute sich an seiner Frau, die wohl an die dreißig Jahre jünger war, und an seinem Sohn, den er, wie um Gott zu besänftigen, Petrus nannte und den er aufzog zu einem Wesen voller Kraft und Mut, freiheitsliebend, ehrlich und menschlich, dabei dem Praktischen und Nützlichen äußerst zugetan.
Mehr ist von Jewgenij oder Jegor, der irgendwann, als Petrus schon lange flügge war, still und heiter starb, nicht zu berichten. Sein Grabstein, der einst auf dem kleinen Kirchhof von Dobrovo leuchtete, wird nun irgendwo unter der westrussischen Erde ruhen, mit abgeflachter, ausgewaschener, nicht mehr lesbarer Inschrift, so dass auch niemand mehr erfahren kann, wann und als wessen Sohn er das Licht der Welt erblickte.
Der erste Geist also, der für den späten Nachfahren zu neuem und beredtem Leben aufstand, war wirklich allein Petrus Dobrovskij. Er war an einem sehr sonnigen Maitage des Jahres 1705 erwacht, im Gutshaus von Petrovskoje, wo der kleine Knabe inmitten von Schreien, Ächzen, Schweiß und Blut geboren, in einem Zuber gebadet und in weiße Tücher gehüllt wurde...
I. Buch: Erfrorene Sterne
1. Das gute Dorf
Seltsam sieht der Karren aus, der an diesem heißen Sonntagnachmittag, aus Richtung Moskau kommend, die staubige, in der unbarmherzigen Sonne flirrende Sandstraße südwestwärts rumpelt. Der ziemlich lange hölzerne Kasten, der zum Transport allerlei Güter bestimmt ist, trägt in der vorderen Hälfte, hinter dem Bock, einen groben, hausähnlichen Bretteraufbau, der nur auf der linken Seite eine Tür mit pergamentbespanntem Fenster besitzt. Der Wagen ist an die sechzehn Fuß lang und ungefähr fünfeinhalb Fuß breit und mit grüner Farbe angestrichen, die nicht zur Gänze gereicht hat, weshalb man noch Blau dazu nahm.
Man hat frühe Kartoffeln, Gurken und allerhand lebendes Geflügel in die Stadt gebracht. Eigentlich hatte Petrus Dobrovskij, Besitzer des Gutes, die Waren nach Moshaisk bringen wollen, das war westlich und nur ein Drittel der Moskauer Wegstrecke. Doch Gawruschka meinte, in Moskau könne man um diese Zeit einen doppelt so hohen Preis erzielen, wenn nicht gar das Dreifache. Ach Gott, bis nach Moskau, nein, Petrus hatte eigentlich gar keine Meinung zu dieser Weltreise gehabt. Fünf volle Tage! Zwei für jede Strecke. Man musste irgendwo übernachten, ach, vielleicht fiele man noch räuberischem Gesindel in die Hände.
Aber Gawruschka, der große, starke Gawruschka hatte seinen Herrn überzeugt, die Muskete, genügend Blei und Pulver und seinen alten Säbel mitgenommen und auf ging es, nach Moskau, der riesigen Stadt, fast so groß wie Petersburg sollte sie inzwischen sein.
Petrus Dobrovskij ist von ziemlich schmaler Konstitution, nicht eben groß zu nennen, von der Sohle bis zum Scheitel misst er gerade einmal einen Meter und fünfundsechzig Zentimeter. Dennoch kann man ihn nicht als unscheinbar bezeichnen. Das schmale, wettergebräunte Gesicht mit den blaugrauen Augen, von buschigen, dunklen, ein wenig langhaarigen Brauen begrenzt, strahlt Willen, Sicherheit und zugleich Güte aus. Wer dem Petrus begegnet, dem öffnen sich sogleich diese Eigenschaften, wenn gleich man nach längerer Bekanntschaft bemerkt, dass dieses Wesen auch mit Zurückhaltung, mit abwartender und auf Ausgleich gerichteter Ruhe gepaart ist. Das schließt seinen Hang zur Fröhlichkeit nicht aus, die oftmals bis zu jungenhafter Scharlatanerie geht; besondere Freude macht es Petrus, wenn es ihm gelingt, bei anderen durch abstruse Behauptungen großes Erstaunen und fragende Gesichter mit weit aufgerissenen Augen hervorzurufen.
„Denk’ bloß mal, Marfutschka“, hatte er eines Tages das Wort an seine kleine Frau gerichtet, und dies mit sehr ernster Miene, „ich kann es nicht fassen, aber unser Hengst Jossip, der da drüben brav auf der Wiese weidet, er hat doch über Nacht große weiße Flecken auf seinem dunklen Fell bekommen, Gott im Himmel, wie ist so etwas nur möglich?“
„Was du nicht sagst, Petruschka, das ist ja ganz schrecklich! Hat denn ein Tunichtgut unseren Jossip angemalt? Oder hast du den Hengst schlecht behandelt und der liebe Gott hat ihm zur Mahnung an uns ein Zeichen aufgesetzt?“
Marfa bekreuzigte sich hastig und lief schnell, mit gerötetem Gesicht und angstvollen Augen vor das Haus; nach einer kleinen Weile kehrte sie kreischend zu Petrus zurück, der mit Unschuldsmiene da stand, die Kiefer zusammen gepresst, um nicht laut heraus zu lachen.
„Du boshafter Teufel, du Erzschelm! Hast du es wieder einmal geschafft, mich aus der Contenance zu bringen! Ach du, veralberst dein altes treues Weib!
Das ist doch Gawrilos Kuh, die schwarz und weiß gefleckte, die dort weidet. So ein scheußlicher Kerl, nein! Herrgott, womit habe ich diesen Undankbaren verdient, warum muss ich so ein schweres Los tragen, mich immer wieder so erschrecken und grämen?“
Marfa drehte sich abrupt zur Seite, so dass Petrus ihr Gesicht nicht sehen konnte, zuckte mit den Schultern, als würde sie leise in sich hinein schluchzen, was nun aber Petrus so erschreckte, dass er sie ganz sacht von hinten umfasste und mit schmeichelnder Stimme sagte:
„Ach, Marfutschka, mein graues Täubchen, weine nicht, es tut mir weh, es tut mir so unendlich leid...“, da drehte Marfa sich zu ihm um, verschmitzt lächelnd und mit strahlenden Augen; sie hatte sich revanchiert.
Der Wagen rumpelt durch Kuhlen und über Steine, die von den Feldern her den Weg durchwanderten. Petrus sitzt schaukelnd auf der Bank im Innern des Kastens und hängt seinen Gedanken nach.
Ihre Geschäfte waren gut gegangen und Petja war jetzt eigentlich doch sehr froh, dass er Gawruschkas Rat bedacht hatte. Diese Reise hat sich wirklich gelohnt, und behaglich tastet er den Beutel mit den verdienten Rubeln ab.
Nun sind sie auf dem Heimweg, ja, nach Hause, endlich nach Hause, zu Marfa und all den anderen, und zu seinem Jossip auch. Der Hengst mit den weißen Flecken, denkt Petrus, kneift die Augen zusammen und lächelt still in sich hinein.
Vorne auf dem Kutschbock döselt Gawruschka vor sich hin. Trotz der großen Hitze trägt er eine Pelzschappka, die ihm von Zeit zu Zeit von dem Geruckel auf die Nase rutscht. Dann hebt er den Kopf, schiebt die Schappka mit dem Peitschenstiel nach hinten und treibt mit einem schlappen Schlag des Leders die kräftigen Braunen an:
„He, he, ihr faulen Teufel! Soll ich euch Beine machen? Wenn ihr so weiter zottelt, sind wir zu Großmutters Himmelfahrt noch nicht zuhause! Wollt ihr wohl zulegen, ihr gottverfluchten Hundesöhne?“
Dann nickt er wieder ein wenig ein, der Kopf sinkt ihm schwer auf die Brust, das macht nichts, denn die Pferde kennen ihren Weg, und sie gehen keinen Schritt schneller, sie trotten und schnaufen gleichmütig dahin durch die endlose Weite und kümmern sich nicht um Gawruschka, der schließlich wieder einmal erwacht und ihnen zeigt, wer hier der Herr ist: „Ah, ihr Packzeug, ihr Rabenschweine, verschlafene...“
Da öffnet Petja in seinem Kasten ein wenig die Tür des Verschlages und ruft Gawruschka energisch zu: „Hetze die Tiere nicht so, Gawrilo, bist ein verdammter Antreiber, du wirst sie mir noch in den Tod hetzen in den sicheren, o je, was sagt man dazu? So ein Schinder!“
Das ist ihre Unterhaltung, ihre ständig wiederkehrende Abwechslung bei dieser langen, eintönigen Fahrt. Dann und wann machen sie Halt, sitzen auf einem Feldstein oder einem umgestürzten Baum am Rande des Weges und wickeln aus Leinentüchern Käse und schwarzes Brot und ein Stück Speck, essen, trinken ein paar Schluck des warmen Wassers aus der Tonkruke, wischen sich Brotkrumen, Käsereste und Wassertropfen aus den Bärten und setzen ihre Fahrt fort.
Gawrilo schiebt sich die Schappka in den Nacken und treibt seine Gäule an, nun, im Gedanken an Petrus, mit etwas sanfteren Tönen: „Na los schon, meine lieben, trabt voran, es ist doch nicht mehr so weit bis in euren Stall, das schafft ihr doch, ich weiß es...“
Gawrilo ist, äußerlich betrachtet, das ziemliche Gegenteil seines Herrn. Auf kräftigen, breiten Schultern sitzt ein massiger Kopf, der, im Gegensatz zu Petrus’ vollem Schopf, nur noch recht spärlich behaart ist; auffällig sind seine enorm abstehenden Ohren, wegen der Petrus ihn schon öfter mal geneckt hatte mit der Bemerkung, er solle doch beim Reiten und auf dem Bock den Kopf möglichst seitlich drehen, weil seine Ohren sonst eine bremsende Wirkung hätten.
Und sein Gesicht ist immer gerötet, so als käme er geradewegs aus der Schänke. Dabei blicken seine Augen klar und aufmerksam in die Umgebung: flink huschen sie hierhin und dorthin, ihm entgeht nichts, er bemerkt alles, was rings um ihn vorgeht. Und dabei ist Gawrilo zugleich ein schneller Denker und so für Petrus in jeder Situation ein sicherer Begleiter und Partner. Blitzschnell erfasst er eine Schwierigkeit, und wo andere noch umständlich überlegen müssen, was zu tun sei, hat er die Lösung des Problems sofort parat. So ist er Respektsperson für viele in seiner Umgebung, und das nicht nur wegen seiner Körpergröße und seiner Kraft – er überragt Petrus um mehr als eine Haupteslänge -, sondern eben wegen seiner exakten, schnellen, zuverlässigen Handlungen und Entscheidungen; ganz ohne Zweifel ist das auch der Grund, weshalb zwischen Gawrilo und Petrus kaum ein Verhältnis wie zwischen Knecht und Herrn zu bemerken ist. Sie sind Vertraute, Freunde, Kameraden, obgleich es Gawrilo ist, der einen kleinen, aber deutlichen Abstand zu Petrus immer bestehen lässt. Das will er einfach so.
Weit hinter Istra, schon mehr auf Dobrovo zu, beginnt das Land etwas hüglig zu werden, weshalb sich die Straße schlängelt, mal nach links, mal nach rechts, an hohen, schwarzen Fichtenwäldern vorbei, an deren Rändern sich wie ein weißer Saum schlanke Birken reihen. Das Wegekreuz nach Golitsino haben sie schon seit zwei Stunden hinter sich und die lange, zwei Tage andauernde Reise von Moskau nähert sich nun wirklich dem Ende. Vielleicht in zwei, oder auch in drei Stunden könnten sie auf dem Gut sein, wenn Gott es so will, wenn kein Gewitterblitz einen Baum über den Weg schlägt und keine Wolfsmeute den Schweiß der Braunen wittert. Doch diese Gefahren scheinen nicht zu drohen, der Himmel ist strahlend blau, von keinem Wölkchen geziert, und die Wölfe lagern wohl matt im fernen Dickicht. Petja hält seine Muskete umfasst und lehnt sich auf der Bank in dem Kasten nach hinten.
Den kleinen gusseisernen Ofen, der im vorderen Teil des Kastens steht, den hätten sie wirklich ausbauen können, denkt Petja, unnötig, den im Sommer durch das Land zu schleppen. Er hat das matte Pergament vor dem Türfenster zur Hälfte abgelöst und schaut mit etwas müden Augen auf das Land, das langsam, sehr langsam an ihm vorüber zieht.
Nach dichten Wäldern geht sein Blick über das hüglige, endlose Land, über in der Ferne mit dem Horizont verschmelzende Wiesen. Sie sind voll ins Kraut geschossen, das Grün, wechselnd im Farbton, geht manchmal in Staub und Sonnenglast in ein warmes Grau über. Am Straßenrand tummeln sich wilde Kräuter und Beerensträucher mit weißen und gelben Blüten, blutrote Mohnblumen und blaue Rispen dazwischen, Ginsterbüsche, die weiß und ockerfarben strahlen.
Die Weite kann, trotz hügliger Bodenwellen, sich immer änderndem Farbenspiel und den dann wieder nahenden majestätischen Baumriesen melancholisch machen. Keine Menschenseele ist hier zu sehen, kein Arm hebt sich zum Gruß, keine drei Worte können gewechselt werden, es sei denn, Petja spräche zu dem Adlerpaar, das im hohen Blau kreist, den scharfen Blick auf huschende Feldmäuse und zappelnde Lemminge gerichtet. Nur dann und wann erblickt Petja in der Ferne einige Hütten, keine richtigen Dörfer, kein Trost spendender Kirchturm, nur Flecken inmitten winziger Felder, auf denen sich mattgelb und leicht grau halbgewachsenes Korn wiegt, neben kleinen Weideflächen mit drei oder vier Kühen und einer Schafherde. Die Holzhäuser haben sich in dem flachen Land tief an den Boden gedrückt, aus Angst vor den Gewitterstürmen, die hier häufig über das flache Land fegen. Fast sieht man nur die Dächer, so stehen sie geduckt da, als wären sie im ewigen Gebet um die Gnade von Mütterchen Erde versunken.
Petja schließt die Augen, er ist müde, kann aber nicht schlafen. Weiß ist sein Haupthaar, nur der Bart hat eine etwas dunklere Färbung. Sein Gesicht ist von tiefen Falten förmlich zerrissen. Fünfundfünfzig war er vor einem Monat, im Juni des Jahres 1760 geworden, nicht mehr jung, aber doch eigentlich noch kein alter Mann, und doch wirkt er viel älter als Gawrilo auf dem Kutschbock, der schon zweiundsechzig Jahre zählt. Was hat der gemacht, dass er noch so jung aussieht; es ist nicht zu begreifen. Abgesehen von seiner angehenden Kahlköpfigkeit wirkt er doch noch frischer, und sein dichter schwarzer Bart ist nur von wenigen grauen Strähnen durchzogen.
Und kräftig ist er noch, dieser Kerl, er kann mit der Schulter immer noch den Wagen hochstemmen, wenn das Rad gewechselt werden muss. Ach, er war ihm, Petja, ja stets wie ein Goliath vorgekommen, schon damals, als er, Petja zehn war, Gawrilo siebzehn, der Tausendsassa. War von der Stadt aufs Gut gekommen, Schreiner hatte er gelernt, bei einem deutschen Meister, der auf Geheiß Zar Peters ins Land gekommen war, tausende andere Handwerker mit ihm. Der alte grüne Kastenwagen ist Gawrilos Werk, der hält nun schon fast vierzig Jahre. Und Eisenstangen konnte er biegen und Pferde beschlagen, Bolzen, Torangeln und Sensenblätter schmieden. Gawrilo konnte einfach alles, vermochte Bäume zu fällen, Fässer und große Wagenräder zu bauen, aber er schnitzte mit zarter Hand auch kleine Pferdchen aus Erlenholz. Und wie er mit den Pferden umging! Es gab niemals ein Pferd auf Dobrovo, das ihm nicht früher oder später zahm zur Hand gegangen wäre. Gawrilo war einfach der Schatz des Gutes. Petjas Vater hatte seine Talente früh erkannt und ihn an sich gebunden, ihn schließlich wie ein Familienmitglied aufgenommen.
Wohlgeboren – so hatte Gawrilo sie immer angeredet, die Mitglieder der Familie Dobrovskij, der Gutsherrschaft auf Dobrovo, und der Vater ließ es angehen.
Aber nach seinem Tode, als er, Petja, das Gut übernommen hatte sagte er zu Gawrilo: „Ich heiße eigentlich Petrus, das weißt du. Bin ich Petrus? Gottbewahre!“, er bekreuzigte sich, „ich bin Petja, und für dich schon allemal, also sag Petja, lass den Unsinn mit dem ‚Hochgeboren’! Wo bin ich denn hoch geboren? Steh ich nicht hier mit den Beinen auf der Erde wie du und die anderen auch?“
Aber Gawrilo war nicht völlig zu überzeugen. Schließlich sagte er: „Hör, Petja hochgeboren, lass mich das mal machen mit dem weißen Hengst.“
„Du sollst mich doch Petja nennen, sag, sind wir nicht Freunde, Brüder?“
„Schon gut, wenn du es so willst. Ach ja, im Namen der Gottesmutter, dein Wille ist dein Himmelreich, Petja hochgeboren...“
Ach, sie waren doch wirklich wie Brüder gewesen, ihr Leben lang, aber Gawruschka hatte doch immer diesen kleinen Abstand gehalten, wer war er denn schon, dass er dem Herrn zu vertraut kommen könnte, Landmann, Knecht, einfacher Wanderer auf Gottes Erde; Herr ist Herr, nein, man kann doch nicht die adlige Herrschaft einfach so beim Vornamen nennen, was der sich dachte, dieser Petja, hochgeboren.
So lebten sie schon lange Zeit zusammen auf Dobrovo, eine sehr lange, sie fest verbindende Zeit, sie aßen zusammen, tranken manches Glas Wodka gemeinsam, wenn Gawruschka wieder ein paar störrische Pferde zugeritten hatte, o je, wie er das verstand, dieser Teufelskerl, ritt wie ein Satan über die Sandwege, dass sich der Staub der Jahrhunderte über Dobrovo legte, bis ihm der Gaul zahm aus der Hand fraß.
Und wenn sie tranken, Marfa, seine Frau schimpfte zwar fürchterlich, ach, ihr Tunichtgute, ihr Saufbolde, werdet noch das Haus anzünden, ihr gottverlassenen, räudigen Hunde! Sie verzog sich aber bald brummend hinter den Ofen.
Wenn sie tranken, dann tranken sie richtig! Denn der Wodka, der schmeckte, ach, wie der schmeckte, den hatte Gawruschka gebrannt, er hatte die allerbesten Kartoffeln von den Feldern gesucht für dieses Lebenselixier, das in der Kehle brannte wie der Atem des Teufels, das war ein richtiger Segen der Mutter Gottes, je, o je...
Waren das hundert Gramm in den Tonbechern oder zweihundert? Marfa war längst mit den Kindern, den drei Jungen Michail, Roman und Jakub in den Betten verschwunden, da saßen sie beide auf der Bank vor dem Kornspeicher, und ein dicker, glutroter Mond hing über ihnen und ließ die Zikaden in allen Büschen in die Saiten greifen, dann becherten sie erst so richtig los, wie die Ertrinkenden, bis Gawruschka anfing zu singen, uralte, traurige Lieder, seine Bassstimme rollte die Wörter zusammen mit dem Wodkadunst in der Kehle, so dass man sie kaum verstehen konnte, aber sie waren so traurig, o je, so herrlich traurig waren sie wie die schwermütige Melodie, die weit über das Feld zum schwarzen Wald hin flog, bis ein ebenso trauriger Hall zurück kam und machte, dass Gawruschka die Tränen in den vollen, schwarzen Bart kullerten, dann sagte er:
„Jetzt haben wir die Seligkeit erreicht, jetzt sind wir wirklich Gotteskinder, ist das nicht schööön, so wunderschööön, Petja, ach Petja, gehen wir, äh, schlafen, o je, schlafen, hochgeboren...“
*****
Petja döst in dem über die holprige Sandstraße rumpelnden Wagen. Ach, waren das Zeiten gewesen, als sie noch so jung waren, so verwegen, so tatendurstig. Gewiss, der Vater hatte harte Arbeit auch von ihm verlangt, von wegen Allüren als Gutsherrensöhnchen, wegen der zweihundert Seelen, die ihnen gehörten, das hatte der Alte ihm frühzeitig ausgetrieben. Da hieß es, mitzuschuften von früh an, oft bis in den späten Abend hinein; Ställe auskehren, zur Ernte auf die Felder fahren, Kühe treiben, die Pferde striegeln, aber doch hatte er auch seine Spielräume. Nicht selten ritt er mit Gawrilo wie der Teufel über die Felder, von einer ungeheuren Staubwolke eingehüllt, da gab es kein Halten, kaum ein Hindernis.
Einmal waren sie auf dem Rückweg nach Dobrovo, an einem Junitage, gegen Abend, die Sonne hatte sich schon dem Waldsaum genähert und mit ihrem Gold die ganze Landschaft rings übergossen, da kam ihnen eine Reiterschar entgegen, eine Eskorte offenbar, denn ihr folgte eine mit sechs Rappen bespannte, große und prächtige Kutsche. Sie wichen zum Feldrand aus und blieben stehen, und kurz bevor die Kutsche sie erreicht hatte, hörten sie einen scharfen Befehl und der ganze Tross kam sofort zum Stillstand. Aus dem Kutschenfenster beugte sich ein Herr in feiner Kleidung. Er trug das Haar ungewöhnlich kurz geschoren und dazu einen kecken Schnurrbart. Petja erkannte ihn sofort: heilige Mutter Gottes, der Zar, Väterchen Zar, Peter, der Große, wie er allenthalben genannt wurde! Er raunte Gawrilo die Neuigkeit zu, schnell sprangen sie von ihren Pferden, verneigten sich tief, fast bis zum staubigen Boden, vor Seiner Heiligen Majestät.
Peter winkte kurz, herrisch, mit der linken Hand und sprach sie an:
„He, ihr jungen Dachse, wer seid Ihr, was treibt Euch so spät noch in diese elende Wildnis?“
„Halten zu Gnaden, Euer Majestät“, sprach Petja,
„Petrus Dobrovskij, Gutsbesitzerssohn, und das ist mein guter Freund Gawrilo. Wir sind noch ein wenig ausgeritten, um die Pferde immer gut in Form zu halten, sollen doch keine Schlafmützen werden, halten zu Gnaden, Euer Majestät...“
„Petrus? Guter Name, gilt er mir oder dem Heiligen? Sagt nichts, er gilt uns beiden nicht wahr? Parbleu! Das kann nicht Euch gelten! Wenn hier einer heilig ist, dann bin ich das, versteht Ihr?“
„Wie Ihr befehlt, Euer heiliger Petrus Majestät!“
Worauf der Zar in ein dröhnendes Lachen ausbrach und in die Hände klatschte, „das ist gut, das ist prächtig, nicht wahr, Seldowsky, ha, ha, heiliger Petrus Majestät...“
Der Kaiser krümmte sich vor Lachen.
„Ach Söhnchen, Petrus Dobrovskij, war´s nicht der Name, Dobrovskij? Vom Gut Dobrovo? Wartet, kenne doch Euren Vater, war früher Offizier und in Petersburg stationiert. Warum seid Ihr, junger Mann, nicht beim Militär? Nein, antwortet nicht, Ihr Söhnchen, muss auch prächtige Gutsleute geben, florierende Landwirtschaft; was hätten wir sonst in unseren silbernen Schüsseln, gäb’s unsere tüchtigen Landleute nicht, ist es nicht so, Seldowskij“, wandte er sich lachend an den neben ihm sitzenden Herrn, der im Gegensatz zu ihm eine gewaltige, lockige und ziemlich albern wirkende Allongeperücke trug.
„Par exzellence, Euer Majestät, klug gedacht, sehr klug, eminent klug, wie immer, Herr...“
„Ach, hört auf, klug, klug, klug, Ihr redet wie ein Uhu, Seldowskij, das ist nicht klug, das ist selbstverständlich; die Landleute mit ihrer Arbeit, darauf steht unser Reich, Landarbeit und emsige Handwerksarbeit machen uns reich, reich und stark, versteht Ihr?“
Der Zar lachte nun den Jungen zu, tausend lustige Fältchen durchzogen plötzlich sein Gesicht, und die Spitzen des schwarzen Schnurrbartes, angetrieben von dem Gelächter, zitterten und schwangen wie Grasspitzen im Wind.
„Sorgt, dass das Land gut bebaut wird, dass prächtige Ernte wird, pflegt mir die Tiere, macht dass auch viele kleine kommen...“, er schmunzelte jetzt schelmisch, „und die Pferde, haltet Eure Pferde gut, kann sein, ich bräuchte Euch mal für Dienste zu Pferde. Reiten könnt ihr ja wie die Teufel. Nun, grüßt Euren Vater, Petja, Söhnchen – fahr zu, Kutscher!“
Der Tross setzte sich augenblicklich in Bewegung und war nach kurzer Zeit in einer Wegbiege verschwunden.
„Ein Traum“, flüsterte Gawrilo, „war das ein Traum?“
„He, Gawruschka, wach auf! Der Zar hat uns gerade begrüßt, kein Gespenst, unser Väterchen Zar. Mutter Gottes, wenn wir das den Unseren berichten, los Gawri, auf nach Dobrovo!“
An Dobrovo hatte sich der Zar erinnert. Dabei war es noch nicht lange her, da war das Gut nur das kleine Vorwerk Dobrinka gewesen, bis es schließlich, über lange Zeit, anwuchs, sich ausbreitete und ausweitete. Irgendwann war das große Herrenhaus entstanden, einem kleinen, weißen Schlösschen nicht unähnlich, mit einigen Säulen, die eine Attika tragen und einer Freitreppe, das einzige Bauwerk weit und breit, das ganz aus Stein erbaut ist. Ringsum hatten sich Handwerker angesiedelt, entstanden die Ställe, die vielen Hütten der Landarbeiter, eine eigene Kirche hatte Dobrovo dann auch bald. Hier vermehrte sich das Leben, Schmiede, Mühle, Töpferei entstanden, immer mehr Menschen zog es nach Dobrovo und in die nächste Umgebung, denn es lag zudem nahe dem See, hier konnte man auch Fische fangen und sich erfrischen, wenn es heiß war.
Petrus denkt an den Zaren Peter, den man den Großen nennt.
Wenn er ihnen nun wieder entgegen kommen würde, jetzt, in diesem Augenblick, was würde er fragen?
Was hast du gemacht, Söhnchen, würde er vielleicht fragen, sieh, ich bin alt und grau geworden, du bist auch nicht mehr gerade jung. Plagen dich die Zipperlein genau so wie mich? Ach Söhnchen, die vielen Fremden im Land, Holländer, Deutsche, Schweden, habe ich es recht getan, sie zu uns zu holen? So viele neumodische Sitten und Gebräuche, manchmal glaub ich, Russland ist nicht mehr mein Russland. Oder bin ich schon ein rechter Griesgram geworden, der nichts mehr versteht, was sagst du, Söhnchen, wie war gleich dein Name?
„Petrus, Majestät, Petrus“, murmelt Petja vor sich hin. Ach, der Große Peter, das war ein Kerl gewesen! Lange ist es schon her, dass er zu Gott ging, es muss im Jahre 1725 gewesen sein. Er, Petrus, hatte sich nicht geschämt, zu weinen, als die Kunde von seinem Tode in Peterdworez durch das ganze Land flog. Alle waren traurig gewesen, und Stepuschka, der zahnlose, krumme Kirchendiener hatte stundenlang die Glocken geläutet.
Nach ihm gab es drei oder vier Herrscher, erst Peters Gemahlin Katharina, später Peters Nichte, dann Iwan, alle hatten sie verhältnismäßig kurz das Land regiert, Hü und Hott war es gegangen, mal hier lang, mal da lang, heilige Mutter Gottes, kaum kannte sich noch einer aus, mal murrten die Offiziere, mal murrten die Leibeigenen, dann murrte das ganze Volk, denn Abgaben und Steuerlasten waren immer mehr angewachsen, auch Dobrovo bekam das zu spüren; der Reichtum minderte sich, Hagelstürme und Dürrezeiten taten das ihre dazu. Und nun war, seit 1741, Elisabeth die Erste Zarin von ganz Russland. Eine strenge Dame, wie man hörte, die sich in Ränkeschmieden behaupten musste, aber nicht ohne Wohlwollen fürs Volk, was so geredet wurde. Auf Peter, ihren Neffen, den Thronfolger, gibt man wohl nicht so viel, allzu verschroben, verspielt, kindlich und dabei böse und rachsüchtig ist er. Seine junge Frau Katharina, die Deutsche, sie hingegen scheint beliebt im Volke, und das Wohlwollen der Zarin genießt sie augenscheinlich auch.
Petja sinniert in seinem Kasten.
Jetzt führt der Weg durch ein großes Waldstück, da ist die abendliche Sonne verschwunden hinter den riesigen, schwarzen Fichten, deren Spitzen sich sacht in einem leichten Wind von Süden wiegen. Er hört Gawrilos Fluchen, sicher ist ihm wieder die Schappka auf die Nase gerutscht und er glaubt, die Pferde antreiben zu müssen, die doch in ihrem immer gleichförmigen Trott gehen, nicht rechts, nicht links sehen, nur manchmal schnauben sie leise vor sich hin, eine ganz vorsichtige Äußerung derart, dass sie nun doch bald zu ihrem Ruheplätzchen im Stall kommen und zu ihrem Ballen frisches Heu. Dobrovo kann doch soweit nicht mehr sein.
Seltsam, denkt Petja, schon vier Jahre währt nun der Krieg mit Preußen, das Land des Großen Friedrich soll am Abgrund stehen, aber er wehrt sich, der Friedrich, mit Klauen und Zähnen, es geht nicht vorwärts und nicht rückwärts, und sie sind Feinde, die Deutschen und die Russen, aber Peter liebt den Preußenkönig dennoch, verehrt ihn wie einen Heiligen.
Elisabeth ist unschlüssig, Katharina, nun ja, sie ist Deutsche, in Stettin geboren, 1729, da war er, Petrus schon vierundzwanzig gewesen. Schön soll sie sein, die Gemahlin des Thronfolgers, die Russen lieben sie, und sie, steht sie zu den Preußen? Was soll das werden, wie wird das ausgehen?
*****
Ihm deucht, nun gingen die Pferde schneller, wahrhaftig, ihre Gangart hat sich geändert. Der Wagen rumpelt und poltert über den Weg, Gott im Himmel, nicht dass noch ein Rad bricht, kurz vor dem Heim! Er lehnt sich aus dem Fenster, es ist der Augenblick, da sie das Waldstück verlassen, die Straße macht nun eine ziemliche Biegung nach Westen, und es geht sachte abwärts, den leichten Hügel hinab, den Gawrilo und er so oft lachend und schreiend in einem furiosen Ritt erklommen hatten.
Nun sieht er auch die Sonne wieder, die in dunklem Rotgold über dem Land steht, die Hügel, die Wäldchen, die Felder sind in leuchtendes Abendlicht getaucht, da hinten, nach der letzten Wegkrümmung sieht Petja schon die Kirchturmspitze von Dobrovo hervorlugen, gleich darauf erkennt er das Haus des Schmieds am Dorfrand, die Hütten der Landarbeiter und weiter, neben dem Kastanienwäldchen, wo der Fluss sich schlängelt bis zu dem kleinen See hin, tauchen nun aus dem Dunst auch das Gutshaus auf und die Pferdeställe, und alles sieht friedlich aus, und die Söhne werden da sein, und Marfa wird krumm aus ihrer Stube kommen und Jegoschka, die Dogge wird mit dem Schwanz wedeln, und einen kräftigen Wodka wird er sich gleich aufs Gemüt gießen. Gawruschka bekommt auch einen.
Petrus fühlt in sich die große Freude des Heimkommens. Gewiss, die Geschäfte, der Schacher auf dem Markt in Moskau, das war willkommene Abwechslung gewesen, der Kremlpalast, die Wassilikathedrale, das bunte Treiben der Reiter und Kutschen, der Soldaten und Handwerksleute, die fast an jeder Ecke standen, dazwischen langbärtige, grau gekleidete Bauern mit ihren Karren, Säcken und Körben, zuweilen auch irgendein zerzauster, lallender, singender Iwan, der dem Wodka schon am Vormittag kräftig zugesprochen hatte, na, auch grell geschminkte Dirnen kokettierten dazwischen, eine, so eine rosige, dralle, mit Brüsten wie Hafersäcke, meine Güte, solche Brüste..., sie versuchte gar, sich an ihn heran zu machen, ach du meine Güte, ich alter Gaul und so ein flattriges Weibsbild, da soll der Herrgott vor sein...
Aber nichts desto trotz ruhte sein Blick doch für einen Moment auf ihrer fülligen Gestalt und besonders auf dem Dekolleté, welches groß, aber so straff war, dass es den ungeheuren Busen der Dame weit heraus drückte und kaum verbarg.
Ja, in Dobrovo ist es oftmals etwas eintönig, nun, da der älteste Sohn Roman das Gut und die Geschäfte führt. Acht Jahre ist er schon mit seiner Valentina verheiratet, ein liebes Mädel, ja doch, aber was schenkt sie ihm keine Enkel zum Spielen, he? Heiliger Stepan, was soll das für eine Familie werden?
Es ist traurig, öde ist es manchmal, reiten kann er nicht mehr, im Winter sitzt er dicht beim Ofen, im Sommer auf der Bank vor dem Pferdestall, manchmal dringen aus Marfas Stube Klänge des Spinetts, auf dem sie irgendwelche alten Weisen spielt. Und manchmal trinkt er mit Gawruschka einen Wodka oder auch zwei, heimlich, denn Marfa ist mit den Jahren immer giftiger geworden, nennt ihn Alter, soll sich mal selbst ansehen.
He, Alter, bring doch das Butterfässchen zu Olga Jegorowna, wirst es wohl tragen können, das kleine Ding, mach dich mal nützlich; immer nur Karten spielen und Wodka saufen, verfluchter Tunichtgut, der Himmel erbarme dich deiner, nun komm schon her, mein Liebster...
Und doch, jetzt, kurz vor der Ankunft schlägt sein Herz schneller.
Ach, Marfuschka, ich komme ja, he Roman, wird das Heu gut getrocknet? Und Jossip, mein alter Freund, wartest auch schon auf mich in deinem Koben, scharrst mit den Hufen und schnaubst ungeduldig? Da, die Sonnenblumen sind alle aufgegangen, strahlen mich an wie die liebe Sonne am Himmel, ist das nicht schön? Und der Garten hinterm Hause, die Tomaten schon reif, rot wie die Mohnblumen? Werde gleich alles inspizieren, Marfuschka, mein Schatz.
Sie fahren in Dobrovo ein, vorbei an der Reihe schlanker Birken, weiß und leuchtend grün, sie sind so zierlich und biegsam. Wenn Sturm ist, beugen sie sich immer mit dem Winde und richten sich wieder auf und beugen sich wieder, so wie die Weiber sich in der Kirche vor dem Altar verbeugen, bis zum Boden fast und dann wieder ihre kopftuchverhüllten Häupter erheben.
Oh je, ist das doch schön, wieder zuhause zu sein, Dobrovo, du langweiliges, reiches, geliebtes, verflucht schönes Nest!
Wie der Wagen vor der Treppe hält und Petja den ersten Schritt hinaus tut, sich langsam aufrichtend, da stürzt ihm schon Marfa, seine etwas krumme Marfuschka entgegen:
„Gott im Himmel sei gedankt, Petruschka, mein Augenlicht, dass du lebendig und wohlbehalten wieder da bist! Was lässt du mich altes Weib hier eine Ewigkeit allein, du alter Satan, du? Bist wohl jungen Weibern nachgejagt in der Teufelsstadt Moskau, ja? Gott verdamm mich!“
Sie fällt ihm in die Arme und Tränen rinnen über ihr faltiges Gesicht. Petrus hält sie sachte umfasst und lässt den Blick über den Platz vor dem Hause schweifen, zu den hohen Kastanien, zum Gärtchen da drüben, zu den Pferdeställen und dann, über die Kirchturmspitze zum Himmel, als suche er seinen Schöpfer zu sehen, um ihm für die glückliche Heimkehr zu danken. Doch da sind dunkle Wolken über dem Wald aufgezogen und der Wind hat sich scharf in Gang gesetzt.
„Komm ins Haus Marfuschka, es wird Gewitter geben, ein schweres vielleicht, na komm schon, mach uns süßen Tee...“
Wie sie dann in der Wohnstube gemütlich beim Tee sitzen, da erzählt Petrus, eher beiläufig: „Also weißt du, wie ich mit Gawruschka da in Moskau auf dem Bauernmarkt sitze, um uns herum ein Geschrei und Geflatter, ein bunter Wirbel, und es riecht nach Fisch und Salzgurken und nach frisch gekochtem Borschtsch, da kommt doch die Zarin Elisabeth höchstpersönlich, ohne dass ich sie erkenne, an meinen Wagen und fragt, wie viel meine dicken Landgurken kosten sollen, das Kilo, so dreißig Kilo bräuchte sie wohl. Ich sage, Mütterchen, dreißig Kilo Landgurken, die kannst du doch gar nicht wegschleppen, da stößt mich Gawrilo an und flüstert: das ist doch die Zarin, verbeuge dich...
Petrus schlürft ein wenig Tee aus der Tasse und schaut kurz und verschmitzt zu Marfa, die aber nimmt ihm das Wort aus dem Mund:
„Ach, hör’ bloß auf, du oberster Possenreißer aller Reußen, mich bringst du nicht mehr um die Contenance, das kannst du Annina, der Kuh erzählen, die glaubt dir vielleicht. Übrigens sind bei der Annina die weißen Flecken jetzt ganz blau geworden, ich weiß auch nicht...“ Und schelmisch blickt sie auf ihren verdutzten Petja.
Inzwischen haben sich die drohenden Gewitterwolken fast verzogen. Nach Süden hin bricht hinterm Wolkenberg ein Stück von der Sonne hervor. Die gleißenden Strahlenbündel treffen auf die Wiesen und bringen sie zu hellgrünem Leuchten, und auch das Birkenwäldchen wird in helles Licht getränkt. Die ganze, von unterschiedlichen Farbtönen wie ein erdgoldener, grünlich-ockerfarbener Teppich gewirkte, endlose Landschaft breitet sich hin unter den Augen von Petrus Dobrovskij, dessen Herz eng und weit zugleich ist, wie das russische Land.
Über ihm kreist ein Sperber.
2. Geteilte Wege
Dieser Februar des Jahres 1765 ist bitter kalt. Die Leute haben sich mit Umhängen und Tüchern, mehrere Lagen dick, umhüllt und das halbe Gesicht verdeckt, und doch zwackt sie der unerbittliche Frost, der alles ringsum erstarren lässt. Das Land ist seit langem mit einer meterhohen Schneeschicht bedeckt, und der Himmel ist meist von dunklem Blaugrau, aus dem immer neu Schnee in dicken Flocken wirbelt. Die Wege im Dorf sind nur an den Spuren der Schlitten und der Schneeschuhe aus Stroh, welche die Menschen um die Füße gebunden haben, zu erkennen.
Auf dem Kirchhof sieht man einige dunkle Gestalten, die mehrere Feuer unterhalten. Man hat sie anlegen müssen, weil der Boden an die drei Ellen tief gefroren ist. Man muss ein Grab ausheben. Für Petrus Dobrovskij.
Der alte, krumme Stepka läutet schon seit über einer Stunde die Glocken der Kirche von Dobrovo. Er, Stepka, hat Petrus, den Herrn überlebt, und ist doch selber nun schon fünfundsiebzig, oder noch älter? Niemand in Dobrovo weiß das so ganz genau.
Da tragen sie den Sarg mit Petrus, der in der Nacht vor sieben Tagen ebenso plötzlich wie still und ohne Aufsehen gestorben war. Eigentlich war er gar nicht krank gewesen, hatte sich eines Tags nur hingelegt, nichts mehr zu sich nehmen wollen außer ein paar Schluck von dem Tee, den Marfa ihm dann und wann reichte. Schließlich war er, in der Nacht, schon gegen Morgen, eingeschlafen. Wie man sah, ganz ruhig, und ein winziges Lächeln spielte um die erblassten Lippen.
Die Schar, die ihn heut zur Ruhe begleitet, ist unübersehbar groß. Vorn gehen die, welche ihm am nächsten waren, Marfa, nun noch kleiner, noch krummer, noch faltiger, tief eingehüllt in das dicke schwarze Tuch, das ihr blasses Gesicht hervortreten lässt. Sie stützt sich auf die Arme der beiden Söhne, Roman, den ältesten, und Jakub, den zweiten, der, das traurige Geschehen nicht vorahnend, vor fast drei Wochen von Ostpreußen her nach Dobrovo gekommen war.
Nach einem Reitunfall im Jahre 1761, er war bei der Kavallerie in Podolsk gewesen, hatte Jakub das Militär verlassen müssen. Die geträumte militärische Karriere, die mit der Kadettenschule in Petersburg so viel versprechend begonnen hatte, war 1765 jäh beendet worden.
Nach seiner Heilung blieb ein Gehfehler zurück. Nun war zu überlegen, wie es weiter gehen sollte mit ihm. Was sollte er hier in Dobrovo, wo Roman das Heft in der Hand hatte? Sollte er ein etwas besserer Knecht sein? Durchfüttern, wie die Eltern, das gab Dobrovo nicht her, denn es war so groß nicht und gab wirtschaftlich nicht so sehr viel her. Sollte er in Podolsk oder in Moskau nach einem Dienst suchen?
Wie Michail, der jüngste der drei Söhne, hatte auch er in Petersburg die deutsche Sprache erlernt. Denn dort hatte er viele Preußen kennen gelernt, Männer des Handwerks und der Wissenschaft, die einst Zar Peter in das Land geholt hatte. Er fand die Deutschen so übel nicht, es waren kluge und vor allem zielstrebige Leute, ach, sie wälzten sich nicht bis zur Mittagszeit auf dem Ofen wie so mancher der faulen, einheimischen Müßiggänger; am frühen Morgen waren sie schon auf und gingen ihrem Werk nach, wie man sah, mit Erfolg. Denn nicht wenige waren zu offensichtlichem Wohlstand, ja Reichtum gelangt, der eben nur durch gute Ideen und eifriges Werken zu erringen war.
Für kurze Zeit war Jakub einmal an die Grenze zum Ostpreußischen beordert, er hatte die Stadt Preußisch Eylau besichtigt, ihm gefielen die schmucken Häuser aus Stein, die soliden Speicher und Kontore, das Treiben in der Stadt, die übersichtlichen Märkte, und die Menschen, die irgendwie alle einen frischen, blühenden Eindruck auf ihn machten. Ja, sie waren sehr freundlich zu ihm gewesen, dem russischen Offizier, der sich so begierig nach mancherlei erkundigte; er hatte auch mit Einheimischen in einer Schenke gesessen und deutsches Bier getrunken.
Jakub fasste nach seinem Unfall den Entschluss, nach Preußen zu gehen und dort sein Glück zu versuchen. So kam er schließlich nach Osterode, einem verträumten Städtchen, das einstmals von Deutschen aus dem Harzgebirge gegründet und nach ihrem Heimatort benannt worden war.
Freilich, es war dann doch nicht so leicht gewesen, Fuß zu fassen. Er hatte sich zunächst als Bote verdingen müssen, dann war er Gehilfe bei einem Gärtnermeister. Doch dann hatte das Schicksal ihn mit der Kaufmannstochter Johanna Moninke zusammen gebracht, bald hatten sie in der Stadtkirche von Osterode geheiratet. Das war wahrhaftig ein Glücksfall gewesen, denn die junge Johanna war nicht nur sehr ansehnlich; der Kaufmannsstand des durchaus erfolgreichen und angesehenen Vaters ließ bescheidenen Wohlstand auch für sie erwarten. Bald hatte man ein Häuschen am Stadtrande errichtet, und hier erblickte schon ein Jahr darauf ein Söhnchen das Licht der Welt. Auf Wunsch des Schwiegervaters wurde es auf den Namen Gottfried getauft. Es war das erste Enkelkind von Petja, doch er hatte es nicht mehr sehen können.
Jakub hatte sich schließlich gut in Osterode eingefügt, arbeitete für den Schwiegervater im Getreidegeschäft und stellte sich dabei sehr geschickt und nützlich an. Freilich, seine Herkunft spielte nun keine Rolle mehr, den Adelsstand hatten König Friedrichs Behörden nicht anerkannt, und so lebte er seither sein Leben als gutbürgerlicher, preußischer Untertan, und er war's zufrieden. Nur die Schreibweise seines Familiennamens, in lateinischen Buchstaben mit einem y am Ende, erinnerte noch an seine Vorderen und an das Dörfchen Dobrovo im fernen Russland. Zuweilen erinnerte ihn auch ein unbestimmter Schmerz in der Brust, eine verborgene Sehnsucht an eine glückliche Kindheit mit den Eltern und den Brüdern, an die schlanken Birken und die Fichtenwälder, an die Schar der Pferde in den Ställen, an die fröhlichen und traurigen Gesänge sonntags und an Feiertagen.
Petrus’ und Marfas jüngster Sohn Michail aber hatte wahrscheinlich die Nachricht vom Ableben des Vaters noch nicht einmal bekommen. Allzu weit war der Weg, Michail lebte im fernen Berlin, der Hauptstadt des Preußenreiches, wohin ihn schon im Jahre 1764 die Zarin Katharina II., unmittelbar nach ihrer Thronbesteigung, als Kaiserlich-Russischen Gesandten beordert hatte. Petrus war insgeheim von besonderem Stolz auf seinen Jüngsten erfüllt gewesen, der eine solche Traumkarriere hatte.
Immerhin, Michail war wohl der gewandteste, der klügste der drei Brüder, der mit den vielfältigsten Interessen und der größten Weltsicht. Kadettenschule, ein Jahr nach Jakub, das war mehr ein Muss, doch eine militärische Laufbahn hatte er eigentlich nicht im Sinn.
Bei Hofe verkehrte der in russischen Diensten stehende preußische Obrist Albrecht von Dressen, der mit dem General Iwan Antonowitsch Griwuschin gut befreundet war. Mit dem Sohn Albrechts von Dressen, dem hoch gewachsenen, blonden Johann war wiederum Michail auf der Kadettenschule auf das engste befreundet. Sie hatten so manches Abenteuer miteinander ausgestanden, auch wenn es um das schöne Geschlecht ging; Michail wurde schließlich regelmäßig in das Haus von Dressen eingeladen, und insbesondere die Gattin des Obristen hatte an dem schlanken, dunkelhaarigen, geistvoll-witzigen Michail regelrecht einen Narren gefressen.
Friederike von Dressen war im übrigen, trotz ihres fortgeschrittenen Alters von immerhin neununddreißig Jahren eine außerordentlich jugendlich wirkende, wunderschöne Frau mit schelmischem Witz; sie strahlte bei jeder Gelegenheit, selbst wenn sie nur eine Tasse Tee einschenkte oder die Blumen in der Vase richtete, eine unheimlich seltsame, knisternde Erotik aus, wobei von jeder Handbewegung, von jeder Neigung ihres hübschen Kopfes und besonders von den nicht selten ertönenden, fast nur gehauchten Erstaunensrufen etwas ausging, was man leicht als eine Aufforderung zu stärkerer Annäherung, vielleicht gar intimer Art, auffassen konnte.
Verwunderlich war es also überhaupt nicht, dass sich Michail, temperamentvoll und im jugendlichen Überschwang, Friederike von Dressen sehr bewundernd, sehr schwärmerisch näherte. Mit Inbrunst neigte er den Kopf und schenkte ihr den Handkuss, der natürlich auf weißseidene Handschuhe gehaucht wurde, wobei sein Blick unbemerkt auf die helle Haut ihres bloßen Armes gerichtet war und sich die Fantasie weiterbewegte: den Arm hinauf, am schlanken Hals entlang, direkt zwischen ihre zarten und doch vollen Brüste, und tiefer, in jene geheimnisvolle, dunkle Region, in die einzudringen immer das erste Trachten sehr junger, sehr verliebter Männer ist. Auch fühlte er in diesem Moment eine sich plötzlich anbahnende Bereitschaft dazu, welche er errötend zu verbergen suchte, indem er sich hastig abwandte und setzte. Ihrem schelmisch-blitzenden Blick blieb indessen sein Missgeschick keineswegs verborgen. Sie lächelte vergnügt.
Friederike spürte sehr wohl und sehr direkt seine Zuneigung und sein kaum verhohlenes Werben, es machte sie froh und besonders lebendig, zumal der Obrist, ihr Gatte, in der Regel überwiegend militärisch dachte und fühlte; ein Charmeur und gefühlvoller Liebhaber war der noch nie gewesen, vielmehr war bei ihm alles Planung, Attacke und Sieg.
Dennoch hatte sie ein sicheres Talent, ihren jugendlichen Verehrer wie an einer unsichtbaren, winzigen Kandare zwar nur zentimeterweit, aber mit absoluter Sicherheit auf Abstand zu halten. Es blieb tiefes freundschaftliches Empfinden beiderseits, welches Friederike veranlasste, Michails Fähigkeiten, seine Begabungen und seine elegante Lebensart bei ihrem Gatten immer wieder anzupreisen mit dem Erfolg, dass dieser Michail mehr und mehr Interesse und schließlich auch so etwas wie ein Freundschaftsgefühl entgegen brachte, und so war es folgerichtig, dass er bei Hofe vorgestellt und in die höheren Kreise eingeführt wurde, wo man seine Gewandtheit, sein unterhaltsames Wesen ebenso schätzte wie seine deutschen und französischen Sprachkenntnisse und sein erstaunliches Wissen über die Welt und über die Politik.
Schließlich hatte Kanzler Graf Bestutschij der Kaiserin über den viel versprechenden jungen Mann berichtet. Eine persönliche Audienz bei Ihrer Majestät, die Michail in ungeheure Aufregung versetzte, die er allerdings vor der Kaiserin mit bester Contenance gut verbergen konnte, begründete seinen weiteren Weg. Und – man hatte gerade, nach sieben Jahren Krieg, Frieden mit dem Großen Friedrich geschlossen. Dieser Frieden von Hubertusburg, mit dem Friedrich auch der endgültige Besitz von Schlesien bestätigt wurde, das er anfangs seiner Herrschaft erobert hatte, machte Preußen nun zur europäischen Großmacht, gleichgestellt mit Maria Theresias in Österreich und dem unendlichen Reich der Kaiserin Katharina. Nun galt es für Michail, auf lange Zeit direkte Botschaften zwischen Friedrich und Katharina zu vermitteln, vor allem aber mitzuwirken an einer Vielzahl von Verträgen und Übereinkünften, die zwischen beiden Mächten auszuhandeln waren. So siedelte er sich in Berlin an und richtete sich auf eine lange Zeit ein.
Und Michail kann nun den Vater nicht auf seinem letzten Weg begleiten.
Unter schwerem, blaugrauem russischen Himmel folgen den Anverwandten Scharen von Menschen, aus allen Weilern sind sie trotz des Schnees hergezogen, und aus der Ferne sieht es aus wie ein langes, schwarzes Band, ein Gewirr von Kopftüchern, Mützen, dunklen Röcken, das sich langsam, unter dem unaufhörlichen Läuten des krummen Stepka durch den dicken, weißen Schnee bewegt.
Gleich hinter Jakub geht Gawruschka, nun schon an die siebzig, schleppend und sehr gebeugt geht er, denn nach den Angehörigen hat ihn der Tod seines Freundes besonders getroffen, möglicherweise überhaupt in einer besonders einmaligen Weise.
Ach Petja, hochgeboren, Petjuschka, Freund, Brüderchen, was soll ich nur machen ohne dich, wem soll ich mein Herz ausschütten, wenn es traurig ist, mit wem mich über den kommenden Frühling freuen, über die Fohlen, die geboren werden?
Nach der Beerdigung sitzen sie traurig und still im Gutshaus um den großen eichenen Tisch herum. Gawrilo hat den mächtigen gekachelten Ofen tüchtig eingefeuert, hat Tee gereicht, und Marfa stellt mit zitternden Händen eine riesige Schüssel mit salzigen Brezeln auf den Tisch:
„Nun esst nur, Kinder, esst, seht ihr?, das Salz auf den Brezeln, seine Körnchen glänzen wie die Tränen, die wir geweint haben um unseren Petja, esst nur und trinkt euren Tee, er ist so süß und so heiß, wie Petruschka ihn besonders liebte. Sag, Roman, wird er nicht furchtbar frieren da unten, mein Liebster?“
„Ach Maminka, du weißt es doch, er ist jetzt in Gottes Hand, Gott und die Mutter Gottes beschützen ihn, sie speisen ihn und machen, dass er niemals friert; er wird lächelnd aus dem Himmel zu uns herab sehen, du hast doch sein kleines Lächeln gesehen in seiner letzten Stunde. Ja, seien wir getröstet, unser Vater ist für immer im Himmel, das ist sein Lohn, denn er hat rechtschaffen gelebt alle Tage, uns alle geliebt, auch die Menschen um uns herum in Hütten und Weilern, er wird herabschauen auf uns, ob wir alles gut machen, ob auch wir rechtschaffen sind für alle Zeit.“
Alle in der Stube erheben sich und bekreuzigen sich dreimal. Marfa ist nun etwas ruhiger und blickt dankbar auf ihren Sohn. Nur Gawrilo unterdrückt ein trockenes Schluchzen, er geht wortlos und schlürfend hinaus.
Die vielen Menschen, die zum Kirchhof gekommen waren, sind wieder in ihre Behausungen gegangen, manche eineinhalb Werst bis zu ihrem Weiler. Sie hatten die Beschwerlichkeit auf sich genommen, denn Petja war immer ein guter, ein freundlicher Herr gewesen, der sich vieler Sorgen anderer angenommen hatte, der half und tröstete, wo er nur konnte.
Stepka hat nun mit dem Läuten aufgehört. Dick, weiß, sauber liegt der Schnee über Dobrovo und die angrenzenden Felder und Wiesen. Von den schlanken Birken erhebt sich krächzend eine Schar Raben. Wie Todesengel, denkt Gawrilo, kleine schwarze Todesengel, oh, wie hässlich und widerwärtig sie krächzen, diese Höllenvögel.
Im Stall schnaubt Jossip, der alte Wallach Petjas. Er taugt zu nichts mehr, nicht zum Reiten, zum Ziehen des Wagens, zum Pflügen nicht. Er hat sein Gnadenbrot bis zu seinem Ende. Jeden Tag war Petja bei ihm gewesen.
Gawrilo geht zu ihm hinein, umfasst das weiche Pferdemaul und schaut Jossip an. Bist auch traurig, was, Jossip, ach wie fehlt uns unser Petja, wie er uns fehlt, mein Freund. Und so bleibt er lange Zeit bei Jossip, krault und streichelt ihn, spricht mit ihm, erzählt ihm gar Geschichten aus früheren Zeiten., weißt du noch, Jossitschka, wie wir wie die Verrückten um die Wette ritten, nur um der hübschen, zarten Marfa zu gefallen? Ach, Petja, niemals hat er es erfahren wie sehr auch ich in Marfa verliebt war, wie ich ihretwegen die Muskeln spielen ließ und die tollsten Sprünge über Büsche und Zäune wagte.
Nein, das hat er nie erfahren, und es brach mir fast das Herz, als er sie zur Frau nahm, aber sag selbst, Jossitschka, war er nicht der Herr? Gebührte ihm nicht das Vorrecht der Wahl? Wer war ich denn, einfacher Erdenwanderer doch nur, Lumpenhund ohne Hab und Gut. Aber unser Petja, hochgeboren, er hat mir trotzdem ein schönes Leben geschenkt an seiner Seite.
Wochen später ist der ganze Schnee geschmolzen. Doch Marfa bleibt zumeist in ihrer Stube, manchmal, sehr selten, spielt sie auf dem Spinett langsame, traurige Weisen. Gawruschka, der wie eh und je, seines Alters ungeachtet, den Geschäften als Faktotum der Familie nachgeht, hält einen Moment inne, wenn er an Marfas Fenster vorbei kommt.
Roman und Valentina bereiten die Frühjahrsbestellung vor, auch Einkäufe und Reparaturen, was sollen sie machen, Kinder sind nicht im Hause, sie haben nur das Gut, das Land.
In den Hütten und Häuslereien, ja da wird es lebendiger, Kindergekreisch flirrt durch die Luft, Betriebsamkeit allenthalben, aus der Schmiede dringen erzene Klänge ins Freie, denn die meisten Pferde müssen neu beschlagen werden.
Im Frühjahrswind beugen sich die Birken am Rande des Dorfes, beugen sich hernieder wie die Weiber in der Kirche, richten sich wieder auf.
Es liegt etwas Unbestimmbares in der Luft, man kann es nicht beschreiben, ein Wehen, ein Düftchen, das geht durch die Nasen in die Herzen. Das Flüsschen rauscht quirliger durch das Dorf, an seinem Ufer sieht man Krokusse sprießen, die Knospen an Bäumen und Büschen sind schon ganz dick, nicht lange mehr, und sie werden platzen und winzige, zartgrüne Blättchen frei geben.
Auch alles Getier im Dorf und weit ringsum scheint munterer geworden. Da, krähen nicht die Hähne viel freudiger, unternehmenslustiger als sonst? Scharren die Pferde nicht ungeduldig mit den Hufen, rufen die Kühe nicht brummend nach grünen Weiden?
Ein strahlender, blauer Himmel zieht in den nächsten Tagen über Dobrovo auf, immer kräftiger wärmen die Sonnenstrahlen alles, was da lange, viel zu lange, den endlosen russischen Winter hindurch bange und frierend sich verkrochen hatte, in der Erde, unter der Rinde, in der Hütte, hinter dem Ofen. Gawruschka führt Jossip über den sonnigen Platz vor dem Herrenhaus. Auf der obersten Stufe der Freitreppe steht Marfa, gebeugt, zerbrechlich, von dem scheinbar viel zu großen schwarzen Fransentuch fast völlig verhüllt, und sie winkt ihnen leicht zu, und Gawrilo scheint es, als hätte ein leichtes, kaum merkliches Lächeln ihre Lippen umspielt.
Jossip wird für sein Alter recht munter, richtet seine Nüstern in den Wind und schüttelt mehrmals den Kopf mit der langen, blonden Mähne. Gawrilo schaut ihn traurig an.
Ach ja, Jossip, wieder naht ein Frühling und neues Leben bricht an, anderes ist vergangen, und doch geht alles weiter. Sieh, wie herrlich die Sonne uns bescheint, das junge Grün aus den Knospen hervor bricht, wie die Vögel herumflattern, die Zweige der Birken lustig rauschen, die der Kastanien auch, ja mein Lieber, neues, schönes Leben kommt nun endlich in unser Dobrovo. Doch ohne Petrus, verstehst du, Jossitschka, ohne unseren Petja, hochgeboren...
Verstohlen schaut sich Gawrilo um, schnäuzt in ein großes buntes Tuch und trottet gesenkten Hauptes und schlürfend mit Jossip zum Stall zurück.
3. Die Feuersbrunst
Dieser vierzehnte September im Jahre 1944 bringt am Vormittag noch spätsommerlichen Sonnenschein. Dann zieht dichte, dunkle Bewölkung auf und es wird kühl. Der fünfjährige Jan Dobrowsky sitzt in dem einzigen Zimmer der Wohnung in der Berliner Richthofenstraße an einem kleinen Tisch und spielt mit einem Blechauto.
Die Wohnung im Berliner Bezirk Friedrichshain liegt im vierten Stock. Von der Treppe gelangt man in einen winzigen Vorflur mit vier Türen. Die Küche ist so groß, dass auch ein Esstisch für vier Personen Platz hat, der ein so genannter Abwaschtisch ist; man zieht ein Gestell hervor, in dem sich zwei emaillierte Schüsseln befinden. Neben der Küche findet man eine kleine Toilette und unmittelbar bei dieser das winzige Zimmer der Schwester Gerda, die vierzehn Jahre älter ist als er, also 19 und erwachsen.
Der Hauptraum der Wohnung mit ungefähr zwanzig Quadratmetern Fläche ist Wohnzimmer, Elternschlafzimmer und Kinderzimmer zugleich. Der Junge schläft, mit fünf Jahren, immer noch in einem Gitterbett nahe beim Kachelofen.
Ein kleiner Balkon zur Straßenseite hinaus ist der einzige Luxus dieser Wohnung. Von hier aus sieht man an bestimmten Tagen die großen roten Fahnen wehen, die in der Mitte einen weißen Kreis mit dem Hakenkreuz darin tragen. Es geht den Menschen nicht gut, Lebensmittel sind rationiert, viele Häuser wurden zerstört und die Angst vor weiteren Bombenangriffen ist allgegenwärtig. Aber die Hakenkreuzfahne hängen sie alle heraus, wenn es gefordert wird. Blockwarte der NSDAP kontrollieren streng, ob die Leute alle flaggen.
„He, Kowalski! Kowalski, dritter Stock, häng jefällichst die Fahne raus, aber bisschen dalli, sonst setzt es was!“
Und hastig mit fliegenden Händen öffnet der alte Mann im dritten Stock das Fenster, hochrot im Gesicht, es ist der Blutdruck, und er nestelt herum, die Fahne anzubringen, irgend etwas ist mit dem Fahnenhalter, er schafft es, endlich, noch ein rotes Tuch flattert im Wind, der durch die Straße geht...
Breitbeinig, die Stiefel krachen auf das Pflaster, die braune Uniformhose um das fette Gesäß gespannt, die Finger hinter den Koppelriemen geklemmt, so spreizt sich der Blockwart in der Wollust seiner kleinen, winzigen, unendlichen Macht und blickt die Fassaden empor, ob er noch mehr Sünder ertappen kann.
Neben der Angst vor den Bomben ist die Angst vor den Nazis so groß wie nie. Menschen verbrennen in getroffenen Häusern, Menschen verschwinden auch ohne Bombenangriff – unerklärlich, wie weggezaubert. Es wird nur geraunt, hinter der vorgehaltenen Hand. Niemand begehrt laut auf. Die Angst mit ihren vielen hässlichen Gesichtern hat alle im Griff. Die Demoralisierung der Bevölkerung, von den englischen und amerikanischen Planern des Bombenkriegs gegen die Zivilbevölkerung erdacht, ist eingetreten, führt aber nicht zum Sturz des Hitlerregimes. So haben alle diese Bomben, all das Leid, die vielen Tode, die gestorben werden, keinerlei Bedeutung für den Kriegsausgang. Sie haben nur Bedeutung für die Getroffenen.
Nach dem Mittagessen in der Küche, es wird immer in der Küche gegessen, sagt Charlotte zu Gerda:
„Ich glaube, es wird heut keinen Fliegeralarm geben, Gott sei Dank nicht, einen Tag lang mal Ruhe haben, die Wolken sind so dicht, da können die dort oben doch gar nichts sehen. Lass mal den Abwasch stehen und gehe aus, glaube mir, es gibt heute keinen Alarm, nicht bei dem Wetter.“
Ihr sonst oft sehr harter Gesichtsausdruck löst sich bei diesen Worten, fast erscheint sie heiter, wirft dem Jungen und Gerda ein Lächeln zu, steht auf, um in der Wohnung herum zu räumen und trällert dabei, ganz leise, eine Operettenmelodie vor sich her, holt eine Kanne mit Wasser aus der Küche, gießt die recht stattliche Zimmerlinde, die am Balkonfenster, gleich neben Jans Spieltischchen steht. Dieser kleine Kindertisch ist Jan Dobrowskys ganzes Reich, und wenn es draußen warm genug ist und die Sonne scheint, dann hat Charlotte Ruhe vor ihm, weil der Tisch auf den Balkon gestellt wird.
Im Sommer hatte er daran gesessen, mit dem Blechauto gespielt, es mit lautem Brummen in die Blechgarage hinein gefahren und wieder heraus, dann wieder hinein und wieder heraus, natürlich wurde das langweilig, hinein, heraus, er schleppte seine große Holzeisenbahn heran, die rot und grün bemalte Lokomotive, die ebenso bemalten Waggons, drei waren es, nein vier sogar, aber nun wurde es noch enger auf der kleinen Tischfläche und obwohl er heftig pfiff, zischte und tutete, an ein ordentliches Rangieren war nicht zu denken, geschweige denn an eine regelrechte und fahrplanmäßige Zugfahrt. Die äußerst begrenzten Umstände behinderten seinen Spieltrieb, seine Freude, seine Fantasie, und die Behinderung muss so schockierend gewesen sein, dass er die Fahrzeuge allesamt über die Balkonbrüstung auf die Straße warf. Nach einer Weile klingelte es an der Wohnungstür und Gerhard aus dem ersten Stock, ein langer Sechzehnjähriger in schwarzer Hitlerjugend-Uniform, stand vor der Tür, die Eisenbahntrümmer im Arm.
Die Mutter, also Charlotte, war derart entrüstet, dass ihr zunächst der Mund offen blieb. Nachdem die Tür ins Schloss gefallen war, holte sie den Teppichklopfer und ließ ihn auf Jans empfindliches Hinterteil tanzen. Doch ihre Wut hatte sich noch längst nicht ausgetobt, also wurde er ein zweites und ein drittes Mal bestraft, das hieß: kein Abendbrot und sofort ins Bett. Ihre Erziehungsmethoden behielt sie mit Überzeugung bei, auch als er mindestens schon doppelt so alt war. Es waren proletarische Erziehungsmittel, man hatte es von den Eltern übernommen, diese von den Großeltern. Ein bisschen Prügel hat noch niemandem geschadet, wir sind auch anständige Menschen geworden, hieß es.
Es gefällt ihm, sie heute heiter zu sehen. Sie schimpft nicht vor sich hin, sie verflucht niemanden. Sie sitzt im Zimmer am Tisch und trinkt Malzkaffee und betrachtet wohlwollend die Zimmerlinde. Im Radio spielt man Berliner Lieder, berühmte Gassenhauer, „...denkste denn ick liebe dir, nur weil ick mit dir tanze...“, Lotte trällert die meisten Lieder mit. Das Radio ist ein Volksempfänger mit dem respektlosen Spitznamen „Goebbelsschnauze“, ein schwarzer Kasten, oben abgerundet, darunter ein rundes Lautsprecherfeld mit einem bräunlichen Stoff verkleidet, das wie Sackleinen aussieht. Der Junge denkt immer, in dem Kasten sitzen kleine Leute, die sprechen und singen und Musik machen. Charlotte kann ihm auch nicht erklären, wie das Ding funktioniert. Und der Vater ist weit weg, irgendwo in Bayern. Nicht an der Front, denn er ist schwerbeschädigt, ein Krüppel, wie er sagt, seit jenem schweren Motorradunfall im Jahre 1942. Nun ist er in der Nähe von Ulm bei einem Bataillon, bei dem sie Pferde haben, die muss er pflegen, striegeln, putzen, und die Ställe ausmisten muss er. Immerhin, wenigstens nicht im Graben, hier in Bayern pfeifen ihm keine Kugeln und Granaten um die Ohren.
Lotte geht mit Jan noch einmal auf die Straße, zu dem kleinen Laden um die Ecke, aber Zucker, den sie braucht, gibt es heute nicht, und so schimpft sie wieder, da sind noch andere Frauen in dem Lädchen, die schimpfen auch, dann schellt die Türglocke und einer aus der Nachbarschaft kommt herein, ein ziemlich dicker Endfünfziger, der immer einen grauen Hut trägt und ein graues Sakko zu einer dunkelbraunen Kordhose, und am Sakko trägt er, sehr auffällig, das goldene Parteiabzeichen, und wie er den Laden betritt, forsch, kraftvoll, rosig, dick, reißt er den linken Arm hoch und dröhnt: „Heil Hitler“, und die Ladenbesitzerin antwortet ebenso, und die Frauen im Laden hören sofort mit dem Schimpfen auf und verlassen das Geschäft, schnell, huschend, unauffällig.
Nach dem Abendbrot heizt Lotte den Kachelofen ein. Zeitungspapier, Holzspäne, zwei, drei dickere Scheite, eine Presskohle kommen hinein. Das Feuer prasselt lustig und flackert durch die Luftöffnungen der Eisentür. Schließlich verschwinden auch die Trümmer von Jans Eisenbahn im Ofen. Sie befanden sich seit dem Sommer in einem Pappkarton in der Toilette, da wo im Winter Holz- und Kohlevorräte gelagert werden.
Er wehrt sich gegen den Feuertod seiner Eisenbahn, schreit, trampelt, kreischt, bis Lotte die Sache mit einer kräftigen Ohrfeige besiegelt. Dieses Feuer findet er gar nicht lustig. Die Eisenbahntrümmer waren ihm ein liebes Spielzeug geworden, ja, sie waren ihm lieber als die unversehrte Eisenbahn: mit den Einzelteilen konnte er seine Fantasie ausleben, konnte zusammensetzen, auseinander nehmen, auftürmen, umstürzen, die Teile wurden zu Häusern, Autos, Tieren, so entstand ein Zoo oder auch eine Stadt.
Doch Lotte ist hart und Brennmaterial knapp. Seine kindlichen Gefühle spielten da keine Rolle.
Langsam verbreitet der Ofen eine leichte, angenehme Wärme. Es ist acht Uhr und draußen stockfinster, es ist eigentlich Vollmond, aber der kann seine blasse Helligkeit nicht auf die Erde werfen. Die Wolken halten den Mondschein fern. Und die Bomben. Er muss ins Bett, obwohl er noch keine Lust dazu hat. Doch Mutters Miene und ihre Bewegungen werden schon wieder hart, wehren jeden Widerspruch ab, also muss er sich fügen. Pullover und Strümpfe werden ausgezogen, die übrige Tageskleidung nicht. Sie schlafen seit Monaten, seit die Bombenangriffe in immer kürzeren Abständen erfolgen, nur noch in Tageskleidung.
Die Mutter deckt ihn mit einer leichteren Decke zu. Jetzt streicht sie ihm über den Kopf und sagt: „Schlaf schön.“
Sie setzt sich in einen der zwei kleinen Sessel, die sie besitzen, knipst die Stehlampe mit dem riesigen Stoffschirm an und das Oberlicht aus. Die Fenster sind mit schwarzen Rollos verdunkelt, das ist Vorschrift und wird von der Straße aus durch die Blockwarte kontrolliert.
Lotte nimmt Strickzeug zur Hand und arbeitet an einem neuen Wollschal für ihn. Der Winter kommt bestimmt und er kann hart und das Heizmaterial knapp werden.
Der Schirm der Lampe ist ziemlich dunkel und lässt das meiste Licht nur nach unten fallen, wo Lotte im Sessel leise mit ihren Stricknadeln klappert. Gerda, die Schwester, ist nicht nach Hause gekommen. Wird bei ihrem Freund geblieben sein, das macht sie seit einiger Zeit öfter. Sie kennen den Freund noch nicht. Lotte scheint es egal zu sein, mit wem Gerda zusammen ist. Die beiden Frauen vertragen sich nicht so besonders gut. Sind beide froh, wenn sie sich aus den Augen sind. Diese Unverträglichkeit hat handfeste Gründe.
Jetzt, in diesem Moment, wirkt der Abend friedlich, gemütlich. Der Raum ist in eine warme, dunkle Helligkeit getaucht. Ab und zu knackt das Feuer im Ofen noch ein wenig. Leise klappern Lottes Stricknadeln und hin und wieder räuspert sie sich. Sie spricht auch manchmal vor sich hin, vielleicht, wenn ihr eine Masche herunter gerutscht ist, aber sie flüstert eigentlich nur, Jan kann kein Wort verstehen. Dann hört er plötzlich noch Windgeräusche, ein leises Pfeifen und Zischen, die Balkontür gibt ein winziges Klappern von sich, denn sie schließt nicht so ganz dicht; im Winter werden dicke Decken vor Balkontür und Fenster gehängt.





























