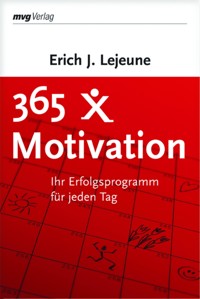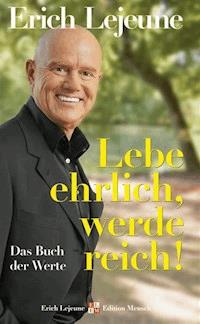15,99 €
Mehr erfahren.
Wie kriegen wir Deutschland in positives Fahrwasser und das nationale Stimmungsbarometer wieder auf 'gut Wetter'? Kurswechsel! Erich J. Lejeune hat es satt, in einem Land zu leben, das miese Laune hat. In einer Nation, die das Nörgeln kultiviert. Einer Republik, die in der Wirtschaftsflaute vor sich hin dümpelt. Krisen, Koalitionen, Katerstimmung: Der Management-Referent und Politikberater legt den Finger in die Wunde unserer negativistisch geprägten Zeit, nimmt gesellschaftliche und politische Missstände unter die Lupe und nennt Ross und Reiter. Lejeune hat unschlagbare Argumente und Strategien, die in Richtung Aufbruch weisen. Er ist ein Mann der Praxis und Theorie ausgezeichnet vernetzt. Was er hier erörtert, ist Spiegelbild des gesellschaftspolitischen Status quo. Dieses Werk liefert einen vielschichtigen Beitrag zur aktuellen Wertediskussion.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Erich J. Lejeune
Schluss mit Angst!
Erich J. Lejeune
Schluss mit Angst!
Für mehr Vertrauen in Deutschlands Zukunft
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
Nachdruck 2013
© 2007 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Eberhard Wolf, Süddeutsche Zeitung
Umschlagabbildung: Werner Otto
Autorenfoto: Cliff Serna
Satz: M. Zech, Redline GmbH
Druck: Books on Demand GmbH, Norderstedt
Printed in Germany
ISBN Print 978-3-86882-459-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86415-493-5ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86415-882-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unterwww.muenchner-verlagsgruppe.de
eBook by ePubMATIC.com
Ich widme dieses Buch allen Menschen, die wie ich an eine gute Zukunft Deutschlands glauben und bereit sind, sich mit all ihren Fähigkeiten dafür einzubringen.
Inhalt
Vorwort
Deutschland schwierig Vaterland
Es gibt viele Gründe, stolz auf Deutschland zu sein
Politisch Lied, ein garstig Lied?
Unsere Probleme sind hausgemacht und deshalb lösbar
Hoffnungsbringer, nicht Unglücksboten – Europa und die Globalisierung
Wirtschaft und Moral – ein Widerspruch?
Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität – Gleichklang oder Gegensätze?
Anything goes ist out – die Renaissance der bürgerlichen Werte
Alle werden gebraucht
Schlusswort
Vorwort
Ende November 2005. Ich sitze im Flieger nach London. Am Flughafen habe ich mir das Buch Schluss mit lustig!Das Ende der Spaßgesellschaft gekauft, das seit Monaten an der Spitze der Bestsellerlisten steht. Der Autor Peter Hahne ist mir nicht nur als Hauptstadtkorrespondent des ZDF bekannt. Ich weiß, dass er ebenfalls Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ist und stets offensiv für seinen Glauben streitet. Das macht ihn mir besonders sympathisch. Auch ich bin evangelisch, auch mir ist der Glaube sehr wichtig, und ich bedauere, dass ich in vielen Predigten von allen möglichen Problemen aus aller Welt höre, aber sehr wenig von Gott.
Ich freue mich auf die Lektüre. Aber schon beim Inhaltsverzeichnis gerate ich ins Stutzen. „Freizeit, Gleichgültigkeit, Liederlichkeit“, „Der Krieg der Generationen“, „Die letzten Fußkranken der Völkerwanderung“, „Feige Kompromissgesellschaft“. Eine Anklage jagt die andere. Besonders springt mir die Überschrift „Unser New York heißt Erfurt“ ins Auge. Was ist damit denn gemeint? Ich schlage das Kapitel auf und traue beim Lesen meinen Augen nicht. Hahne zieht dort allen Ernstes eine Parallele zwischen dem gezielten und kaltblütig geplanten Bin-Laden-Terroranschlag am 11. September 2001 in New York, dem Tausende Menschen zum Opfer fielen, und dem Amoklauf eines achtzehnjährigen Schülers in einem Gymnasium in Erfurt, das im April 2002 sechzehn Menschen das Leben kostete. Eine schreckliche Bluttat, gewiss. Aber wie kann man diese beiden völlig unvergleichlichen Ereignisse in einen direkten Zusammenhang setzen?
Nachdem ich das Buch durchgelesen hatte, war meine Seelenverwandtschaft, mit der ich mich Hahne zuvor verbunden fühlte, gründlich erloschen. Selten hat mich ein Text so wütend gemacht. Denn dem im christlichen Gewande daherkommenden Autor geht es mitnichten darum, „Gott in die Politik“ zurückzuholen, wie er pathetisch trompetet. Vielmehr hat er sich selbst auf eine Wolke gesetzt, von der aus er einen wirren Zettelkasten mit so ziemlich allen Katastrophenmeldungen dieser Welt auf Deutschland herniederregnen lässt, gleichsam als Vorbote für das unmittelbar bevorstehende Jüngste Gericht mit Peter Hahne als Vorsitzendem Richter.
Nicht die Verbreitung der christlichen Botschaft von Glaube, Hoffnung und Zuversicht ist das Ziel, sondern die bewusste Instrumentalisierung des deutschen Seelenschmerzes und der Selbstzweifel. Statt Ängsten mit rationalen Argumenten entgegenzutreten, werden Furcht und Unsicherheit gezielt geschürt. Mit Erfolg, wie die Auflagen zeigen.
Da vergeht einem tatsächlich das Lachen. Mit der Realität Deutschlands hat Hahnes apokalyptischer Parforceritt allerdings nichts zu tun.
Als ich in London das Flugzeug verlasse, steht mein Entschluss fest: Ich werde Hahne mit einem eigenen Buch antworten. Auch mein Thema wird die Lage Deutschlands und die seiner Gesellschaft sein. Ich werde dabei keine rosarote Brille aufsetzen und kein Problem schönreden. Mit mentaler Beschwörung, wie sie etwa jene flächendeckende „Du bist Deutschland“-Werbekampagne versucht, mit der uns verkündet wird, wir seien wahlweise Beethoven, Einstein oder Claudia Pechstein, wird sich die Stimmung in Deutschland nur schwerlich aufhellen lassen.
Unser eigentliches Problem sehe ich anderswo: Wir scheinen uns einen mentalen Magneten eingepflanzt zu haben, der alles Negative wie Stahlspäne fest an sich zieht und alles Positive abstößt. Doch je zögerlicher und mutloser wir an die uns gestellten Aufgaben herangehen, desto schwieriger wird es, sie zu lösen, und desto länger wird es dauern. Die Bereitschaft, auch eine bittere Medizin zu schlucken, wird umso größer sein, sofern wir die Erwartung hegen können, dass es uns anschließend besser geht als vorher. Und sie hängt auch davon ab, dass diese Medizin gerecht an alle verteilt wird und nicht ein Teil der Gesellschaft stattdessen Champagner schlürft.
Diese sich für die Zukunft unseres Landes wahrlich lohnende Kraftanstrengung wird uns zudem leichter fallen, wenn wir uns selbst nicht kränker reden oder reden lassen, als wir es tatsächlich sind. Auf dem SPD-Parteitag am 15. November 2005 sagte der neu gewählte Vorsitzende Matthias Platzeck den ebenso schlichten wie heute so selten zu hörenden Satz: „Deutschland ist ein wunderschönes Land.“ Platzeck hat Recht. Es gibt so vieles, auf das wir stolz sein und worauf wir aufbauen können.
Deutschland schwierig Vaterland
Als jemand, der den weltweit bestaunten deutschen Wiederaufbau von Beginn an miterlebt hat, dessen Geist heute immer wieder nostalgisch beschworen wird, kann ich nicht glauben, dass die Deutschen von einem kollektiven Masochismus befallen sind, der sie nur noch im Schmerz Erfüllung finden lässt. Auch wenn die heutigen Umstände völlig andere sind, an der Kraft und der Fähigkeit, wieder Beeindruckendes zu leisten, fehlt es den Menschen in unserem Land auch momentan nicht.
Vertrauen, genauer gesagt sein Verlust auf fast allen staatlichen und gesellschaftlichen Ebenen, aber auch mangelndes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in das eigene Handeln, erscheint mir das Schlüsselproblem zu sein, aus dem der fast seuchenhaft verbreitete allgemeine Missmut und die damit verbundene Zukunftsangst resultieren.
Bei der Wiederherstellung neuen Vertrauens in die Zukunft Deutschlands steht allerdings keineswegs nur die Politik in der Pflicht, die hoffentlich endlich gelernt hat, wie verhängnisvoll es ist, mehr zu versprechen als man halten kann. Nicht minder ist die Wirtschaft gefragt, die es ebenfalls bis heute nicht verstanden hat, den Menschen überzeugend zu vermitteln, welchen Beitrag sie leisten kann und wird, dass auch im verschärften globalen Wettbewerb Gemeinwohlorientierung und soziale Verantwortung unverzichtbare Teile einer unternehmerischen Ethik und eines unternehmerischen Handelns bleiben müssen.
Aber der Vertrauensentzug, den die Menschen der Politik, der Wirtschaft, aber auch anderen Eliten und Institutionen zuteil werden lassen, erklärt nur zum Teil die schon so lang anhaltende triste Stimmung und Zukunftsangst in Deutschland. Nach der „deutschen Krankheit“ ist nun die „deutsche Angst“ international zu einem negativen deutschen Markenzeichen geworden. Angst aber, das weiß jeder aus seinem privaten Leben, löst Starre aus, verdüstert unsere gesamte Wahrnehmung und macht uns damit unfähig, die uns gestellten Aufgaben zu lösen. Für einen einzelnen Menschen mag es nachvollziehbare Gründe für subjektive Angstzustände geben. Für eine solche Lähmung, von der unser Land und große Teile der Menschen befallen zu sein scheinen, gibt es jedoch keine objektiven sachlichen Gründe.
Deutschland sei ein „schwieriges Vaterland“, befand einst der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann. Und auf die Frage, ob er dieses Land denn liebe, antwortete er: „Ich liebe meine Frau.“ Das war vor mehr als dreißig Jahren.
Das Thema, wie es die Deutschen denn mit ihrem Land halten, ob es zulässig sei zu sagen, man sei stolz, ein Deutscher zu sein, beschäftigt uns bis zum heutigen Tag. Das Gleiche gilt für die Frage, ob – und wenn ja warum – es den Deutschen an Patriotismus mangele, ob wir eine „deutsche Leitkultur“ formulieren müssten und wenn ja, was diese beinhalten sollte. Und überhaupt: Wann würden die Deutschen ihr Land als einen „normalen“ Staat betrachten, wie dies alle anderen Nationen für ihr jeweiliges Land beanspruchen und sich dementsprechend verhalten?
In regelmäßigen Abständen wird von Publizisten und Politikern, wie zuletzt von Bundestagspräsident Norbert Lammert, eine solche Debatte gefordert. Doch eine breite öffentliche Diskussion ist daraus nur selten geworden, der Mehrheit der Deutschen scheint sie kein dringliches Bedürfnis zu sein, und so verschwindet das Thema dann wieder über längere Zeit.
Ist diese Debattenverweigerung nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Land? Nun, dass wir uns in Deutschland schwerer tun, ein „normales“ Nationalgefühl zu entwickeln, hat natürlich mit unserer Geschichte zu tun – auch, aber keineswegs nur mit den zwölf Jahren nationalsozialistischer Diktatur.
Während andere Länder wie England, Frankreich oder Spanien seit Jahrhunderten fest umrissene Grenzen haben, lebten die Deutschen in ganz unterschiedlichen staatlichen Strukturen, die eine nationale Identität kaum möglich machten. Das im 10. Jahrhundert aus dem ostfränkischen Reich hervorgegangene Römische Reich, das im 12. Jahrhundert den Zusatz „Heilig“ erhielt und dem Anfang des 16. Jahrhunderts die weitere Komplettierung „Deutscher Nation“ hinzugefügt wurde, war nun wahrlich kein Staatengebilde, in dem sich ein National- oder Heimatgefühl entwickeln ließ. Es war vielmehr eine katholische Universalmonarchie, in der, wie es Kaiser Karl V. formulierte, „die Sonne nicht untergeht“.
Sie endete im Jahre 1806. Auf dem Wiener Kongress 1814/15, auf dem die Staaten Europas nach dem Sturz Napoleons neu geordnet wurden, entstand der Deutsche Bund, dem knapp vierzig deutsche Fürstentümer und die reichsfreien Städte angehörten. Er taugte zur nationalen Identität ebenso wenig wie der Deutsche Zollverein, in dem sich 1833 unter der Führung Preußens die nord- und süddeutschen Einzelstaaten zu einem Binnenmarkt zusammenschlossen.
Nationale und liberale Kräfte machten sich dafür stark, die Kleinstaaterei zu beenden. Der Dichter August Heinrich Hoffmann von Fallersleben schrieb 1841 das „Deutschlandlied“, in dem es in der ersten Strophe heißt: „Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt, Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt.“ Was durch nationalsozialistischen Größenwahn diskreditiert wurde, war damals der Wunsch, Deutschland in den Grenzen der vier genannten Flüsse, die die Außengrenzen des Deutschen Bundes bildeten, zu einen.
1848 tagte dann in der Frankfurter Nationalversammlung die erste frei gewählte Volksvertretung aller deutschen Staaten, einschließlich Österreichs. Doch der Traum vom geeinten Deutschland platzte bereits ein Jahr später. Die Frankfurter Nationalversammlung wurde vom Militär aufgelöst.
1871 fand im Spiegelsaal des von Preußen eroberten Schlosses von Versailles die Gründung des zweiten Deutschen Reiches statt, und Wilhelm von Hohenzollern wurde zum deutschen Kaiser ausgerufen. Da Österreich nicht mit dabei war, galt das Bismarck-Reich als kleindeutsche Lösung. In Bayern, dank Napoleon seit 1806 Königreich und ein eigener Staat, war der Beitritt zum Deutschen Reich besonders heftig umstritten.
In einer Rückbetrachtung der damaligen Ereignisse zitierte der CSU-Bundestagsabgeordnete und Publizist Peter Gauweiler in der Süddeutschen Zeitung vom 28. Dezember 2005 einen politischen Kommentator, der seinerzeit die Auffassung vertrat, Deutschland sei nicht dazu bestimmt, ein abgeschlossener Nationalstaat zu sein. Der Universalismus, die beste aller deutschen Traditionen, stelle keinen Gegensatz zu einem vielfältigen sonstigen Sonderleben der Landschaften und Regionen dar, wohl aber die absehbare Dominanz des neuen Zentralstaates von Berlin, der ein fälschlich so genanntes „Reich“ ohne Ideen und wirkliche Kultur geschaffen habe. Gauweiler erinnerte auch an die sorgenvolle Prognose eines bayerischen Landtagsabgeordneten: „Wohin führt die Gründung eines solchen Staates? Zu Kriegen, zur Bekämpfung anderer Staaten! Die Sucht, die Herrschaft über Europa zu bekommen, liegt dem zugrunde.“
Dieser Volksvertreter aus Passau sollte auf erschreckende Weise Recht bekommen. Tatsächlich bestand bis 1945 das Problem mit Deutschland darin, dass es einerseits (gottlob) nicht groß genug war, Europa dauerhaft zu beherrschen, aber andererseits zu groß, als dass sich die Nachbarn nicht vor ihm fürchteten. Eine Furcht, die auch im Zuge der Wiedervereinigung vor allem in Frankreich und Großbritannien noch einmal deutlich wurde. Der berühmte Satz des französischen Schriftstellers André Malraux, „Ich liebe Deutschland so sehr, dass ich froh bin, dass es zwei gibt“, gab die Empfindungen nicht nur in diesen beiden Ländern wieder. Der Publizist Sebastian Haffner wiederum schrieb über das Bismarck-Reich in seinen Historischen Variationen lapidar: „Es war kein Segen daran.“
Die Weimarer Republik, die aus der Novemberrevolution hervorging, mit der Arbeiter- und Soldatenräte 1918 den Sturz der Monarchie erzwungen hatten, stand von Beginn an unter einem schlechten Stern. Es fehlte ihr der Rückhalt in der Bevölkerung, insbesondere im Bürgertum. Die harten Bedingungen des Friedensvertrags von Versailles, die Massenarbeitslosigkeit, die wirtschaftliche Not großer Bevölkerungsteile durch die Weltwirtschaftskrise ab 1929, das sich gegenseitige Hochschaukeln der radikalen Kräfte von kommunistischer und nationalsozialistischer Seite, unstabile Regierungen – das alles trug zu ihrem Scheitern und zu der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 bei.
Schließlich dann der völlige Zusammenbruch im Mai 1945. Deutschland war nicht nur wirtschaftlich, sondern auch moralisch am Boden zerstört. Es hatte sich nicht aus eigener Anstrengung vom Nationalsozialismus befreien können, es musste befreit werden. Und beim Neuanfang gab es kein Modell, auf das man aus der eigenen Geschichte her hätte zurückgreifen können.
In seinem Deutschen Tagebuch notierte der frühere sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf unter dem 18. März 1990: „Zu den Eindimensionalitäten der Bundesrepublik gehört die Dominanz des Ökonomischen. Lange Zeit haben unsere Nachbarn die Bundesrepublik als eine Wirtschaft nach der Suche nach dem Staat empfunden. Daran ist richtig, dass die Bundesrepublik als eine staatlich verfasste Wirtschaft entstanden ist. Die Entscheidung für die Marktwirtschaft fiel, obwohl sie konstitutionellen Charakter hatte, ehe die Bundesrepublik sich konstituierte. Daraus erklärt sich, dass es in der Bundesrepublik bis heute spezielle Legitimationsprobleme des Staates gibt.“
Ähnlich drückte es der frühere amerikanische Außenminister Henry Kissinger in einem Interview mit der Welt aus, das am 27. Dezember 2005 veröffentlicht wurde: „Die Deutschen haben nach ihrer aufwühlenden Geschichte eine tiefe Sehnsucht nach Sicherheit und Stabilität, weit stärker als dies bei anderen Ländern der Fall ist. Im Sozialen verkörpert sich für die Deutschen das Sicherheitsversprechen des Staates. Interessanterweise wurde der Sozialstaat in Deutschland nicht erkämpft in der Auseinandersetzung zwischen Unternehmern und Arbeitern, sondern von den konservativen Eliten von oben herab eingeführt.“
Was Kissinger damit meint, sind etwa die Gesetze zur Renten-, Kranken- und Unfallversicherung, die Reichskanzler Otto von Bismarck in den Jahren 1889 bis 1893 erließ und die vor allem das Ziel hatten, die Arbeiter an den Staat zu binden und der aufstrebenden Sozialdemokratie zu entfremden. Dazu gehört aber auch die Einführung der dynamischen Rente, die Bundeskanzler Konrad Adenauer 1957 gegen den Widerstand Ludwig Erhards durchsetzte.
Die große Mehrheit der Deutschen hat sich also nach 1945 vor allem über das Soziale und nicht über das Nationale definiert. Natürlich haben auch Ereignisse wie der überraschende Gewinn der Fußballweltmeisterschaft 1954 das Selbstwertgefühl gestärkt. Aber vor allem waren es der Siegeszug der D-Mark und das „Wirtschaftswunder“, die den Deutschen das Gefühl gaben: Wir sind wieder wer.
Aus der jüngsten Geschichte ließ sich ja nun wahrlich kein Nationalstolz ableiten. In den fünfziger Jahren wollten sich viele Deutsche noch damit trösten, die Schreckensherrschaft der Nazis sei nur das Werk weniger Verbrecher gewesen. Doch diese These wurde immer weniger haltbar, je mehr Fakten ans Licht kamen, die belegten, in welchem Ausmaß nicht nur die politischen, wirtschaftlichen oder juristischen Eliten, sondern auch ganz „normale“ Menschen in den Terror verstrickt waren. Erschütternd belegten dies Gerichtsverfahren wie der Frankfurter Auschwitz-Prozess Anfang der sechziger Jahre. Weltweit in den Mittelpunkt rückte die Mordmaschinerie vor allem durch den Eichmann-Prozess 1961.
Die Frage nach der Schuld der Väter war auch ein zentrales Thema der rebellierenden Studentenschaft und der außerparlamentarischen Opposition. Bei vielen Jüngeren machte sich geradezu das breit, was der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt einmal die Neigung zum „deutschen Selbsthass“ genannt hat. Das berechtigte Verlangen der jungen Generation, von den Älteren Rechenschaft über ihr Verhalten während des Dritten Reiches zu bekommen, schlug allerdings vielfach in moralische Selbstgerechtigkeit um. Wer nie in einer Diktatur gelebt hat und ihren Anpassungszwängen unterworfen war, sollte sich nicht allzu sicher sein, selbst allen Anfeindungen widerstanden zu haben. Diesen rückwärts gewandten Mut erleben wir ja bis heute auch bei der Kritik an Mitläufern des ehemaligen DDR-Staatsapparates.
Die Ostpolitik der sozial-liberalen Koalition unter Willy Brandt und Walter Scheel hat die ganze nationale Zerrissenheit aufgezeigt. Die einen forderten die Anerkennung der Realitäten, also der nach dem Zweiten Weltkrieg gezogenen Grenzen, um auf diese Weise den Kalten Krieg zu überwinden und zu einer Aussöhnung mit den östlichen Nachbarn zu gelangen. Die anderen sahen darin einen „Ausverkauf deutscher Interessen“ und forderten, an dem Ziel einer deutschen Wiedervereinigung in den Grenzen von 1937 (also unter Einschluss der heute von Polen bewohnten Gebiete) festzuhalten.
Wer auf das Schicksal der Millionen deutschen Vertriebenen hinwies, sah sich sofort dem Verdacht ausgesetzt, die Naziverbrechen zu relativieren. Ein Missverständnis, das bis heute etwa bei der Diskussion um die Errichtung eines Zentrums gegen Vertreibungen in Berlin nachwirkt.
Wer vom eigenen Land als „Deutschland“ sprach, sah sich mancherorts bereits in die rechtsradikale Ecke gedrängt. Als korrekt galt allein „Bundesrepublik Deutschland“, vom linken politischen Spektrum meist noch auf „BRD“ verkürzt und damit auf die gleiche Ebene wie die „DDR“ gehoben. Beliebt war auch, von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verächtlich als „FDGO“ zu sprechen.
Es war dann die Gnade der Geschichte und der Mut vieler Menschen in der damaligen DDR, die Deutschland – für alle überraschend – in kurzer Zeit die staatliche Einheit brachte. Als Günter Grass dagegen mit dem Satz aufbegehrte, ein Land, das für Auschwitz verantwortlich gewesen sei, habe kein Recht auf Wiedervereinigung, war es der lange Zeit als „Vaterlandsverräter“ geschmähte Willy Brandt, der ihm in die Parade fuhr und postulierte: „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.“ Doch die Hoffnung und Erwartung mancher, mit der wiedergewonnenen Einheit würde Deutschland nun endlich ein „normaler“ Nationalstaat, dem die patriotischen Gefühle seiner Bürger zufliegen würden, hatten sich nicht erfüllt.
So kritisierte der leider so früh verstorbene Journalist und Autor Herbert Riehl-Heyse zum Jahrestag in der Süddeutschen Zeitung vom 2. Oktober 2002, dass viele Menschen ihr „gesamtdeutsches Interesse kurzfristig auf das Befestigen von Deichkronen und den Zusammenhalt der Fußball-Nationalmannschaft (verlagern). Es ist, als habe man dem Einheitsland den Boden unter den Füßen weggezogen: Offenbar kaum noch Sorgen, über die mit gemeinsamen Vorgaben zu reden lohnt, noch weniger gemeinsame Perspektiven. Vielleicht sollte man zum nächsten Geburtstag dem Land ja ein Puzzle schenken, damit man irgendwie wieder erkennt, wie es gedacht ist.“
Deichkronen und Fußball, mehr gesamtdeutscher Kitt fiel auch unserer jetzigen Bundeskanzlerin nicht ein, als sie in einem Interview mit der Welt vom 14. Januar 2003 gefragt wurde, ob sich der Nationenbegriff überlebt habe. Angela Merkels Antwort damals: „Ganz und gar nicht. Es besteht nach wie vor ein hohes Bedürfnis nach Identifikation – und das Nationalgefühl spielt dabei eine bedeutende Rolle. Das sieht man, wenn die Fußball-Nationalmannschaft spielt, wenn Sven Hannawald springt oder Jan Ullrich Rad fährt.“
Dabei haben wir keineswegs einen Mangel an Patriotismus, nur schlägt sich dieser eben weniger auf nationaler als auf regionaler Ebene nieder. Das ist auch nicht verwunderlich. Schließlich waren es die deutschen Länder, die 1949 mit ihrer Zustimmung zum Grundgesetz den Bund gegründet haben und nicht umgekehrt, wie der missverständliche Begriff „Bundesländer“ glauben macht. Es war daher auch nur folgerichtig, dass vor den ersten gesamtdeutschen Wahlen 1990 die Länder in der ehemaligen DDR wieder hergestellt wurden, die von der SED 1952 mit einem Federstrich aufgelöst worden waren.
Löst der Satz „Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein“, vom FDP-Vorsitzenden Guido Westerwelle noch durch ein pathetisch dröhnendes „I am proud to be a German“ überhöht, doch unwillkürlich ein Stirnrunzeln aus, nimmt niemand Anstoß daran, wenn jemand sagt: „Ich bin stolz, ein Bayer, Sachse, Berliner oder Hamburger zu sein.“ Dieser ausgeprägte Regionalpatriotismus der Deutschen ist kein Verrat an nationalen Interessen, sondern eröffnet große Chancen. Die Regionen, die näher an den Bürgern sind, können den Ansehens- und Vertrauensverlust eher auffangen als ein doch eher künstlicher, weil nicht traditionell gewachsener Nationalstaat, der über den Sport und Naturkatastrophen hinaus doch mehr eine Angelegenheit des Kopfes als des Herzens ist.
Und deshalb werden wohl auch weiter alle Versuche ins Leere laufen, den Menschen die Identifikation mit einer „deutschen Leitkultur“ schmackhaft zu machen. Dieser und einer ebenfalls immer wieder geforderten „Nationalkultur“ hat der langjährige bayerische Kultus- und Wissenschaftsminister Hans Zehetmair schon in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung vom 10. November 2000 eine ebenso knappe wie überzeugende Absage erteilt: „Es gibt keine Nationalkultur, es gibt nur die Vielfalt der Kulturen in Deutschland ... Es gibt auch keine deutsche Leitkultur, sondern eine Kultur der Werte, wie sie aus dem christlichen Abendland und der Geschichte Europas entstanden ist.“
Gescheitert sind auch alle Versuche, die Begeisterung für die deutsche Nationalhymne und die schwarz-rot-goldene Fahne zum Gesinnungstest für patriotische Zuverlässigkeit zu machen. Ich finde die deutsche Hymne wunderschön, ebenso wie die bayerische. Aber sie sollten wirklich festlichen Anlässen vorbehalten bleiben. Früher beschloss der Bayerische Rundfunk sein Hörfunk- und Fernsehprogramm mit den Hymnen. Hymnen als „Programm-Rausschmeißer“? Das fand ich eher befremdlich. Und wenn ich bei viertklassigen Boxweltmeisterschaften vor dem versammelten Rotlichtmilieu die Aufforderung des Ringsprechers zum Aufstehen für die Hymnen höre, weckt das in mir keine patriotischen Gefühle.
Wenn Amerikaner beim Abspielen der Hymne die rechte Hand auf das Herz legen, so wirkt dies natürlich und unverkrampft. (Aber auch US-Sportler haben schon die Fahne ihres Landes geschmäht und mit Füßen getreten.) Täten wir Deutsche dasselbe, würde es vermutlich ähnliche Reaktionen auslösen wie der ausgestreckte rechte Arm. Aber dass Spieler der Fußball-Nationalmannschaft während der Hymne wenigstens den Kaugummi aus dem Mund nehmen, wird man schon erwarten dürfen.