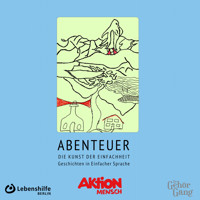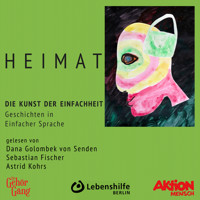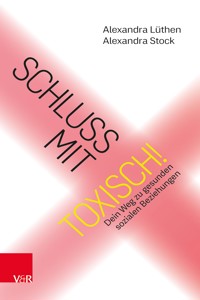
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Begegnungen mit anderen Menschen können uns bereichern und beflügeln. Oftmals sind es unsere sozialen Beziehungen, die unser Leben lebenswert machen. Was ist aber, wenn sich Kontakte mit bestimmten Menschen wiederholt als kräftezehrend, negativ und emotional belastend erweisen? Dann liegt der Verdacht nahe, dass hier toxische Muster im Spiel sind. Alexandra Lüthen und Alexandra Stock zeigen, wie wir diese erkennen und unterbrechen. Sie beleuchten toxische Beziehungs-, Kommunikations- und Verhaltensmuster und weisen Wege zu gesünderen Beziehungen auf – in der Familie, im Job, in der Partnerschaft und im Freundeskreis. Wir erfahren, warum familiäre Prägungen und gesellschaftliche Erwartungen toxische Dynamiken oft begünstigen und spezielle Anlässe wie Weihnachten, Muttertag oder berufliche Meetings diese triggern und zur emotionalen Falle werden. Anhand konkreter Anlässe wie Weihnachtsfeiern, Urlaubsplanung oder berufliche Entwicklungsgespräche werden typische Konflikte analysiert und Soforthilfen zur Deeskalation vorgestellt. Wir lernen mit praxisnahen Fallbeispielen, uns in schwierigen Situationen zukünftig souverän zu behaupten. Langfristige Strategien wie Wertearbeit, Stärken unserer Selbstachtung und bewusste Abgrenzung unterstützen uns ab jetzt dabei, gesunde Beziehungen aufzubauen – für mehr Freiheit, Klarheit und innere Stärke.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexandra LüthenAlexandra Stock
SCHLUSS MITTOXISCH!
Dein Weg zu gesundensozialen Beziehungen
VANDENHOECK & RUPRECHT
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2025 Vandenhoeck & Ruprecht, Robert-Bosch-Breite 10, D-37079 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill BV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill BV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Brill Wageningen Academic, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau und V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, Göttingen
EPUB-Erstellung: Bookwire GmbH, Frankfurt am Main
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
E-Mail: [email protected]
ISBN 978-3-525-40880-3 (print)
ISBN 978-3-647-99233-4 (epub)
Inhalt
Einleitung
Risiken und Nebenwirkungen: Bedenkliche Inhaltsstoffe von Beziehungen
Teil 1Vergangenheit – Wo alles beginnt
Vergiftete Wurzeln – Warum du immer wieder in toxische Situationen gerätst
Was wir unter toxischen Beziehungen verstehen
Warum es bei speziellen Anlässen oft toxisch wird
Gesellschaftliche Erwartungen
Familiäre Erwartungen
Persönliche Erwartungen
Alkohol – Booster für toxische Situationen
Toxische Dynamik im Modell
Teil 2Gegenwart – Die Muster erkennen
Die tägliche Dosis Gift – Woran du toxische Dynamiken erkennst und wie du dich schützt
Selbstfürsorge
Frühjahr
Familie: Muttertag
Beruf: Entwicklungsgespräche
Paar: Valentinstag
Soziales Umfeld: Fasching
Sommer
Familie: Hochzeit
Beruf: Urlaubsplanung und Vertretung
Paar: Sommerurlaub
Soziales Umfeld: Grillabende/Pärchentreffen
Herbst
Familie: Thanksgiving
Beruf: Messen und Dienstreisen
Paar: Halloween (Special: gruselige Erwartungen an Alleinerziehende)
Soziales Umfeld: Elternabend, schulisches Engagement
Winter
Familie: Weihnachten
Beruf: Weihnachtsfeier
Paar: Die Zeit zwischen den Jahren
Soziales Umfeld: Silvester
Teil 3Zukunft – Die neue Richtung
Gegengift für dein Leben – Wie du toxische Prägungen endgültig loslässt
Grundlage: Eine gesunde Beziehung zu dir selbst
Du bist nicht allein: Dein Inneres Team
10 für 10: Schnelle Hilfe für dein Inneres Team
Übung und Vorbereitung: Das Innere Team einarbeiten
Dein eigener Wertekompass für deine Beziehungen
Dein persönliches Werte- und Entwicklungsquadrat
Werte-Bingo
Glaubenssätze – die unsichtbaren Steuermechanismen unseres Lebens
Den eigenen Glaubenssätzen auf die Spur kommen
Warum es sich lohnt, sich bewusst mit Glaubenssätzen auseinanderzusetzen
Abgrenzung nach außen: Was will ich verändern?
Dein persönliches Manifest für mehr Selbstachtung und innere Stärke
Auf Wiedersehen oder Adieu?
Literatur
Disclaimer
Vorab: Toxische Beziehungen sind keine Diagnose, und nicht alle, die etwas sagen, was dir nicht gefällt oder dich verletzt, sind deshalb gleich psychopathisch veranlagt. Aber: Es gibt möglicherweise Kommunikations- und Verhaltensstrukturen im zwischenmenschlichen Kontakt, in Familien, in Teams, in Partnerschaften oder auch in der Interaktion im Freundes- oder Bekanntenkreis, die einseitig Schaden verursachen und dich unter Umständen stark einschränken und belasten. Wir können mit diesem Buch nicht dein gesamtes Umfeld analysieren. Was wir aber können, ist, beispielhaft aufzuzeigen, wie schädliche Dynamiken situativ auf Beziehungen einwirken. Falls dir vieles davon bekannt vorkommt und du dich häufig in der unterlegenen Position wiedererkennst, ist das ein guter Anlass, um dich selbstverantwortlich damit auseinanderzusetzen und deinen eigenen Anteil daran auszuloten.
Betroffene derart belastender Strukturen bezeichnen die Atmosphäre oft als giftig oder zersetzend, als ätzend und krank machend. Das lässt sich gut mit dem Begriff »toxisch« zusammenfassen, und in dieser Weise verwenden wir den Begriff für Beziehungen, die so erlebt werden. Die meisten Beziehungen sind nicht »rein toxisch«, sondern haben auch gesunde und liebevolle Aspekte, und man möchte sie aus guten Gründen nicht beschädigen und auch niemandem etwas Schlechtes nachsagen. Darum geht es hier auch gar nicht. Wir möchten in diesem Buch gemeinsam mit dir herausfinden, welche Situationen es sind, in denen du dich regelmäßig unbehaglich und geschwächt fühlst, die du persönlich als giftig erlebst und in denen du dir mehr Handlungsspielraum und emotionale Sicherheit wünschst. Wir möchten dich dazu ermutigen, deinem eigenen Urteil zu vertrauen – nicht, um andere zu verurteilen, sondern um fair und gerecht mit dir selbst umzugehen.
Einleitung
»Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, aber jede unglückliche Familie ist auf ihre besondere Art unglücklich«, schrieb Leo Tolstoi in seinem Roman »Anna Karenina« (Tolstoi, 1878/1956, S. 7). An dieser Stelle widersprechen wir dem Meister: Familiäres Unglück ist kein Einzelschicksal, es hat Methode und wirkt weitreichend fort ins spätere Leben, in Partnerschaft und Freundeskreis, in den Beruf und in die Gesellschaft. Wo Tolstoi recht hat: Du empfindest das Unglück so, als wärst du die Einzige, der es widerfährt, und nimmst damit auch an, dass es mehr mit dir selbst zu tun hat als mit den anderen. Das ist im Prinzip eine gute Annahme, denn ändern kannst du ja ohnehin nur dich selbst und dein eigenes Verhalten, nicht wahr?
Diese Überzeugung wird allerdings schnell zum Käfig, in dem du mit immer neuen Aufgaben der Selbstoptimierung beschäftigt bist, die dir von Eltern, Partner, Freundinnen und Freunden und Gesellschaft angereicht werden. Du sagst dir vielleicht: Solange ich nicht perfekt bin, kann ich schlecht andere kritisieren, oder? Und so zählst du eventuell zu den Menschen, die ihr Leben lang danach streben, endlich die perfekte Tochter, die gute Frau, die beste Freundin und ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu werden, ohne je zu hinterfragen, wer eigentlich die Personen sind, die dich so auf Trab halten, und warum du selbst so zuverlässig ins Rennen und Tun, Beschwichtigen und Liebsein verfällst, sobald bestimmte Knöpfchen gedrückt werden.
Vielleicht hast du es bei dir selbst schon beobachtet: Du bist die Erste, die einen Stimmungsumschwung wahrnimmt. Du bist diejenige, die sich schon Monate vor einem Anlass über die Details Gedanken macht. Du hast ein sehr gutes Bauchgefühl, wenn es um drohende Konflikte aller Art geht. Vieles kannst du abwenden, ins Gute führen, du hast den Joker im Ärmel, der das Spiel noch mal dreht. Aber: Es ist verdammt anstrengend. Und es nimmt kein Ende.
Wir möchten dich mit diesem Buch mitnehmen in verschiedene Situationen, in das Leben von Familien und Paaren, in Bürogemeinschaften und in den Kindergarten, und typische Situationen aufgreifen, in denen sich toxische Dynamiken zeigen. Nicht alles davon wird eins zu eins auf dich und dein Leben zutreffen, aber du wirst die Grundmuster erkennen und leicht auf dein persönliches Umfeld übertragen können. Denn bei allen gesellschaftlichen Unterschieden, kulturellen Verschiedenheiten und individuellen Lebensentwürfen gibt es eine große Gleichheit im Auftreten toxischer Muster.
Wirst du nach dem Lesen dieses Buchs alle alten Muster in deiner Herkunftsfamilie aufgelöst haben, eine perfekte Paarbeziehung führen, enorme Karrieresprünge machen und diese mit deinem rundum unterstützenden Freundeskreis feiern? Das können wir dir nicht versprechen, aber du wirst in der Lage sein, dich weitaus unabhängiger und freier zu fühlen, dein Stresspegel in bisher für dich sehr anstrengenden Situationen wird deutlich sinken und du wirst viele Ideen haben, wie du für dich gesunde Veränderungen in deinem sozialen Beziehungsgeflecht schaffen kannst.
Risiken und Nebenwirkungen: Bedenkliche Inhaltsstoffe von Beziehungen
Die Charakteristiken toxischer Beziehungsmuster lassen sich mit den subtilen, schädlichen und oft lang anhaltenden Auswirkungen von chemischen Substanzen vergleichen. Sowohl chemische Giftstoffe als auch toxische Beziehungsmuster schaden häufig zunächst unbemerkt, sind schwer zu erkennen und können langfristig negative Folgen haben. Wagen wir einen Blick in die Küche emotionaler Giftmischerei:
1. Das schleichende Gift
Giftstoff: Das Gift ist geruch- und geschmacklos, sodass es oft unbemerkt bleibt, bis die schädlichen Wirkungen einsetzen. Es kann schleichend Vergiftungen verursachen, die den Körper langfristig schädigen.
Wirkung: In toxischen Beziehungen können schädliche Verhaltensweisen unauffällig, subtil und langfristig zerstörerisch sein. Sie lassen die Betroffenen langsam an sich selbst zweifeln und ihre Eigenwahrnehmung infrage stellen. Die Vergiftung geschieht in kleinen Dosen über einen längeren Zeitraum. Deshalb ist sie schwer zu erkennen. Eine Diagnose erfolgt oftmals erst, wenn emotionale Schäden bereits eingetreten sind.
Anzeichen für eine Vergiftung:
»Du übertreibst doch wieder nur. Du machst immer aus jeder Kleinigkeit ein Drama.«
»Ich wollte dir nur helfen, aber du musst echt mal mehr Gas geben, sonst wirst du nie befördert.«
»Du weißt ja, ich sage das nur, weil ich mir Sorgen mache. Aber hast du nicht das Gefühl, dass du dich ein bisschen gehen lässt?«
2. Das Luft abschnürende Gift
Giftstoff: Das Gift ist farb- und geruchlos, verdrängt den Sauerstoff im Körper und führt zum Ersticken.
Wirkung: Stark kontrollierende und den Selbstwert des anderen untergrabende Verhaltensweisen wirken toxisch. Sie schnüren emotional die Luft ab und isolieren die Person gezielt von ihrem bisher engen Umfeld. Die Vergiftung geschieht schleichend, ohne dass der andere es sofort bemerkt.
Anzeichen für eine Vergiftung:
»Jetzt halt aber mal die Luft an. Dieses Genörgel von dir erträgt ja kein Mensch! Da brauchst du dich nicht wundern, dass ich keine Lust mehr habe, dir zuzuhören.«
»Was willst du immer mit deinen Freundinnen? Wir haben doch uns. Niemand wird dich jemals so lieben wie ich. Wir sind doch ein Paar.«
»Du musst dich wirklich komplett auf diese Arbeit konzentrieren. Ich erwarte, dass du auch nach Feierabend erreichbar bist.«
»Du hast dich echt verändert, seit du das Studium angefangen hast. Wir vermissen die alte Version von dir.«
3. Das sich anreichernde Gift
Giftstoff: Das Gift greift das Nervensystem an und verursacht lang anhaltende Schäden. Es ist besonders gefährlich, da es langsam und kumulativ wirkt.
Wirkung: Manipulative Verhaltensweisen, permanente Kritik und Abwertungen sowie psychische Gewalt wirken toxisch auf das Selbstbewusstsein und die emotionale Stabilität der betroffenen Person. Gravierende Folgeschäden werden erst nach längerer Zeit deutlich.
Anzeichen für eine Vergiftung:
»Was du dir immer einbildest! Das habe ich so nie gesagt. Hör doch einfach mal richtig zu.«
»Warum kannst du nichts richtig machen? Du bist einfach zu empfindlich.«
»Du hast das Projekt zwar abgeschlossen, aber es war nicht perfekt. Ich bin mir nicht sicher, ob du für mehr Verantwortung bereit bist.«
»Es ist echt schwer, mit dir zusammen zu sein. Du bist immer so negativ in letzter Zeit.«
4. Das schnell wirkende, unmittelbar zum Tod führende Gift
Giftstoff: Das Gift wirkt sofort und verhindert, dass Zellen Sauerstoff aufnehmen, was zum Tod führen kann. Es ist bereits in geringen Mengen extrem giftig.
Wirkung: Emotionaler Missbrauch entzieht der betroffenen Person den emotionalen Sauerstoff, den sie für ein gesundes Selbstbewusstsein braucht. Das Gift kann schnell und zerstörerisch wirken, insbesondere wenn der Missbrauch plötzlich oder intensiv auftritt. Drohungen sind Mittel, um Kontrolle auszuüben.
Anzeichen für eine Vergiftung:
»Wenn du das machst, bist du nicht mehr meine Tochter!«
»Wenn du das tust, verlasse ich dich. Allein wirst du nicht klarkommen.«
»Wenn du das nicht bis morgen erledigst, sehe ich keinen Grund, dich weiter zu beschäftigen.«
»Wenn du heute Abend nicht kommst, sind wir echt sauer auf dich. Überdenke mal deine Prioritäten!«
5. Das chronische Gift
Giftstoff: Das Gift sammelt sich im Körper an und führt zu chronischen Gesundheitsproblemen und Entwicklungsschwierigkeiten.
Wirkung: Ständiger emotionaler Druck und permanente Kritik beeinträchtigen das Selbstwertgefühl sowie die mentale Gesundheit langfristig und führen zu dauerhaften Schäden. Wiederholte abwertende Kommentare erzeugen emotionale Verletzungen, die sich tief ins Selbstbewusstsein der betroffenen Person eingraben. Gehäuftes Hervorheben von Fehlern ohne konstruktive Kritik führt zu einem dauerhaften Gefühl der Unfähigkeit.
Anzeichen für eine Vergiftung:
»Na ja, ist ja gerade noch mal gut gegangen. Das nächste Mal möchte ich aber, dass du dir ein bisschen mehr Mühe gibst.«
»Du bist wirklich ein Problem für mich. Meine Ex war da wesentlich lockerer.«
»Das war jetzt das dritte Mal, dass du einen Fehler gemacht hast. So etwas darf dir einfach nicht passieren.«
»Es ist immer dasselbe mit dir. Du ziehst uns alle runter. Kannst du nicht einfach mal locker bleiben?«
6. Das Umweltgift mit langer Halbwertzeit
Giftstoff: Das Gift verbleibt sehr lange in der Natur und baut sich nur langsam ab. Es kann durch ständigen Kontakt zu Wucherungen und Folgeerkrankungen führen.
Wirkung: Selbst nachdem es keinen direkten Kontakt mit dem Gift mehr gibt, wirkt es noch lange nach. Toxische Aussagen hallen im Kopf der betroffenen Person nach und beeinträchtigen sie langfristig. Einige toxische Beziehungsmuster bleiben auch nach dem Ende der Beziehung bestehen und haben Langzeitfolgen für das emotionale Wohlbefinden der betroffenen Person.
Anzeichen für eine Vergiftung:
»Niemand kennt dich so gut wie wir. Ohne deine Familie bist du nichts.«
»Niemand wird dir in einem anderen Unternehmen so viel Verantwortung geben wie wir. Sei froh, dass wir dich genommen haben.«
»Ehrlich gesagt, niemand in der Gruppe mag dich wirklich. Du bist nur immer mit dabei, weil wir dich schon so lange kennen.«
7. Das stark reizende Gift
Giftstoff: Das Gift ist stark reizend, es greift die Atemwege und Augen an.
Wirkung: Ständige Konflikte, Streitigkeiten und verbale Angriffe reizen die Psyche und lassen die betroffene Person auf emotionaler Ebene ersticken. Scharfe, abwertende Formulierungen attackieren gezielt Selbstwert und -vertrauen des anderen und verunsichern ihn.
Anzeichen für eine Vergiftung:
»Du bist so lächerlich! Du verstehst nie, worum es wirklich geht.«
»Du bist einfach nicht gut genug. Wenn du weiterhin so arbeitest, wirst du nie eine Beförderung bekommen.«
»Du bist so empfindlich! Es war doch nur ein Witz. Hör auf, alles so ernst zu nehmen.«
8. Das Gift, das zu Erblindung führt
Giftstoff: Bei Einnahme kann das Gift zu Erblindung und Tod führen. Es wird oft mit einem weniger gefährlichen Gift verwechselt.
Wirkung: Manipulationen werden subtil als Liebe, Fürsorge oder Ausdruck des Vertrauens verschleiert. Die Täuschung gelingt oft perfekt, sodass die betroffene Person kaum eine Chance hat, die schädliche Natur der Beziehung, den emotionalen Missbrauch, das Gift zu erkennen.
Anzeichen für eine Vergiftung:
»Ich tue das nur, weil ich dich liebe. Du weißt doch, dass ich es nur gut mit dir meine.«
»Ich gebe dir diese Verantwortung, weil ich an dich glaube, aber du darfst mich nicht enttäuschen.«
»Ich sage das nur, weil ich dich mag: Du solltest wirklich abnehmen. Es ist nicht gesund, so auszusehen.«
Weißglutsätze
Welche Sätze bringen dich zur Weißglut?
Und wie möchtest du idealerweise auf sie reagieren?
Die zehn Gebote toxischer Beziehungen
1)Eine hat immer Schuld – und das bist du.Es ist vollkommen egal, was passiert ist, du wirst immer diejenige sein, die das Problem verursacht hat. Der Kühlschrank war offen? Du hast ihn nicht richtig zugemacht. Die Kaffeemaschine funktioniert nicht? Hättest du halt den Stecker nicht rausgezogen! Klar, der andere hat mit allem nichts zu tun. Fehler? Nur dein Problem.
2)Einer hat immer Recht – und das ist der andere.Egal wie überzeugend du deinen Standpunkt darlegst, am Ende zählt nur der Blickwinkel des anderen. Dein Argument? Schwachsinn. Er/Sie hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und lässt dich das jeden Tag aufs Neue spüren. Diskussionen? Keine Sorge, die sind nur dazu da, dich daran zu erinnern, wie wenig du weißt.
3)Deine Gefühle sind unwichtig, nur die des anderen zählen.Deine Traurigkeit, Wut oder Frustration? Pfft, völlig irrelevant. Es geht immer nur darum, wie sich der andere fühlt. Wenn du eine anstrengende Woche hattest und das Bedürfnis hast, dich auszusprechen, wird das schnell als nervig abgetan, weil: Der andere ist der wahre Held der Geschichte und du bist schon wieder »emotional«. Reiß dich doch mal zusammen!
4)Beweise, dass du es wert bist, geliebt zu werden – auch wenn du dich dafür komplett verbiegen musst.Selbstwert an sich gibt es nicht. Du bist das wert, was andere an dir wertvoll finden. Du kannst es dir verdienen, aber nur, wenn du dich sehr anstrengst. Und denke immer daran: Wertvorstellungen können sich schnell ändern. Bleib dran und passe dich an die Wünsche des anderen an! Viel Glück!
5)Es gibt nur einen Weg, Dinge zu tun – und das ist der des anderen.Und es spielt keine Rolle, wie du es versuchst – es wird immer der Weg des anderen sein. Du willst den Müll rausbringen? Falsch. Du hättest es besser organisieren sollen. Du hast das Abendessen gekocht? Dann hätte es doch lieber noch schärfer gewürzt werden sollen. Kurz gesagt: Dein Tun ist nur dann richtig, wenn es mit den Vorstellungen des anderen übereinstimmt.
6)Kritik an dir ist berechtigt, Kritik am anderen ist respektlos.Kritik an dir? Klar, immer willkommen. Du kannst sie ruhig auch mehrmals täglich bekommen, gern auch in Form von persönlichen Angriffen, die sich als »Konstruktivismus« tarnen. Aber wehe, du traust dich, auch nur einen Funken Kritik an dem anderen zu üben. Das wird sofort als Angriff auf dessen gesamte Existenz gewertet. Kritik? Nur für dich, meine Liebe!
7)Deine Wünsche und Bedürfnisse sind nebensächlich, der andere steht an erster Stelle.Du wolltest heute mal ein bisschen Zeit für dich? Wie egoistisch! Der andere hat Bedürfnisse, und die zählen natürlich mehr als deine. Ob du dich nach Ruhe sehnst oder deine Wünsche nicht erfüllt werden – kein Problem! Die Welt dreht sich sowieso nur um den anderen. Deine Bedürfnisse werden schon von allein erfüllt, wenn du einfach weiter in den Hintergrund trittst.
8)Du bist verantwortlich für das Glück des anderen, deins ist Nebensache.Das Glück deines Partners? Ja, das ist natürlich deine Verantwortung. Sollte der andere mal nicht gut drauf sein, liegt es natürlich an dir, das zu ändern. Dein eigenes Wohlbefinden? Nun, das ist doch nebensächlich – du bist ja schließlich keine Diva. Solange der andere strahlt, wird schon alles gut. Dass du dabei völlig leer ausgehst, interessiert keinen.
9)Du bist nie genug, aber immer zu viel.Egal, wie sehr du dich bemühst – du bist entweder nicht genug oder einfach viel zu viel. Du bringst das falsche Thema auf, bist zu emotional, zu sachlich, zu »nicht interessiert«. Am Ende des Tages wirst du immer entweder als »zu übertrieben« oder als »zu wenig« abgestempelt, je nachdem, wie es dem anderen gerade passt.
10)Du darfst dich nie beschweren – sonst bist du undankbar und schwierig.Hast du dich mal beschwert, weil du ständig die schlechteren Karten ziehst? Nein, das geht gar nicht! Du solltest einfach still schweigen und die Welt so nehmen, wie sie ist. Wer sich beschwert, ist »kompliziert«, »zu viel« oder »ungerecht«. Klar, du hast auch mal das Recht, deinen Frust zu äußern, aber das wird natürlich nicht gehört. Es ist doch viel bequemer, einfach zu »funktionieren«, auch wenn du innerlich zerbrichst.
Teil 1
Vergangenheit – Wo alles beginnt
Vergiftete Wurzeln – Warum du immer wieder in toxische Situationen gerätst
Es könnte alles so schön sein, wenn nur die Realität nicht wäre. Wie kommt es überhaupt dazu, dass wir uns vor Festen fürchten, auf die wir uns eigentlich freuen sollten? Dass wir lieber gar nicht erst zu Veranstaltungen gehen wollen, weil wir sowieso schon wissen, dass es uns danach nicht gut geht? Und warum lässt sich das Verhältnis mit Schwester, Vater oder Chefin einfach nicht entheddern, obwohl inhaltlich doch eigentlich alles klar ist?
Idealerweise kommen wir aus einer Familie, in der wir liebevoll und sicher groß werden konnten, und haben heute einen Menschen an unserer Seite, den wir lieben und von dem wir geliebt werden, oder fühlen uns auch allein mit uns selbst wohl und geborgen in unserem Leben. Idealerweise leben wir in einer Gesellschaft, die uns Struktur gibt und Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten und auf unsere Weise dazu beizutragen, dass diese Gesellschaft lebendig wächst. Idealerweise haben wir einen Beruf, der unseren Interessen und Fertigkeiten entspricht, in dem wir angemessen gut bezahlt werden und der uns gleichzeitig noch genug Raum für unser Privatleben lässt. Idealerweise arbeiten wir mit Menschen zusammen, die wir respektieren und die uns respektieren und mit denen wir uns gemeinsam am Erreichten freuen können.
In der Realität gibt es wenige ideale Familien, Partnerschaften, Arbeitsverhältnisse, und auch die Gesellschaft ist leider nicht perfekt. Es ist auch völlig normal, dass es mal Streit gibt, man sich in einer Situation ausgeschlossen fühlt, mehr gibt als der andere oder sich uneins ist über die Planung eines Fests. Allerdings bieten genau diese Feste wie Weihnachten oder fest verankerte gesellschaftliche Anlässe wie der Valentinstag gute Vergleichsmöglichkeiten zwischen idealer Wunschvorstellung, normalen Abweichungen davon oder desaströsen Verläufen. Die eigentlich festlichen oder alltäglichen Anlässe werden zum Ausgangs- und Höhepunkt von Streit, Selbstvorwürfen oder Zerwürfnissen, wenn es im Beziehungsmuster von Grund auf nicht stimmt.
Ohne jetzt Freuds alte Couch in dieses Buch zu zerren: Toxische Verstrickungen und (selbst-)schädigende Beziehungsdynamiken haben ihr Grundmuster normalerweise in dem, was wir in unserer Kindheit über Beziehungen und Bezugspersonen gelernt haben. Dieses Lernen fand nicht bewusst statt, sondern über das Erleben einer Vielzahl von Situationen, aus denen wir unsere Schlüsse gezogen haben. Selbst wenn die allermeisten Eltern für ihre Kinder das Beste wollen, sind sie selbst auch nicht frei von Prägungen, die ihr eigenes Leben bestimmt haben, und von Situationen, in denen sie gestresst, ängstlich, wütend oder erschöpft waren oder sich in einer Paardynamik befanden, die nicht gerade das Beste aus ihnen hervorholte. Als Kind können wir das allerdings nicht einordnen und verstehen nicht, warum Mama jetzt gerade fürchterlich weint oder herumschreit, warum Papa nach Telefonaten mit Opa so schlechte Laune hat oder wie man nach einem langen Arbeitstag so müde sein kann, dass man die Bedürfnisse des eigenen Kindes nach Nähe und Interaktion immer wieder hintanstellt.
Als Kind können wir das Verhalten unserer Bezugspersonen nur auf uns selbst beziehen und interpretieren es beispielsweise in diesem Sinn: »An mir ist gerade was verkehrt, ich bin zu laut, zu wach, zu ungeschickt und deshalb gibt es jetzt Ärger, Mama weint und ich bekomme nicht, was ich brauche.« Auch wenn klar ist, dass die Erwachsenen untereinander Streit haben und ich als Kind nicht direkt in das Streitgeschehen involviert bin, ist es für mich aus Kinderperspektive nicht zu verstehen, warum sie mich verlassen, wenn beispielsweise einer der Elternteile aus der gemeinsamen Wohnung auszieht. Hat die Person mich nicht mehr lieb? Weiß sie nicht, dass ich sie hier bei mir brauche? Bin ich zu wenig Grund, dass Papa bleibt? Bin ich sogar schuld, dass er geht?
Auch bei einem reflektierten Umgang mit Konflikten und Bedürfnissen bleiben solche Unsicherheiten nicht aus und werden in der Situation auch nicht aufgelöst, weil die Erwachsenen stark mit den eigenen Konflikten beschäftigt sind, was weder beabsichtigt noch böswillig geschieht, aber Auswirkungen auf uns als betroffenes Kind hat (# Bindungstheorie).
# Bindungstheorie
Die Bindungstheorie erklärt, wie die emotionale Verbindung zwischen einem Kind und seinen Bezugspersonen – meist den Eltern – seine späteren Beziehungen beeinflusst. Diese ersten Bindungserfahrungen formen, wie wir als Erwachsene mit Nähe, Vertrauen und Abhängigkeit umgehen. Menschen, die in ihrer Kindheit eine sichere Bindung erlebt haben, indem ihre Eltern auf sie als Kind feinfühlig reagiert haben, entwickeln oft gesündere Beziehungen: Sie vertrauen darauf, dass ihre Bindungsperson für sie verfügbar ist. Unsicher gebundene Menschen haben als Kind die Erfahrung gemacht, auf ihre Bindungspersonen nicht immer vertrauen zu können. Dies kann zu Problemen in späteren Beziehungen führen, weil diese Menschen damit rechnen, von ihren Bindungspersonen enttäuscht zu werden.
Die Bindungstheorie wurde unter anderem vom britischen Kinderarzt und -psychiater John Bowlby seit den 1940er Jahren entwickelt. Er stellte fest, dass unsere frühesten Bindungen als »Blaupause« für unsere Beziehungen im Erwachsenenalter dienen (Bowlby, 1969/2006, 2024).
Zu verstehen, welche Art von Bindung wir erlebt haben, kann helfen, toxische Beziehungsmuster zu durchbrechen und gesündere Verbindungen aufzubauen.
Über längere Zeit entsteht in unserem kindlichen Verständnis ein Bild von Beziehungen zu anderen und uns selbst, das dann auch im Erwachsenenleben so lange seine Gültigkeit behält (# Beziehungsmuster), bis wir uns bewusst machen, wie dieses Bild eigentlich mal entstanden ist. Dann lässt es sich auch verändern.
# Beziehungsmuster
Beziehungsmuster sind Verhaltensweisen und Reaktionen, die in unseren Beziehungen immer wieder auftauchen. Sie bestimmen, wie wir mit unserem Partner, unserer Familie oder Freunden umgehen.
Diese Muster entstehen oft unbewusst und wiederholen sich, ohne dass wir es merken – vor allem, wenn sie in früheren Beziehungen gelernt wurden.
Der Psychiater John Bowlby, der die Bindungstheorie entwickelte, erklärte, dass unsere frühen Bindungserfahrungen (zum Beispiel mit den Eltern) prägen, wie wir später Beziehungen erleben. Wenn wir unsere Beziehungsmuster verstehen, können wir besser erkennen, was gut für uns ist und was uns in ungesunde oder toxische Beziehungen führt.
Der finnische Psychiater Ben Furman hat ein Buch darüber geschrieben: »Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben« (Furman, 2019). Wir können und müssen unsere Vergangenheit nicht ändern, aber als Erwachsene können wir unserem Fundament mehr Stabilität geben, Leerstellen auffüllen und alte Ungleichgewichte ausbalancieren.
Falls es in deiner Familie massive Gewalt gab und gezielte Aggressionen und Böswilligkeiten gegen dich als Kind (# Dysfunktionale Familie), ist es trotzdem möglich, für dich einen liebevollen und sicheren Umgang mit dir selbst zu finden. Du kannst aus diesem Buch sicher Nutzen ziehen, wir empfehlen dir in diesem Fall aber, dir zusätzlich persönliche und professionelle Unterstützung zu suchen.
# Dysfunktionale Familien
Eine dysfunktionale Familie ist eine Familie, in der die Beziehungen zwischen den Mitgliedern nicht gesund oder unterstützend sind. Oft herrschen dort Konflikte, Missverständnisse, emotionale Vernachlässigung oder Missbrauch vor. Solche Familienmuster können dazu führen, dass Kinder Schwierigkeiten haben, gesunde Beziehungen zu entwickeln, weil sie toxische Verhaltensweisen als normal wahrnehmen.
Der Begriff wurde durch die Arbeit von Murray Bowen (1978), einem Pionier der Familientherapie, geprägt. Bowen untersuchte, wie Probleme in Familien von Generation zu Generation weitergegeben werden können.
Das System einer dysfunktionalen Familie zu verstehen, hilft, diese Muster zu erkennen und zu durchbrechen, um gesündere Beziehungen zu schaffen.
Am Anfang dieses Kapitels haben wir die frühen Prägungen durch unsere Herkunftsfamilie betrachtet und wie wichtig sie für unser späteres Beziehungsverständnis sind. Wir möchten an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass gerade bei den ganz frühen Bezugspersonen wie beispielsweise unseren Eltern der hierarchische Unterschied normalerweise stark verinnerlicht ist. Natürlich sind wir längst erwachsen und in der Lage, unseren Eltern auch erwachsen zu begegnen und uns gegen Erwartungen zu stellen, aber es ist völlig normal, wenn sich dabei ein kindliches Gefühl von Unsicherheit und Angst meldet, weil das Urteil unserer Eltern lange Zeit entscheidend war für unser Wohlbefinden.
Der Wunsch, unseren Eltern »zu gefallen«, hat seinen Ursprung darin, dass wir mit ihnen verbunden sein müssen, um sicher zu sein. Wir erfahren das vom Tag unserer Geburt an. Die Personen, die unser Überleben sichern, sind so wichtig für uns, dass wir es uns nicht leisten können, sie zu verlieren oder von ihnen abgewiesen zu werden. Im Rahmen der normalen Entwicklung erweitern wir während des Heranwachsens unseren Autonomierahmen, haben Trotzanfälle und treffen eigene Entscheidungen, das ändert jedoch nichts an unserem Bewusstsein, abhängig von unseren Eltern zu sein. Selbst die brüllendste Dreijährige braucht abends wieder jemanden, der ihr ein Abendbrot macht und sie zu Bett bringt (# Bindungs- und Autonomiesysteme).
# Bindungs- und Autonomiesysteme
In unseren Beziehungen wirken zwei wichtige Kräfte: das Bindungssystem und das Autonomiesystem. Diese beiden Systeme bestimmen, wie wir Nähe und Unabhängigkeit in Beziehungen erleben.
Das Bindungssystem sorgt dafür, dass wir uns nach emotionaler Nähe und Sicherheit sehnen. Es entwickelt sich in der frühen Kindheit und beeinflusst, wie wir Vertrauen aufbauen und uns mit anderen Menschen verbinden. Wenn unser Bindungssystem aktiviert ist, suchen wir Trost, Unterstützung und Zuneigung von nahestehenden Personen.
Das Autonomiesystem dagegen treibt uns dazu, unabhängig zu sein, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen und unsere Freiheit zu wahren. Es ist die Kraft, die uns dazu bringt, eigenständig zu handeln und unser Leben nach unseren Vorstellungen zu gestalten.
Beide Systeme arbeiten zusammen, um ein Gleichgewicht in unseren Beziehungen zu schaffen. Wenn jedoch eines dieser Systeme zu stark oder zu schwach ist, kann es zu Problemen kommen. Zum Beispiel kann eine Person in einer toxischen Beziehung das Gefühl haben, zwischen dem Wunsch nach Nähe (Bindung) und dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit (Autonomie) hin- und hergerissen zu sein.
Es gibt viele Bindungstheorien (Trost, 2018), aber in einer Sache sind sich wohl alle einig: Wie weit Eltern ihre Kinder lieben, ist unterschiedlich ausgeprägt, aber alle Kinder lieben ihre Eltern. Die kindliche Loyalität ist so stark ausgeprägt, dass ein Kind auch unter katastrophalen Bedingungen lange versuchen wird, seine Eltern liebevoll an sich zu binden. Kinder kooperieren, selbst wenn Eltern ihre Sorgepflicht vernachlässigen oder dem eigenen Kind Schaden zufügen. Kinder haben keine Alternative, die Beziehungen, in denen sie groß werden, sind für sie ein Normalzustand, den sie nicht infrage stellen können.
Die Loyalität, das Bedürfnis nach Verbundenheit und die fehlenden Fähigkeiten, sich selbst zu versorgen, bewirken, dass Kinder elterliche Reaktionen auf das eigene Verhalten beziehen und daraus persönliche Überzeugungen bilden (Boszormenyi-Nagy u. Spark, 2001). Umso mehr, wenn ihnen von den Eltern verbal oder nonverbal Schuld zugewiesen wird und nicht nur ein bestimmtes Verhalten, sondern persönliche Wesenszüge oder die gesamte Existenz als schuldhaft behandelt werden. Im Kindesalter zeigt sich das vielleicht in Äußerungen wie »Wegen dir ist Mama immer so nervös/traurig/müde«, später werden vielleicht Vorwürfe wie »Du bist schuld, dass ich nicht fertig studiert habe« oder »Ich bin nur deinetwegen bei Papa geblieben« gemacht und das Kind mit einem schweren Sack an Schuldgefühlen beladen. Selbst wenn man als erwachsenes Kind mit zunehmender Lebenserfahrung kognitiv weiß, dass diese Schuldgefühle nicht berechtigt sind, ist es schwer, sich emotional davon zu befreien (Boszormenyi-Nagy, 2014). Man bezeichnet das als dysfunktionale Loyalität gegenüber den eigenen Eltern.
Ein dysfunktionaler Loyalitätskonflikt entsteht, wenn eine Person – insbesondere ein Kind – in einem familiären oder sozialen System gefangen ist, in dem die Loyalität zu einer Bezugsperson oder Gruppe mit psychischen oder emotionalen Kosten verbunden ist (# Dysfunktionaler Loyalitätskonflikt). Das Kind fühlt sich gezwungen, sich einer Seite zuzuwenden, um Bindung, Anerkennung oder Sicherheit zu erhalten, oft auf Kosten der eigenen Identität, Autonomie oder psychischen Gesundheit.
# Dysfunktionaler Loyalitätskonflikt
Wichtige Merkmale:
Einseitige oder erzwungene Loyalität: Ein Elternteil oder eine Bezugsperson verlangt implizit oder explizit die ausschließliche Unterstützung des Kindes.Parentifizierung: Das Kind übernimmt Verantwortung oder emotionale Aufgaben, die eigentlich Erwachsenen zustehen.Verdeckte oder unsichtbare Erwartungen: Die Loyalität wird oft nicht bewusst kommuniziert, sondern durch Schuldgefühle oder emotionale Erpressung erzeugt.Selbstwertprobleme: Das Kind entwickelt oft Unsicherheiten, da es sich selbst nicht mehr als eigenständige Person wahrnimmt.Sobald wir mit unseren Eltern in Kontakt sind, reaktivieren sich zunächst mal all diese bisher beschriebenen Mechanismen. Das ist kein Problem, solange es sich um gesunde Familienstrukturen handelt, die sich zu gleichwürdigen Erwachsenenbeziehungen weiterentwickelt haben, in denen jeder in seiner Unterschiedlichkeit respektiert wird. Doch häufig ist das nicht der Fall, die Beziehungen bleiben unreif, Konflikte wurden nicht konstruktiv ausgetragen und Dysbalancen nicht ausgeglichen. Es ist nicht selten, dass erwachsene Kinder mit solchen familiären Beziehungserfahrungen den Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie für sich selbst »organisiert« haben und vielleicht auch wenig persönlicher Kontakt und Austausch besteht. Das schützt allerdings nicht davor, bei den vereinzelten konkreten Treffen oder Telefonaten oder Chatnachrichten heillos und schmerzhaft ins alte Rollengefühl zurückzufallen.
Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie negativ über ihre Herkunftsfamilie sprechen oder denken. Möglicherweise hast du auch den Gedanken, dass es bei anderen viel schlimmer war oder dass du dankbar sein kannst, dass aus dir etwas geworden ist. Oder du fühlst dich hin- und hergerissen, weil ja auch »nicht alles schlecht war« bei dir zu Hause und du niemandem zu Unrecht das Etikett »toxisch« umhängen willst.
Wir möchten dir hier im Rahmen der psychologischen Hintergründe einen Gedanken anbieten: Der Joghurt meint es auch nicht böse, wenn er schimmelt, trotzdem verdirbst du dir mit ihm den Magen. Sprich: Es geht in diesem Buch nicht um Schuld. Es geht darum, zu verstehen, welche Mechanismen für dich schädlich und auf bestimmte Weise giftig waren oder noch sind und wie du künftig schneller erkennst, welchen Joghurt du noch essen kannst und welchen du besser meidest.
Was wir unter toxischen Beziehungen verstehen
Als toxische Beziehungen bezeichnen wir Beziehungen, in denen einer der Partner oder auch beide durch die Beziehung Schaden nehmen. Unterschiedlich ist, auf welche Weise das geschieht. Typische Symptome einer toxischen Beziehung sind Grenzüberschreitungen, Abwertungen, Beschimpfungen und Streitigkeiten, in denen einer von beiden »verliert«, während der andere »gewinnt«. Einer der beiden Beziehungspartner hat die Oberhand und nutzt seine Position, um dem Unterlegenen das auch immer wieder deutlich zu machen. Das kann auch auf paradoxe Weise geschehen, indem der mächtigere Beziehungspartner dem anderen die Verantwortung für sein Wohlbefinden zuschreibt und mit Schuldzuweisungen und Liebesentzug reagiert, sobald sich der oder die Unterlegene nicht wie gewünscht verhält. Die Konsequenzen einer solchen Beziehung sind weitreichend. Je länger sie Bestand hat, desto selbstverständlicher wird für die unterlegene Person ihre Anpassung an die Bedürfnisse der anderen: Man müsse nur noch besser auf das Gegenüber eingehen, noch passender werden, dann würde die Beziehung sich entspannen und das Glück käme in Reichweite. So etabliert sich ein toxischer Kreislauf aus enttäuschten Erwartungen der einen Person, Schuldzuweisung und -gefühl der anderen sowie deren verstärkten Bemühungen, alles richtig zu machen, woraufhin sie kleines Lob einheimsen kann, bevor sie bei nächster Gelegenheit wieder Erwartungen enttäuscht, Schuldzuweisungen empfängt etc. Dieser Kreislauf ist überaus stabil und wird mit jeder Umdrehung stabiler (# Beziehungsdynamik).
# Beziehungsdynamik
Beziehungsdynamik beschreibt, wie Menschen in einer Beziehung miteinander umgehen und aufeinander reagieren. Diese Dynamik kann positiv sein, wenn beide Partner sich gegenseitig unterstützen, oder negativ, wenn Konflikte, Machtspiele oder Abhängigkeiten im Vordergrund stehen.
Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, streiten und unsere Gefühle ausdrücken, beeinflusst diese Dynamik.
Der Psychologe Salvador Minuchin, ein führender Vertreter der Familientherapie, untersuchte, wie diese Muster in Familien und Paaren entstehen. Seine Arbeit zeigt, dass man durch das Verstehen der Beziehungsdynamik lernen kann, gesunde und respektvolle Beziehungen zu führen (Minuchin, 1997).
Tatsächlich fühlen sich viele Menschen in toxischen Beziehungen so wohl wie in einem gut eingetragenen Pullover, an den man sich einfach gewöhnt hat. Und in der Regel beginnen toxische Beziehungen sehr freundlich und wertschätzend, oft sogar über die Maßen liebevoll. Der später unterlegene Beziehungspart wird mit Aufmerksamkeit überschüttet sowie mit Lob und Wertschätzung angefüttert. Wenn dann die ersten Herabsetzungen beginnen, haben sie durch die vorhergehende Bindung an den bislang so liebevollen Partner oder die so liebevolle Partnerin eine besondere Wirksamkeit. Diese Person meint es doch gut mit uns. Uns zuliebe kritisiert sie uns, damit wir die Chance haben, uns zu ändern. Es ist doch besser, dass uns jemand auf unsere Fehler aufmerksam macht, der uns liebt, als jemand, der außen steht. Auch zu unserem Schutz werden wir kritisiert, um uns vor den Konsequenzen unseres vermeintlichen Fehlverhaltens zu bewahren. Die Person kennt uns so gut. Und sie sagt, dass sie uns liebt. Wenn diese Person also jetzt etwas an uns bemängelt, tun wir gut daran, den Fehler bei uns zu suchen und zu beheben, um wieder in die liebevolle Behandlung zurückzukommen, oder? Und irgendwie fühlt es sich auch sehr vertraut an und erinnert uns möglicherweise an ein Zuhause, in dem es in Kindheit und Jugend ähnlich ablief.
Ganz klassisch definieren sich toxische Beziehungen folgendermaßen (Toxische Beziehung):
Toxische Beziehung
Substantiv; Bezeichnung für eine Beziehung zwischen zwei oder mehr Personen, die durch schädliche und negative Dynamiken geprägt ist. Es gibt ein Ungleichgewicht bei Macht, Kontrolle oder Respekt. Sie zeichnet sich durch Merkmale wie Manipulation, Missbrauch, Dominanz, mangelnde Kommunikation, Respektlosigkeit, Eifersucht und Unsicherheit aus.
Die Beteiligten können sich gegenseitig emotional, mental oder physisch schaden. Toxische Beziehungen können stark belastend sein und die Lebensqualität der Beteiligten erheblich beeinträchtigen.
Körperliche und seelische Beschwerden treten auf und machen die Beteiligten in irgendeiner Form krank.