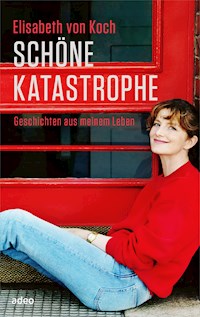
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: adeo
- Sprache: Deutsch
Wer bei "von" im Nachnamen an Debütantinnenball und Hausdiener im Frack denkt, der liegt bei Elisabeth von Koch ziemlich falsch. Ihre Großeltern lebten zwar tatsächlich in einem Schloss, doch ihre Kindheit in einer merkwürdigen Schere zwischen Alt-68er-Hippie- und Bürgertum war vor allem geprägt von ihrer wilden Mutter und deren Eskapaden- aber auch von der Sehnsucht nach Normalität und einem echten Halt im Leben. Die kleine Lissi hat ein sonniges Gemüt, das sie sich auch in dem ganzen Wahnsinn stets bewahrt. Da ihre Eltern Atheisten sind, sucht sie sich ihren eigenen Draht zum lieben Gott und beschließt: Ganz egal, was das Leben mir an Bockmist gibt, ich mache Gold daraus. Und mit dieser Maxime und teilweise saukomisch nimmt sie ihre Leser mit auf eine Reise durch ihr Leben als Hippie-Kind, Schauspielerin, Mutter und Nerd.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Für Sascha und die Buben
INHALT
Trau Dich
Intro
1. Das Oblaten-Gate
2. Gut verlieren, schlecht gewinnen
3. Rohrbach
4. Das große Nichts
4. Nicht nichts
5. Damenwahl
6. Und davon kann man leben?
7. Das Peng
8. Ihr wart doch so ein Traumpaar
9. Moves like Jagger
10. Einmal Rockstar und zurück
11. Heini
12. Paris
Outro: Dezember 2020
TRAU DICH
Trau dich! Trau dich!
Auch wenn es danebengeht
Trau dich! Trau dich!
Es ist nie zu spät
Wer’s nicht selber ausprobiert
Der wird leichter angeschmiert
Trau dich! Trau dich!
Dann hast du was kapiert
Trau dich! Trau dich!
Auch wenn du erst fünfe bist
Trau dich! Trau dich!
Auch Große machen Mist
Glaub nicht alles was du hörst
Wenn du sie mit Fragen störst
Trau dich! Trau dich!
Bis du was erfährst
Trau dich! Trau dich!
Andern geht’s genauso schlecht
Trau dich! Trau dich!
Kämpft um euer Recht
Tretet füreinander ein
Dann könnt ihr bald viele sein
Trau dich! Trau dich!
Du bist nicht allein
Gripsparade, 1973
INTRO
„Na, kleines Fräulein, darfst du denn schon alleine reisen?“
Die Stimme einer wasserstoffblonden Stewardess reißt mich aus meinem Tagtraum. Mein Blick wandert langsam von ihren Pumps, über deren Ränder ein wenig beiges Stützstrumpfhosenfleisch quillt, hoch zu ihrem bröckelig überschminkten Gesicht. Ich finde sie sofort unsympathisch, und ein Fräulein bin ich auch nicht, ich bin eine allein reisende Frau.
Ich geb ihr Eisauge: „Klar darf ich, ich bin fast sechs“, knalle ich ihr vor den Latz, und sie trollt sich eingeschüchtert.
Ich widme mich wieder dem Anblick der Flugzeuge draußen, die von der Abendsonne mariniert werden. Meine Finger umfassen fest den kleinen Plastikbeutel, den mir die Frau vom Check-in umgehängt hat. Er enthält meinen Kinderausweis, mein Flugticket, einen Malblock mit drei Stiften, eine Nylonschnur und bunte Holzperlen. „Mit denen kannst du eine Kette machen!“, hatte sie mir erklärt und versucht, mich vom Anblick meiner Mutter abzulenken, die gerade winkend und Kusshände werfend durch die Schiebetür aus Glas verschwand.
Mein erster Flug als unbegleitetes Kind steht mir bevor, und ich habe ordentlich Muffensausen.
Ich schlucke ein paar Tränen runter, in der Nase noch einen Hauch Mitsouko, Monikas schweres, süßes Parfum, das sie sich jeden Morgen hinter ihre Ohren tupft, einen Tropfen rechts, einen links, und dann nochmal einen rechts. Es sind die Siebziger, und Eltern heißen nicht Mama und Papa, sie stellen sich mit Vornamen bei ihren Kindern vor.
Die Fluggäste werden auf Deutsch und Italienisch gebeten, sich zum Ausgang zu begeben. In meinen Abschiedsschmerz mischt sich die Vorfreude auf meine Großeltern, und ich gehe, eskortiert von Blondie, durch die Absperrung. Ich mache meinen Rücken so gerade, wie ich kann, damit ich möglichst groß und elegant wirke. Eleganz ist heute Pflicht, denn es geht nach Rom, in die Stadt der schönen Menschen.
Meine Augen saufen die lässige Schönheit der italienischen Passagiere, die laut diskutieren, mit kehligen AAAs und gedehnten EEEs und OOOs, Musik in meinen Ohren. Sie gestikulieren wild und formen Lotusblüten mit ihren Fingern. Die Männer tragen khakifarbene Leinenanzüge, schwarze Sonnenbrillen und Collegeschuhe ohne Socken, die Frauen zeigen in knappen Miniröcken und kniehohen Wildlederstiefeln, was sie haben. Beim Reden klimpern ihre goldenen Armreifen. Ah, dieser Glamour! Nie könnte man sie mit den deutschen Touristen verwechseln, die in praktischer Kleidung brav und ordentlich in der Warteschlange stehen.
Im Flugzeug habe ich eine ganze Reihe für mich allein. Das ist gut, denn so werde ich mich nicht blamieren, falls ich doch noch ein bisschen weinen muss.
Endlich geht es los, immer schneller rasen wir über die Startbahn, und dann heben wir mit einem WUPP ab. Ich genieße das Bauchsausen und sehe unter mir die perfekten grünen, gelben und braunen Vierecke kleiner werden. Rumpelnd stoßen wir durch die Wolken, dann erlöschen die Nichtraucherzeichen, und Feuerzeuge klicken freudig auf und zu.
„Ladies and Gentlemen, willkommen an Bord.“
Ich lehne meine Stirn an das kühle ovale Plastikfenster, blicke ins Blaue, stecke mir Zeige- und Mittelfinger in den Mund (Daumenlutschen kann ja jeder) und sauge mich in eine wohlige Trance. Eines Tages werde ich ein Filmstar sein und in Klapperschuhen mit hohen Absätzen die Welt bereisen.
Und so kam es.
Mehr oder weniger.
1. DAS OBLATEN-GATE
„Lieber Gott, ich danke dir für alles und bitte dich, lass uns alle sehr lange leben. Verhindere den dritten Weltkrieg und den Weltuntergang. Mach, dass Lothar und Monika heiraten und für immer zusammenbleiben, lass sie nicht krank werden und nicht so viel streiten, und pass auf meine Katzen und auf meine Omi auf. Amen.“
Das ist das Abendgebet, das ich mir mit sieben Jahren ausgedacht habe.
Ich wuchs in einem Atheistenhaushalt auf, meine Mutter und mein Stiefvater Lothar glaubten an Nichts. Das bedeutet nicht, dass sie an nichts glaubten. Nein, es war noch schlimmer: sie glaubten. An das Nichts. Ich musste die Sache mit Gott selbst in die Hand nehmen.
Meine Mutter hatte meinen Vater bei Tchibo auf der Leopoldstraße, der Hauptschlagader von München-Schwabing, kennengelernt. Sie gingen beide noch zur Schule, und sie wussten, mit vereinten Kräften würden sie eine Katastrophe fabrizieren. Und genau das wollten sie auch. Die Siebzigerjahre standen vor der Tür, und Monika und Hans wollten die Rebellion, das war ihre größte Gemeinsamkeit.
Es war ihre einzige Gemeinsamkeit.
Sie kannten sich erst ein paar Monate, da wurde meine Mutter schwanger. Sie machte mit mir im Bauch ihr Abitur. Darauf war sie stolz, und sie wurde nicht müde, mir zu versichern, dass ich ein Wunschkind war, Gott sei Dank. Das macht viel aus, es macht alles aus. Ich will mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlen muss zu wissen: Man war nicht gewollt.
Monika und Hans vögelten und soffen sich durch die Münchner Nächte, und nur elf Monate, nachdem ich das Licht der Welt erblickt hatte, kam mein Bruder Mendel hinterher.
Popstars nennen ihre Kinder gern nach den Orten ihrer Empfängnis, wie Brooklyn Beckham zum Beispiel, und wäre das damals schon Mode gewesen, wir würden „Suff“ und „Vollrausch“ heißen. Im Ernst, unsere Eltern waren niemals nüchtern. Und sie hatten sich auch nicht viel zu sagen. Aber sie lachten sich zusammen oft kaputt, denn sie waren beide mit komischem Talent gesegnet (zweite Gemeinsamkeit), das sie uns Kindern vererbt haben müssen, denn ich habe mit meinem Bruder oft geweint vor Lachen. Uns laufen heute noch regelmäßig vor Lachen die Tränen übers Gesicht. Humor ist ein Lifesaver, und wir alle vier hatten immer die Fähigkeit, in jeder Katastrophe die Komik zu finden. Auch meinen beiden Halbgeschwistern wurde der krächzende schwarze Rabe Galgenhumor in die Wiege gelegt, und das ist ein riesiges Geschenk.
Monika und Hans hatten keinen Halt in der Welt, Monikas Eltern waren kurz vor meiner Geburt nach Rom ausgewandert, weil mein Opi dort eine Stelle beim Geheimdienst hatte. Hier hoffe ich immer, dass keiner nachfragt: „Hä, welcher Geheimdienst, der deutsche oder der italienische?“ Oder: „Moment, deine Omi, war die nicht Österreicherin? Und dein Opi war doch Yugo, also was?“
Ich weiß es selbst nicht genau, und ich habe das auch nie recherchiert, weil die ganze Wahrheit einfach nicht konkurrieren konnte mit der halben: Mein Opi war Spion, Punkt. Hans hatte einen zwei Kilometer langen Nachnamen und war mit drei Geschwistern in einem kleinen Schloss nahe Ingolstadt aufgewachsen. Er wurde mit zehn Jahren traditionsgemäß nach Ettal ins Klosterinternat verfrachtet, wo er vor Heimweh fast verging und mit achtundzwanzig starb seine Lieblingsschwester an einem bösartigen Muttermal am Rücken. Er war viel zu allein für sein Alter. Das war die Ausgangslage, der Grundstock, auf dem Monika und Hans ihre kleine Familie aufbauten. Konnte nur schiefgehen, ging auch schief, aber schneller, als sie wahrscheinlich dachten.
In Rohrbach, so heißt das Schloss, hatte meine Mutter vom ersten Tag an keine Chance, und die schöpfte sie genüsslich aus. Sie war meinen Großeltern viel zu wild, und auch Hans brauchte was ganz anderes, aber das wusste er da noch nicht. Als ich diesen Sommer Olivia Colman in „The Crown“ gesehen habe, fiel mir wie Schuppen von den Augen, dass meine Rohrbach-Oma eine Eins-zu-eins-Kopie von Queen Elizabeth war. Das muss ein Running Gag gewesen sein bei den von Kochs.
Wenn ich mir vorstelle, wie Hans meine zwanzigjährige, schwangere, kettenrauchende, fluchende Mutter das erste Mal nach Rohrbach brachte und sie nichts Besseres zu tun hatte, als den Shit aus meiner geschockten Queen-Kopie von zukünftiger Oma rauszuprovozieren, muss ich schon ein bisschen grinsen. Anscheinend saß sie im Salon und erzählte – laut, damit es auch mein an seiner Stammposition am Bechstein-Flügel stehender Opa auf keinen Fall verpasste – ausgerechnet die Geschichte von ihrer Nacht in der Untersuchungshaft auf der Wache München Ettstraße. Sie fand, das passte bestens ins Ambiente.
„Was hatte ich Schlimmes getan? Bei einer Frauen-Demo ein Fenster eingeschlagen. Ja, und? Buchten die mich ein! Über Nacht! Eine Schwangere! Und dann stellen mir die Scheißbullen Erbsensuppe hin, die Arschlöcher. Hab ich aus dem Fenster gekippt, genau auf die Windschutzscheibe von ’nem verdammten Streifenwagen. Mit mir nicht, sicher nicht. Erbsensuppe, pff.“
Nonchalant streifte sie die Asche ihrer filterlosen Zigarette am Tischtuch ab, noch bevor Omas herbeieilende Hauswirtschafterin ihr den Aschenbecher darunterhalten konnte.
Monika war kein Bauerntrampel oder so was, nein, sie konnte sich benehmen, wenn sie wollte, aber heute wollte sie eben nicht, und sie wusste ganz genau, was sie tat an ihrem ersten Tag in Rohrbach. Sie war Anti-Establishment, und sie testete Hans, mit dem sie längst zerstritten war bis aufs Messer. Auf wessen Seite würde er sich schlagen? Klar, dass er nicht auf ihrer Seite war, die Liebe reichte einfach nicht.
Die Monate vor der Geburt meines Geschwisterchens verbrachte ich in Rom bei Omi und Opi. Als ich zurückkam, konnte ich laufen und hatte einen Bruder, und ein paar weitere Monate später war es vorbei, unsere Eltern kratzten den letzten Rest Vernunft aus ihren Herzen und trennten sich.
Weil sie so jung waren und beide gerade erst angefangen hatten zu studieren (Monika Germanistik, um ihre Argumentationen bei Streitgesprächen zu perfektionieren, Hans Mathematik, um sich mit Logik aus dem Chaos, das er angerührt hatte, zu retten), trennten sie nicht nur sich, sondern auch uns Kinder. Ich wuchs ab sofort bei Monika auf und mein Bruder bei Hans.
Seit ich selbst Mutter bin, verstehe ich viele Dinge, die meine Mutter und auch meine beiden Väter nicht hingekriegt haben, besser. Doch manches kann ich noch weniger kapieren, seit ich meine Söhne habe und die andere Seite kenne. Alles in allem jedoch sage ich mir: Sie waren zu jung, und sie haben getan, was sie konnten, und gegeben, was sie hatten. Und wenn das nicht gereicht hat, gibt es hier keine Schuldigen.
Auch dass sie uns trennten, erschien ihnen damals sicher als eine vernünftige Lösung. Aber bei der Vorstellung, ich würde eins meiner Kinder hergeben, reißt es mir das Herz raus.
Als mein Sohn Nummer eins ungefähr zwei Jahre alt war, sprang ich an einer Bushaltestelle schnell raus, um eine Bananenschale in den Abfalleimer im Bushäuschen zu werfen. Ich kann Bananen nur ertragen, wenn sie fast noch grün sind. Braune Flecken ekeln mich, und der Geruch, den eine Bananenschale innerhalb weniger Minuten entwickelt, dreht mir den Magen um. Da ich genau einschätzen konnte, wie lange der Bus halten würde, bis die Leute alle ausgestiegen wären, wusste ich, dass ich locker die Zeit hatte, um zum Mülleimer zu hechten und wieder zurück in den Bus. Aber mein Sohn, der wusste das nicht. Er sah nur, wie seine Mama aus dem Bus sprang, und hatte das erste Mal in seinem Leben eine Trennungsangst-Attacke. Das Ganze hatte nicht mal dreißig Sekunden gedauert, doch als ich atemlos wieder neben ihm Platz nahm, auch ein wenig stolz auf meine waghalsige Aktion, blickte ich in seine Augen, die vor Panik geweitet waren. Er hatte, auch wenn es nur für eine halbe Minute gewesen war, seine Mutter verloren. Seine innere Sicherheit war beschädigt, die Selbstverständlichkeit „Meine Mama geht nicht weg“ hatte sich kurz aufgelöst.
Ich glaube nicht, dass er von der Bananensache ein Trauma davongetragen hat, dazu war ich sicher genug an seiner Seite, immer. Dennoch hatte ich furchtbare Schuldgefühle. Der Schmerz, der dich quält, wenn du deinem Kind wehgetan hast, fühlt sich an wie Steine essen, wie Säure trinken, es gibt nichts Schlimmeres. Ich habe mich so geschämt, meinen Jungen diesen Sekunden der Angst ausgesetzt zu haben, nur wegen einer Bananenschale. Auf der Stelle hätte ich eine ganz Kiste fauler schwarzer Bananen gegessen, hätte ich damit diesen Schreckensmoment rückgängig machen können.
Was ich damit sagen will:
Wie man es auch dreht und wendet, Monika hat ihr Kind weggegeben. Mein Bruder und ich waren zwar zusammen im Kinderhaus (der antiautoritären Version eines Kindergartens), in der Grundschule und im Kinderladen (der antiautoritären Version eines Horts), und er war regelmäßig zu Besuch bei uns, aber er lebte nicht mehr bei seiner Mutter, die ihn gerade erst geboren hatte. Sie muss jeden Morgen mit einem Golem auf ihrer Brust aufgewacht sein, muss ihr Herz von zwei Mühlsteinen gepult haben, die es Nacht für Nacht zerrieben. Anders kann es nicht gewesen sein.
Und erst mein Bruder. Er wurde von seiner Mutter verlassen. „Hat nicht geklappt, ciao.“ Wie soll man sich von einem solchen Schock erholen?
Hans war total überfordert und machte einen echt miesen Job als Vater, das darf ich sagen, denn er sagt das selbst so, oder so ähnlich. Und wer wen kirre gemacht hat, ich weiß es nicht. Aber mein Bruder war absolut unkontrollierbar. Sein Herz ist aus dem weichsten Gold, doch er war nicht zu bändigen als Junge, seine überbordende Energie lässt sich am ehesten vergleichen mit einem mittelgroßen Silvesterfeuerwerk, abgefackelt im Wohnzimmer. Wo er auftauchte, blieb kein Stein auf dem anderen, und er grillte die Nerven unseres Vaters tagtäglich auf hoher, zischender Flamme, bis nichts mehr übrig war als kalte Asche.
Und ich würde schon sagen, dass die Wurzeln seiner atemlosen kindlichen Raserei ganz da hinten zu finden sind. An dem Tag, als unsere Eltern beschlossen, Einzelkinder aus uns zu machen. „Eins du, eins ich, ist am vernünftigsten.“ War es nicht.
Die folgenden Jahre zu zweit mit meiner Mutter waren eigentlich sehr schön. Ich bekam nicht mit, wie labil sie war. Und wie prekär es wirklich stand bei uns: Wir hatten oft nicht mal das Geld für einen Kaugummi aus dem Automaten. Doch das war alles nicht wichtig. Für mich war Monika stark und groß, und nichts konnte ihr gefährlich werden.
Oft schlief ich in Kneipen auf ihrem Schoß ein, das Ohr an ihren Bauch gepresst, in dem ihre tiefe Stimme brummte. Meine Welt war in Ordnung, solange ich einen Becher süße warme Milch vor mir stehen hatte. Wir zogen oft um, in einem Hof auf einem Umzugskarton zu sitzen war ein normaler Samstagmorgen, es machte mir nichts aus, neue Wohnung, neues Glück, ich war dabei.
Am aufregendsten fand ich das halbe Jahr in der Kommune in der Maxvorstadt. Am ersten Abend in der großen Altbauwohnung lag ich in unserem neuen Zimmer auf einer Matratze auf dem Boden und lauschte den durcheinander und übereinander redenden und krakeelenden Stimmen draußen in der Küche, dem Gelächter und Gläserklirren, ich liebte diesen Geräuschteppich, liebe ihn heute noch. An der hohen Zimmerdecke wanderten Lichtstreifen von Autoscheinwerfern entlang, und ich fühlte mich total aufgehoben. Jetzt kann man sagen: Wieso aufgehoben, so ganz ohne Sicherheiten?, aber es war so. Und es ist heute noch so, egal wo ich bin, ich habe mein Zuhause tief in mir drin und kann mich da jederzeit einrollen wie eine Katze.
Ich hatte, schon bevor ich überhaupt denken konnte, ein Gefühl des Aufgehobenseins, des Beschütztwerdens, das losgelöst von allem, was um mich herum passierte, immer eine Konstante war. Wie ein großes Licht, an das ich angeschlossen bin mit einem Draht, der mich sichert wie eine Nabelschnur. Und auch wenn ich mal ins Trudeln komme, die Verbindung hält. Das große Licht hat in mir einen Ableger, der mal heller leuchtet und mal schwächer, je nach Tagesform, aber das Licht ist immer, immer da. Bis ich das so formulieren konnte, sollten allerdings viele Jahrzehnte vergehen.
Ich schlief wie eine Eins in der ersten Nacht in der Kommune, bis am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe an die Wohnungstür gehämmert wurde.
„Aufmachen! Polizei!“, donnerten die lauten Rufe durch die friedliche Morgenluft. Es dämmerte noch nicht mal, so früh waren die dran. Ein komplett unnötiger Aufwand, um ein Uhr mittags hätten sie immer noch die ganze WG im Schlaf überrascht.
„Hausdurchsuchung! Aufmachen!“
In der Wohngemeinschaft herrschte panische Geschäftigkeit, überall liefen Nackte herum und suchten was zum Überwerfen.
„Jürgen, hast du ne Unterhose für mich?“
„Nee, hab meine weggeschmissen, war dreckig.“
„Mann, Leute, Konzentration, das ist nicht witzig!“
„Sofort aufmachen! Polizei! Wir brechen die Tür auf!“
Es hämmerte an die Tür, die ballerten so hart aufs Holz, bald wären sie ohne Rammbock drin gewesen. Nach ein paar Minuten, die sich endlos dehnten, ließ Jürgen schließlich den ungebetenen Besuch herein. Um die Hüften hatte er sich mein Lieblingshandtuch mit den kleinen Enten geschlungen, ich war empört. Doch ich kam nicht dazu, Jürgen zu fragen, ob er eigentlich spinnt, denn das hätte ich selbstverständlich getan, da kannte ich als Tochter meiner Mutter gar nichts, doch jetzt stürmten die Beamten die Wohnung und stellten alles auf den Kopf.
„Hey, Moment mal, meine Räucherstäbchen, ganz lassen, ja!“
„Raus aus meiner Vögel-Ecke, die ist priva … aua, mein Arm!“
Es war ein Aufruhr, als hätte man das ganze Oktoberfest in die nach Schlaf, Rauch und Haut riechende 4-Zimmer-Altbauwohnung gepresst. Um mich kümmerte sich eine Beamtin, die extra zur Kinderbetreuung mitgekommen war, wie ich argwöhnte. In Wirklichkeit war sie wahrscheinlich einfach nur nett, aber ich hatte überhaupt keine Lust auf eine nette Polizistin. Das hier war ernst, womöglich wurden gleich alle verhaftet, wieder mal Ettstraße, und was dann? Musste ich dann mit der Frau in Uniform mitgehen oder was? Über Nacht vom Hippie- zum Bullenkind? Nope! Die konnte mir gestohlen bleiben mit ihrem Firlefanz.
Mit sanfter Stimme sagte sie zu mir. „Na, wollen wir was malen? Komm, wir setzen uns in die Küche und du zeigst mir, was du kannst.“
Ich hasste Polizei und ließ die Frau voll auflaufen. Während sie mir geduldig zusah, verdeckte ich das Blatt, das sie mir hingelegt hatte, mit meinen Haaren und malte meinen Weihnachtswunschzettel. Es war September, und ich kannte die Liste bereits aus dem Effeff, eine meiner leichtesten Übungen. Zum Glück kam sie nicht auf die Idee, mal auf die Rückseite meiner hübschen Kinderzeichnung zu gucken, denn da stand in fetten Lettern:
POLIZISTENSINDMÖRDER!
TERRORISTENSINDMENSCHEN!
FREILASSEN!
Nach einer Stunde war der Spuk vorbei, und das grüne Kommando zog ab. Sie hatten nichts gefunden, was den Verdacht erhärtete, es handle sich hier um ein Nest von RAF-Sympathisanten.
Meine Mutter kochte Kaffee und sagte: „So eine Arschlochnummer. Und blöd sind sie auch noch. Aber wer macht jetzt das Chaos weg?“
Ich saß neben ihr, stolz auf meine Mitarbeit, und dachte nur: Das sah hier vorher mindestens genauso unordentlich aus wie jetzt, aber gut.
Ein paar Monate in der Kommune gingen vorüber, und ich hatte endlich gelernt, die allesamt bärtigen langhaarigen nackten Mitbewohner an ihren Stimmen auseinanderzuhalten, da zogen Monika und ich kurz vor meinem ersten Schultag zu Lothar, den sie im Kinderhaus kennengelernt hatte und der ihr ein treuer, stabiler Ehemann sein sollte, bis zum letzten Tag.
Ich war jetzt ein Schulkind und lernte Rechnen und Schreiben, und immer hatte ich diese leise Ahnung, dass es noch einiges gab zwischen Himmel und Erde, was nicht sichtbar war, aber trotzdem existierte, und dass das irgendwie mit Gott zu tun hatte. Und ich wollte dringend mit meiner Mutter darüber philosophieren.
Ich saß in der Badewanne, sie hatte mir gerade den Schaum aus den Haaren gespült, da fragte ich sie rundheraus: „Monika, glaubst du eigentlich an Gott?“
Ganz falsche Frage, ich hätte genauso gut eine Vegetarierin nach dem perfekten Schweinebraten fragen können, oh Mann, ich biss sowas von auf Granit.
Monika reichte mir mein Entenhandtuch und sagte verächtlich schnaubend: „Ja, klar, Gott, haha, das ist ein alter Mann mit einem langen weißen Bart, der sitzt auf einer Wolke und regelt unsere Angelegenheiten hier unten. Siehste ja ganz gut an Hitler und so, wie toll er das draufhat.“
Hitler? Den Namen hatte ich noch nie gehört. Das Gespräch ging nicht in die Richtung, die ich im Sinn gehabt hatte. Ich wagte trotzdem noch einen Vorstoß: „Ja, okay, aber was machen denn die Leute in der Kirche so?“
Ich dachte, in der Kirche kamen alle zusammen, die an Gott glaubten, und machten es sich schön, oder so was in der Art. Wenn das so ein Club war, wie ich ihn mir vorstellte, wollte ich da Mitglied werden. Nun ja, dazu hatte meine Mutter eine wie gewohnt starke Meinung. Hätte ich mir denken können.
„Die scheiß Katholiken, die machen sich die Taschen voll, unterdrücken Frauen, Schwarze und Schwule, dann essen sie jeden Sonntag einen Cracker, und Puff! ist alles wieder gut. Das kotzt mich so an, diese scheinheilige Tour.“
Sie zündete sich eine an und verließ das Bad. Gespräch beendet.
Ich rubbelte meine Haare trocken und grübelte nach. Ich hatte nichts verstanden. Aber eins wusste ich: Ich wollte den Cracker.
Ich überlegte, wen ich nach dem Alles-wieder-gut-Gebäck fragen konnte. Dragana vielleicht. Meine beste Freundin in der ersten Klasse, ein verwegenes Mädchen mit kurzen braunen Haaren, das wie mein Opi aus Maribor stammte und Akkordeon spielen konnte wie ein echter Partisan. Das verkündete sie jedenfalls bei jeder Gelegenheit, und warum sollte ich ihr nicht glauben. Ich hatte keine Ahnung, was ein Partisan war, aber es klang gefährlich und betörend, und ich war ein kleines bisschen in Dragana verliebt. So war alles, was sie sagte, Gesetz. Meine Angebetete trug immer ein silbernes Kettchen mit einem kleinen Kreuz um den Hals, sie musste Bescheid wissen über den Cracker.
An einem Freitag in der großen Pause saßen wir nebeneinander auf der kleinen Bank vor dem Geräteschuppen und tauschten unsere Pausenbrote. Sie hatte weiche Semmeln, aus denen seitlich die Erdbeermarmelade quoll, fand sie eklig, ich super. Und irgendwas sagte ihr an meinen verhassten Käsebroten zu. Win-win, wir waren beide glücklich. Wie immer hatten wir eine Runde Fußball gedroschen, die anderen Mädchen mit ihren bescheuerten Klatsch- und Seilhüpf-Spielen, mit ihrem Kreischen und Kichern fanden wir oberdoof, und jetzt schwiegen wir einen Moment einhellig.
Dann rückte ich heraus mit den Fragen, die mir unter den Nägeln brannten. „Du, gehst du eigentlich diesen Sonntag in die Kirche?“
„Ja, klar, jeden Sonntag“, antwortete Dragana, und ihre Zahnlücke zischelte unwiderstehlich.
„Und was gibt es da immer für einen Cracker am Schluss?“
„Cracker? Gibt kein Cracker in der Kirche, so ein Schmarrn.“ Sie rollte das R, und ihre heisere Stimme hatte die unverkennbare Melodie und Würze des Balkans.
„Doch, da gibt es so einen Keks, der alles wieder gut macht, jetzt denk doch mal nach“, drängte ich. Die Pause ging zu Ende, und ich brauchte Antworten.
Genau gleichzeitig mit der Klingel, die uns in die Klassenzimmer zurückschrillte, fiel bei meiner Freundin der Groschen. „Ach so! Du meinst die heilige Kommunion!“
Unsere Klassenlehrerin Frau Winzger klatschte in die Hände und rief in ihrem dominanten Bass-Bariton: „So, Kinder! Alle rein! Hopp hopp!“
In Zweierreihen trotteten wir die Treppen rauf, und Dragana klärte mich flüsternd und zahnzischend auf: „Also, am Sonntag is ma immer Gottesdienst. Alles klar? Da beten alle und singen und so. Und am Schluss geht ma nach vorne, und dann legt der Pfarrer einem eine Oblate auf die Zunge. Die ist der Leib Christi. Schmeckt ma nach garnix. Und mit neun Jahren machma Erstkommunion, da gibt’s fett Geschenke. Aber ma muss a weißes Kleid anziehen, ätzend.“
Der Leib Christi? Oblaten kannte ich von den Lebkuchen, die Omi an Weihnachten zauberte, da klebten die unten dran. Die waren der Leib Christi? Das war der magische Keks? Ich verstand nur Bahnhof. Aber die weißen Erstkommunionskleider, die kannte ich. Mein Weg von der Schule zum Kinderladen führte am Motorama vorbei, einem Einkaufszentrum, dessen Herzstück (zumindest für mich) eine Boutique war, in deren Schaufenster kindergroße Puppen in schwarzen Anzügen und weißen Mini-Brautkleidern standen. Hier wurden die Kinder für ihre Hochzeit mit Jesus ausgestattet, so meine Vermutung. Jeden Tag drückte ich mir an der Scheibe die Nase platt. Ich träumte von einer Kopf-bis-Fuß-Klamotte in der Farbe der Unschuld. Rüschenkleid, Strumpfhose und als Finish Lackschuhe. Alles in blütenweiß. Beim Blick auf meine Sandalen wusste ich, weiter konnte ich nicht entfernt sein von meinem Tagtraum, in dem ich als kleine Braut zum Altar schritt.
Erst kürzlich hatte Frau Winzger mich am Spind belehrt. „Lissi, deine Schuhe SCHREIEN nach Schuhcreme. Kinder, schaut mal alle her: SO! NICHT!“ In der Grundschule lernte ich mühsam, dass der Zustand meiner Schuhe (schmutzig bis zur Unkenntlichkeit der Ursprungsfarbe), meiner Hände (patiniert mit Dreck und Lolli-Zucker, wie sich das gehörte bei Kindern, deren Spielzimmer die Straßen waren) und meiner Haare (verfilzt, nur mit der Schere zu retten) nicht der Norm entsprach.
Meine „Bande von nackerten Erwachsenen und dreckerten bappigen Kindern“, wie uns der Opa von meinem besten Freund Felix kopfschüttelnd nannte, war eine gute Bande, eine sehr gute sogar. Wir Kinder hatten fast unendliche Freiheiten, mit uns wurde geredet wie mit Ebenbürtigen, es wurde nie langweilig, und ich hatte ja als Ausgleich zu dem ganzen Affenpuff meine Omi mütterlicherseits. Sie war aus Österreich nach München, von da nach Rom und 1975 als mein Opi krank wurde wieder nach München zurückgezogen und ummantelte mich regelmäßig mit Geborgenheit. Sie flickte kommentarlos meine Kleider und säuberte meine Schuhe, nur damit ich sie Minuten später wieder komplett verdreckte. Die Omi war die Einzige, die ich an meine Haare ließ. Vorsichtig kämmte sie meinen blonden Filz auf Hochglanz und machte mir die originale Leia-Organa-Zopffrisur. Im Hof spielte ich Star Wars, bis Omi mich zum Essen rief. Wollte ich nach der Schule eine warme Mahlzeit, dann war sie die Anlaufstelle. Sie war meine Ruheoase im Hippie-Tumult.
Ich liebte mein Leben und die Abwechslung, die es mir bot, und ich schaffte ganz ohne Ballett den Spagat zwischen der bürgerlichen und der, nun ja, anderen Welt ziemlich gut. Ich bewunderte die wilde Monika mit ihrem unangepassten Charisma. Und doch, es war so anstrengend am Rand der Gesellschaft. Manchmal wünschte ich mir einfach nur eine normale Mutter mit einer Zuckerwattefrisur, die das Bad wienerte, während auf dem Herd ein schönes warmes Mittagessen blubberte.
Die Realität sah so aus: Als wir noch im Kinderhaus waren, einer Elterninitiative im Münchner Norden, teilten die Eltern untereinander Fahrdienste auf. Zweimal die Woche brachte Monika fünf bis sechs von uns Kinderhauskindern morgens zu dem kleinen Hexenhäuschen am Isarhochufer, das wir auf den Kopf stellen durften. Ja, wir wurden sogar zum Chaos angehalten, das war die brandneue Pädagogik aus was weiß ich wo, Amerika, Takatukaland, keine Ahnung, aber es war toll.
Der gut gefüllte VW Käfer rasselte über die Ludwigstraße, ich sang lauthals die Gripsparade-Kassette mit, Mendel drückte auf dem Beifahrersitz UHU-Tuben aus (weiß der Himmel, woher, aber er wusste sich zu berauschen, bevor er richtig laufen konnte). Die beiden Tanjas stritten um den begehrten Mittelplatz, auch Schleudersitz genannt, denn Gurte wurden nicht benutzt damals, und bei jedem Bremsmanöver flogen wir juchzend durcheinander. Der Schleudersitz garantierte die längste Flugbahn, und darauf waren die Tanjas scharf. (Wo heute Eltern ihre Kinder in den Schwachsinn helikoptern, hatten die Erwachsenen der Siebziger-Jahre vor allem ihren eigenen Spaß im Sinn. Sie nannten das Selbstverwirklichung. Heute undenkbar. Wir aber kannten es nicht anders und genossen die damit einhergehende Freiheit in vollen Zügen.)
Natascha hauchte an die Scheibe und träumte vor sich hin, und Felix schielte mich bewundernd aus einem blauen Auge an. Das andere war zugeklebt. Ich liebte sein Augenpflaster. Die morgendlichen Fahrten an seiner Seite waren das Größte für mich. Mir war egal, wo ich saß, Hauptsache neben Felix.
Regelmäßig sorgte Monikas Ruf: „Alle runter! Die Bullen!“, schlagartig für Ruhe im Karton. Kichernd versteckten wir uns dann alle im Fußraum. Nur Natascha träumte am Fenster weiter. Ich sang Felix ins Ohr und stellte mir vor, wie wir eines Tages heiraten würden. Wenn wir das Bullenauto ohne Zwischenfall passiert hatten, tauchten alle wieder auf, tauschten die Plätze durch, und weiter ging die Reise.
Einmal hatte mein Bruder zu viel UHU erwischt, ihm wurde schlecht, und er kroch nach hinten, quetschte sich neben mich, klappte das winzige Halbfenster auf und spuckte ein bisschen Kakao in die Morgenluft. Kichernd winkten wir den Spießern im Auto hinter uns zu und wussten: Zusammen waren wir unbesiegbar. Ich sang extra laut: „Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind! Tä! Tä! Der spinnt, der spinnt, der spinnt!“
In der Grundschule waren Felix, Muckel, Natascha, mein Bruder und ich die einzigen Kinder, die keiner Religion zugehörten. „Bekenntnislos“ wurden wir genannt, und es wurde extra für uns ein Ethikunterricht ins Leben gerufen. Den hatte sich die Direktorin Frau Goldberg in der dritten Klasse zähneknirschend aus den Fingern gesaugt, nachdem wir die ersten zwei Schuljahre immer Freistunde gehabt hatten, wenn die anderen Kinder Religionsunterricht bekamen. In diesen Freistunden hatten wir saftig Spaß. Zu saftig für Frau Goldbergs Geschmack. Als wir an einem kalten Wintertag Bankräuber spielten, Natascha an die Kastanie im Schulhof gefesselt hatten und uns mit Schokoladezigarren Mut anrauchten, bevor wir eine Lösegeldforderung absetzen würden, und während sich mein Bruder kopfüber die Kellertreppe hinunterstürzte, er musste sich immer eine Extrawurst braten, war Schluss mit den Freistunden. Ethik wurde erfunden.
Ich wollte aber kein Ethik. Ich wollte das Ding mit Jesus lernen. Ich wollte Member bei den Katholiken werden. Wollte dazugehören.
Spoiler: Ich bin immer noch ohne Bekenntnis, die Kirche und ich sollten nicht sein. Ich habe meinen eigenen Deal mit Gott: Ich bitte um nichts, aber immer, wenn mein Herz vor Dankbarkeit platzen will, gehe ich in die nächste Kirche, setze mich kurz in eine Bank, schließe meine Augen und bedanke mich. Clubs liegen mir nicht, ich bin ein pfeilgerader Einzelgänger, aber Gott und ich sind cool miteinander, ich bin angeschlossen, wir sind im Dialog, und ich habe mal irgendwo gelesen, man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Das gefällt mir, es klingt tröstlich. Und manchmal braucht ja jeder Trost. Kirche und Bibel sind wie eine Sprache, die ich nicht spreche, aber die Musik der Nächstenliebe versteht jeder.
Mit sieben sah ich das noch nicht so entspannt. Ich war mir nicht sicher, ob Gott mich auch ohne Minibrautkleid und Oblate lieben würde. Tut er, weiß ich jetzt. Manchmal würde ich gern zu der kleinen Lissi zurückgehen und ihr sagen: „Du wirst geliebt, und übrigens: Hab keine Angst. Dein Leben wird super.“ Da ich von dieser Gewissheit aber noch meilenweit entfernt war, musste ich mich bei den Profis einschmuggeln, dachte ich.
An Weihnachten in der zweiten Klasse war endlich meine Chance gekommen. Am Tag vor den Ferien fand gleich um die Ecke bei der Schule der Weihnachtsgottesdienst statt, und da wir Kinderhaus-Chaoten erst eine Woche zuvor die Bankraubnummer im Hof durchgezogen hatten und es an Aufsichtspersonen mangelte, durften wir ausnahmsweise mit in die Kirche. Ich konnte meine Aufregung kaum verbergen. Heute würde ich mit etwas Glück die Kommunion bekommen. Getauft war ich übrigens, sogar katholisch, das hatten meine Großeltern noch schnell abgewickelt, bevor das Hans-und-Monika-Ding in die Luft flog. Aber als meine Mutter Rohrbach und die ganze von-Koch-Mischpoke hinter sich gelassen hatte, war ihr erster Gang zum Einwohnermeldeamt, um aus der Kirche auszutreten und mich gleich mit abzumelden, Peng, Stempel drauf, aus und vorbei, ab heute ohne Bekenntnis, abgekürzt o. B.
Ich war untröstlich.
Bis heute. Denn heute würde sich das Blatt zu meinen Gunsten wenden: Es war Oblaten-Tag.
Es wurde mein persönliches Oblaten-Gate.
Unter Shht und Psst verteilten sich die Kinder aus meiner und den anderen Klassen in den Bänken, die ganze Grundschule war da. Wir „o. B.s“ mussten ganz hinten sitzen und extra still sein. Gebannt verfolgte ich meinen ersten Gottesdienst. Es wurde, genau wie Dragana erzählt hatte, gebetet und gesungen, von irgendwoher dröhnte eine Orgel, und ich wunderte mich, wie gut alle das Protokoll von Aufstehen und wieder Hinsetzen beherrschten. Wie die Jungs, die sonst nie den Mund aufbekamen, auf einmal laut und vor allem auswendig die komplizierten Lieder mitsingen konnten. Ich war eingeschüchtert und überwältigt. Für die kichernden Freunde neben mir in der Bank hatte ich keinen Blick übrig, denn ich war auf einer Mission. Geduldig und mal wieder mit klappernden Zähnen, denn, boy, war das kalt hier, wartete ich auf das Finale.
Schließlich hatte meine Stunde geschlagen. Oder eher mein Stündchen. Aber das ahnte ich in diesem Moment noch nicht. Als sich alle erhoben und in einer langen Reihe anstellten, ging es endlich los. Die heilige Kommunion. Ich fädelte mich in die Warteschlange ein und versuchte nicht aufzufallen. Aber bei mehr als dreihundert Kindern, was sollte da passieren? In wenigen Minuten würde ich mir die magische Oblate, den sagenumwobenen Alles-wieder-gut-Cracker auf der Zunge zergehen lassen, und dann wäre alles geritzt. Ich würde wieder katholisch sein, ein vollwertiges Mitglied. Kirchensteuer hin oder her, Kommunion gilt.
Die Wartezeit zog sich endlos, mir war so kalt, dass ich meine Zehen in den Schuhen nicht mehr spürte. Dann, endlich, war ich an der Reihe. Ich hatte das Mädchen vor mir genau beobachtet. Ah, man muss Amen sagen, alles klar, gut, wird gemacht.





























