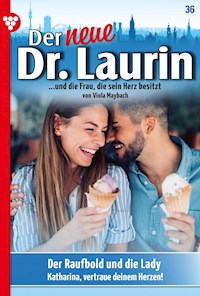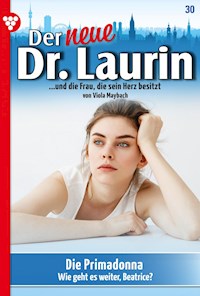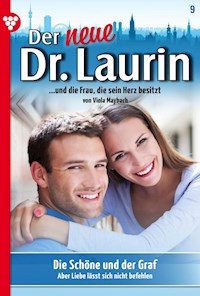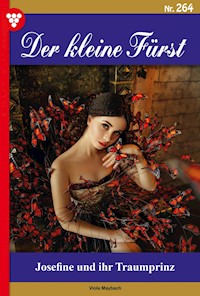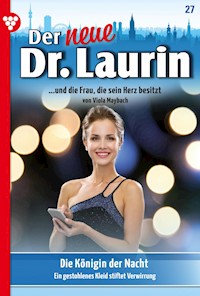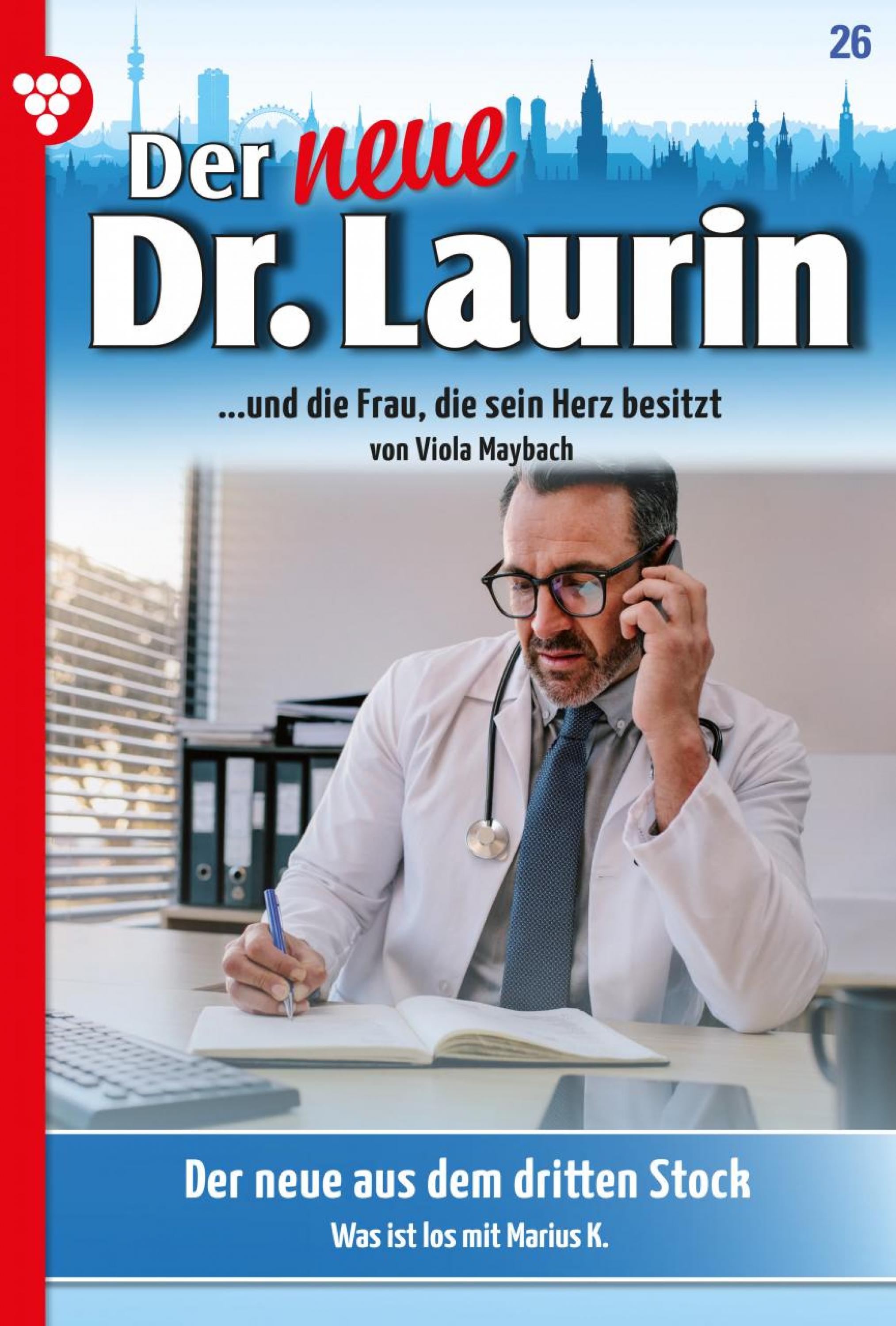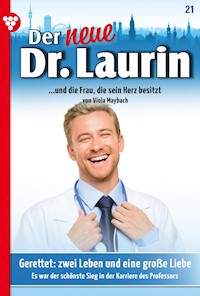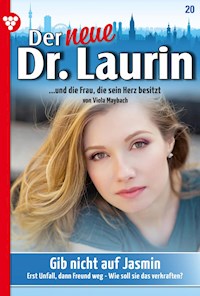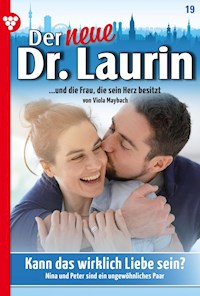Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der kleine Fürst
- Sprache: Deutsch
Viola Maybach hat sich mit der reizvollen Serie "Der kleine Fürst" in die Herzen der Leserinnen und Leser geschrieben. Alles beginnt mit einem Schicksalsschlag: Das Fürstenpaar Leopold und Elisabeth von Sternberg kommt bei einem Hubschrauberunglück ums Leben. Ihr einziger Sohn, der 15jährige Christian von Sternberg, den jeder seit frühesten Kinderzeiten "Der kleine Fürst" nennt, wird mit Erreichen der Volljährigkeit die fürstlichen Geschicke übernehmen müssen. "Der kleine Fürst" ist vom heutigen Romanmarkt nicht mehr wegzudenken. Im Traum erlebte sie den Schrecken noch einmal: Eben noch waren sie guter Dinge gewesen. Ihre Mutter hatte eine lustige Geschichte erzählt, sie hatten alle drei sehr lachen müssen. Und im nächsten Moment schon, jedenfalls war es in Lillys Erinnerung und auch jetzt im Traum so, hatte ihr Vater so seltsam gestöhnt, und der Wagen war ins Schlingern geraten. Sie hatten geschrien, ihre Mutter und sie, aber ihr Vater hatte nicht mehr reagiert. Ihre Mutter hatte dann das Steuer herumgerissen, und irgendwie war es ihr auch gelungen, vom Beifahrersitz aus ans Bremspedal zu gelangen. Sie waren in einem Straßengraben gelandet und dort zum Stehen gekommen. Danach: Ihr Vater leichenblass und noch immer stöhnend, zusammengesunken am Steuer, nicht ansprechbar. Schreie, Verzweiflung, Tränen bei Lilly, während ihre Mutter sich rasch gefasst und den Notruf angerufen hatte. Und dann das Warten, endlos lang – während ihr Vater ganz still geworden war und sie nicht gewusst hatten, wie sie ihm helfen sollten. Endlich Sirenen, überlaut. Viele Leute, Stimmen, die durcheinander redeten. Jemand, der ihr eine Decke umlegte und einen Becher Tee in die Hand drückte. Aber sie konnte nichts trinken. Sie hatte nur Augen für ihren Vater, den sie auf eine Trage legten und zu einem Krankenwagen brachten. Sie wollte ihm folgen, aber sie konnte sich nicht bewegen. Der Traum war zu Ende, sie wachte auf. Müde blinzelte sie in das trübe Licht auf dem Stationsflur eines Krankenhauses in Südfrankreich. Jemand stand vor ihr. »Du bist ja wach«, sagte Marietta von Cadow, ihre Mutter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der kleine Fürst – 281 –Schöne Lilly - neues Leben!
Jetzt wird es ernst...
Viola Maybach
Im Traum erlebte sie den Schrecken noch einmal: Eben noch waren sie guter Dinge gewesen. Ihre Mutter hatte eine lustige Geschichte erzählt, sie hatten alle drei sehr lachen müssen. Und im nächsten Moment schon, jedenfalls war es in Lillys Erinnerung und auch jetzt im Traum so, hatte ihr Vater so seltsam gestöhnt, und der Wagen war ins Schlingern geraten. Sie hatten geschrien, ihre Mutter und sie, aber ihr Vater hatte nicht mehr reagiert. Ihre Mutter hatte dann das Steuer herumgerissen, und irgendwie war es ihr auch gelungen, vom Beifahrersitz aus ans Bremspedal zu gelangen. Sie waren in einem Straßengraben gelandet und dort zum Stehen gekommen.
Danach: Ihr Vater leichenblass und noch immer stöhnend, zusammengesunken am Steuer, nicht ansprechbar. Schreie, Verzweiflung, Tränen bei Lilly, während ihre Mutter sich rasch gefasst und den Notruf angerufen hatte. Und dann das Warten, endlos lang – während ihr Vater ganz still geworden war und sie nicht gewusst hatten, wie sie ihm helfen sollten. Endlich Sirenen, überlaut. Viele Leute, Stimmen, die durcheinander redeten. Jemand, der ihr eine Decke umlegte und einen Becher Tee in die Hand drückte.
Aber sie konnte nichts trinken. Sie hatte nur Augen für ihren Vater, den sie auf eine Trage legten und zu einem Krankenwagen brachten. Sie wollte ihm folgen, aber sie konnte sich nicht bewegen.
Der Traum war zu Ende, sie wachte auf. Müde blinzelte sie in das trübe Licht auf dem Stationsflur eines Krankenhauses in Südfrankreich. Jemand stand vor ihr.
»Du bist ja wach«, sagte Marietta von Cadow, ihre Mutter.
»Wie geht es Papa?«
Marietta setzte sich neben sie. Sie hatte italienische Großeltern, und dieses südeuropäische Erbe war ihr anzusehen. Sie hatte pechschwarze, dichte lange Haare, dunkle Augen und olivfarbene Haut, und nicht selten ging das Temperament mit ihr durch.
Lilly hingegen war rein äußerlich ganz das Kind ihres blonden, blauäugigen Vaters. Sie war schlank und hübsch, hatte schöne blaue Augen und ein klares Gesicht mit einer kleinen Nase und einem reizvoll geschwungenen Mund, umrahmt von kurzen Haaren, die im Sommer ganz hell wurden. Sie hatte sich schon oft gewünscht, so auszusehen wie ihre Mutter.
»Es war ein schwerer Schlaganfall, Lilly. Wir hatten Pech, dass es in einer so einsamen Gegend passiert ist. Deshalb hat es so lange gedauert, bis der Krankenwagen kam. Bei Schlaganfällen kommt es vor allem darauf an, dass der Patient schnell Hilfe bekommt. Aber die Ärzte tun, was sie können.«
»Kann ich zu ihm?«
»Sie behandeln ihn immer noch, sie haben mich auch weggeschickt. Ich habe mit deinen Großeltern telefoniert. Sie kommen und holen dich ab.«
Lilly versteifte sich. »Abholen? Aber ich will hier bleiben, bei euch. Ich will nicht weg, Mama!«
»Ich kann mich jetzt nur um Papa kümmern. Es ist viel zu klären, das kannst du dir ja wahrscheinlich vorstellen.«
»Du musst dich doch gar nicht um mich kümmern! Wir können beide im Campingwagen wohnen, wie bisher, dann bist du auch nicht so allein, und ich …«
»Lilly!« Ihre Mutter fasste sie an beiden Schultern und drehte sie zu sich herum. »Ich werde überhaupt keine Zeit für dich haben, verstehst du? Ich werde meine Tage hier im Krankenhaus verbringen, während ich gleichzeitig versuche zu klären, welches die beste Behandlung für Papa ist und wie wir die bezahlen können. Das wird meine Zeit und auch meine Kraft vollständig in Anspruch nehmen. Du kannst nicht hier bleiben. Und jetzt hör bitte auf zu diskutieren, das schaffe ich nämlich nicht auch noch.«
Ihre Stimme klang mit einem Mal so brüchig, dass Lilly erschrak. Sie widersprach deshalb nur noch leise. »Aber ich will nicht nach Sternberg!«
»Es ist ja vermutlich nicht für lange«, versuchte ihre Mutter sie zu besänftigen. »Nur, bis ich weiß, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen. Ich muss mir doch selbst erst einmal einen Überblick verschaffen, wie wir das hier alles schaffen sollen.«
»Und wenn … wenn Papa nicht wieder richtig gesund wird?«, fragte Lilly. »Was machen wir dann? Müssen wir dann irgendwo in eine Wohnung ziehen und leben wie alle anderen?«
Es war wohl die eine Frage zu viel gewesen, denn die Augen ihrer Mutter füllten sich mit Tränen. Sie verbarg ihr Gesicht in den Händen und fing haltlos an zu schluchzen.
Lilly fühlte sich schrecklich. Sie hatte ihrer Mutter nicht noch mehr Kummer machen wollen – aber sie selbst war doch auch unglücklich! Und sie wollte nicht weggeschickt werden, schon gar nicht zu ihren Großeltern, von denen sie wusste, dass sie das Leben, das ihr Sohn mit seiner kleinen Familie führte, nicht gut hießen: ›Vagabundenleben‹ nannten sie es, weil die drei keinen festen Wohnsitz hatten, sondern mit einem großen Campingwagen ständig unterwegs waren.
Lillys Eltern waren Künstler, ihr Vater war Bildhauer, ihre Mutter malte. Wenn es ihnen irgendwo besonders gut gefiel, blieben sie für eine Weile dort, dann zogen sie weiter. Von dem, was ihre Eltern verkauften, konnten sie recht gut leben. Geld im Überfluss hatten sie natürlich nicht, aber sie empfanden sich trotzdem als reich, denn die Welt gehörte ihnen. Sie hatten schon viel von ihr gesehen, überall interessante Menschen getroffen, spannende Dinge erlebt.
Seit Lilly nicht mehr schulpflichtig war, war es sogar noch einfacher geworden. Sie war jetzt einundzwanzig Jahre alt, ihr Abitur hatte sie mit Auszeichnung bestanden. Ihre Eltern hatten sie unterrichtet oder sie war, wenn sie irgendwo länger geblieben waren, dort zur Schule gegangen. Das Lernen war ihr immer leicht gefallen, vor allem Sprachen lernte sie spielend. Noch hatte sie sich keine Gedanken gemacht, was sie mit ihrem Leben anfangen wollte. In ihrer Vorstellung war es einfach immer so weiter gegangen, obwohl ihre Eltern in letzter Zeit öfter gesagt hatten, sie solle mit einer Ausbildung beginnen und Pläne für ein eigenes Leben machen. Dazu verspürte sie wenig Neigung.
Und jetzt wurde sie weggeschickt! Sie wusste, dass sie ungerecht war, aber sie nahm es ihrer Mutter übel, dass sie sie nicht bei sich haben wollte. Dabei hätten sie sich doch gegenseitig stützen und trösten können!
»Wein doch nicht«, sagte sie unbeholfen. »Es ist ja nur so, dass ich bei dir und Papa bleiben möchte – wir haben immer zusammengehalten, und jetzt schickst du mich weg.«
Ihre Mutter trocknete ihre Tränen und richtete sich auf. »Ich schicke dich nicht weg«, sagte sie müde. »Es ist nur so, dass meine Kraft im Augenblick gerade ausreicht, um mich um deinen Vater zu kümmern, Lilly. Kannst du das nicht verstehen?«
Lilly wurde einer Antwort enthoben, denn eine Ärztin kam mit schnellen Schritten auf sie zu. »Frau von Cadow, kommen Sie bitte, Sie müssen eine Entscheidung fällen.«
Sowohl Lilly als auch ihre Mutter sprachen fließend Französisch, so war die Verständigung von Anfang an kein Problem gewesen.
Lilly war zusammen mit ihrer Mutter aufgesprungen, aber die Ärztin schüttelte nur knapp den Kopf. »Nur Ihre Mutter bitte.«
Lilly sank auf ihren Stuhl zurück, während sie den beiden Frauen nachsah. Wieso durfte sie ihren Vater nicht sehen? Wieso durfte sie nicht dabei sein, wenn wichtige Entscheidungen zu fällen waren? Sie war sein einziges Kind, sein ›Herzblatt‹, wie er manchmal zärtlich-scherzhaft sagte. Und jetzt? Jetzt durfte sie nicht einmal zu ihm, sie schlossen sie aus, als wäre sie eine Fremde.
Sie spürte die aufsteigenden Tränen, schluckte sie jedoch hinunter. Sie wollte keine Schwäche zeigen.
*
»Sofia«, sagte Ulrike von Cadow, »gut, dass ich dich gleich erreiche. Ich kann unsere Verabredung leider nicht einhalten. Max und ich sind auf dem Weg nach Stuttgart, zum Flughafen, wir fliegen in zwei Stunden nach Frankreich.«
Baronin Sofia von Kant saß auf der Terrasse von Schloss Sternberg und trank einen Tee, während sie telefonierte. Sie hatte sich schon über Ulrike von Cadows Verspätung gewundert, die sonst immer eher zu früh als zu spät kam. Ulrike und sie arbeiteten oft ehrenamtlich zusammen, sie waren trotz des großen Altersunterschieds zwischen ihnen ein gutes Team und hätten an diesem Nachmittag einiges zu besprechen gehabt.
»Was ist denn passiert?«, fragte sie. Ihr war Ulrikes gepresste Stimme nicht entgangen.
»Unser Sohn hatte einen schweren Schlaganfall«, antwortete Ulrike. »Offenbar waren sie gerade in einer einsamen Gegend in Südfrankreich unterwegs, jedenfalls hat es offenbar ziemlich lange gedauert, bis er Hilfe bekam. Du weißt, was das bedeutet.«
»Das tut mir so leid!« Sofia kannte Moritz von Cadow nicht, aber sie wusste von seiner Mutter, dass er ein Leben führte, über das seine Eltern nicht glücklich waren: Er arbeitete als Bildhauer, durchaus erfolgreich, war jedoch nirgends zu Hause, sondern fuhr mit Frau und Tochter in einem großen Campingwagen durch die Welt. Auch seine Frau war Künstlerin, sie malte, und auch ihren Namen konnte man immer mal wieder im Feuilleton lesen. Neulich hatte ein großes Museum eins ihrer Bilder gekauft, das war ihr bislang größter Erfolg gewesen.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte Sofia einmal ein Interview mit dem unkonventionellen Paar gelesen, das sie sehr sympathisch gefunden hatte. Sie konnte sich gut vorstellen, dass die Art, wie die jüngeren Cadows lebten, sehr inspirierend war. Und ihre Tochter schien dieses Leben ebenfalls zu schätzen – kein Wunder. Wenn man als junger Mensch schon so viel von der Welt sah, erweiterte das sicherlich den Horizont.
»Ich weiß noch nicht, wie lange wir dort bleiben. Marietta hat uns gebeten, unsere Enkelin zunächst einmal zu uns zu nehmen, während sie sich um Moritz kümmert und versucht zu klären, wie es mit ihm weitergeht.«
Ulrike von Cadows Stimme zitterte kaum merklich. »Wir würden ihn natürlich am liebsten sofort nach Deutschland holen, und wir würden auch die Behandlung bezahlen, aber das werden sie auf keinen Fall wollen. Dabei sollte man doch annehmen, dass wenigstens in einer solchen Situation die Hilfe der Eltern willkommen ist.«
Sofia fühlte sich hilflos. Was sollte sie darauf erwidern? Künstler waren ja oft eigenwillige Menschen, und Moritz von Cadow hatte sich offenbar schon als sehr junger Mensch von den Fesseln befreit, die das Leben in seinem Elternhaus ihm angelegt hatte. Früh war klar gewesen, dass er eine künstlerische Laufbahn einschlagen würde und als er dann seine zukünftige Frau getroffen hatte, die ähnlich leben wollte wie er, hatten sie ihre Familien vor vollendete Tatsachen gestellt. Immerhin hatten sie noch geheiratet, bevor sie sich auf den Weg gemacht hatten, aber die Hochzeit war nicht nach dem Geschmack der Cadows gewesen: Sie hatte im engsten Kreis stattgefunden und war, so hatte Ulrike es betrübt ausgedrückt, ›glanzlos‹ gewesen.
»Es wird schon eine Hilfe sein, wenn ihr vor Ort seid«, sagte Sofia schließlich. »Da ist doch jetzt vieles zu entscheiden und zu regeln, eure Schwiegertochter wird froh sein, wenn sie damit nicht allein ist.«
»Das siehst du leider falsch. Sie will nur, dass wir Lilly abholen, weil sie sich um ihre Tochter jetzt nicht auch noch kümmern kann. Was unseren Sohn betrifft, wird sie allein entscheiden. Ich glaube nicht, dass sie auf unseren Rat hören würde, wenn wir anderer Ansicht wären als sie. Du musst bedenken, dass wir uns nicht besonders gut kennen. Wir haben sie in den zweiundzwanzig Jahren, die sie jetzt verheiratet sind, höchstens einmal pro Jahr gesehen – und das meistens auch nur kurz. Wir haben das immer bedauert, denn sie macht unseren Sohn offenbar glücklich. Aber …«
Sofia hörte, dass Ulrike mit den Tränen kämpfte und fühlte sich eher noch hilfloser als zuvor. Was sagte man in einem solchen Fall? Niemand konnte wissen, wie und ob sich ein Schlaganfall-Patient wieder erholte, jeder Tröstungsversuch musste also hohl klingen. Sie versuchte es trotzdem. »Er will doch leben, Ulrike«, sagte sie, »er wird kämpfen.« Plötzlich wurde ihr bewusst, dass Moritz von Cadow nur wenig älter war als sie selbst. Mitte vierzig, hatte Ulrike einmal gesagt. Der Gedanke erschreckte sie.
»Ja, das sagen wir uns auch. Danke für deine Worte, Sofia. Wenn wir zurück sind, melde ich mich.«
Sofia saß noch mit dem Telefon in der Hand da und sah auf ihren Garten, der sich vor der Terrasse erstreckte, als ihr Mann erschien und sofort spürte, dass etwas geschehen war. Er kam zu ihr, gab ihr einen Kuss und nahm neben ihr Platz. »Schlechte Nachrichten?«, fragte er.
»Ja, von Ulrike von Cadow.«
Baron Friedrich hörte ihr ruhig zu, während sie wiedergab, was sie soeben erfahren hatte.
»Das ist natürlich bitter«, sagte er, als sie ihren Bericht beendet hatte. »Wie alt ist denn Moritz von Cadow? Etwas älter als wir, oder?«
»Seltsam, darüber habe ich eben auch nachgedacht. Ja, er ist Mitte vierzig. Er hat seine Frau damals früh kennengelernt, die beiden haben dann schnell geheiratet und bald auch ihre Tochter bekommen. Die muss jetzt auch schon zwanzig oder einundzwanzig sein. Seitdem sind sie unterwegs.«
»Ist er erblich vorbelastet?«
»Das weiß ich nicht, danach muss ich Ulrike das nächste Mal fragen. Sie wird nun sicher für unsere ehrenamtliche Arbeit erst einmal ausfallen, was ziemlich bitter ist. Mit ihr kann ich sehr gut zusammenarbeiten. Man merkt ihr nicht an, dass sie demnächst siebzig wird. Ich habe schon oft gedacht, wie schade es ist, dass wir uns erst so spät kennengelernt haben.«
»Vielleicht verläuft der Genesungsprozess ihres Sohnes besser als jetzt befürchtet.«
»Danach hat es sich nicht unbedingt angehört. Schwerer Schlaganfall, nicht schnell genug Hilfe bekommen … da macht man sich schon Sorgen.«
»Wie gut ist denn das Verhältnis zu ihrer Enkelin? Ich meine, wenn sie das Mädchen oder vielmehr die junge Frau jetzt erst einmal zu sich holen – das ist ja auch nicht ohne.«
»Sie kennen sie nicht besonders gut, genau wie ihre Schwiegertochter. Wie auch? Ulrike sagte, sie haben sich ungefähr einmal pro Jahr gesehen, und das wohl auch jedes Mal nur kurz. Da lernt man sich nicht gut kennen. Sie klang ziemlich verzweifelt, sie müssen große Angst um ihren Sohn haben.«
»Die hätten wir auch. Wenn ich mir vorstelle, Konny wäre schwer krank …«
»Bitte nicht, an so etwas möchte ich nicht einmal denken«, sagte Sofia abwehrend.
Als hätte er geahnt, dass gerade sein Name gefallen war, erschien ihr Sohn Konrad in diesem Moment auf der Terrasse.