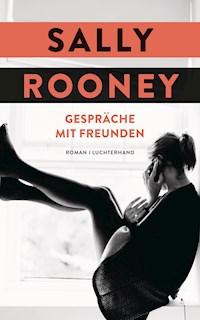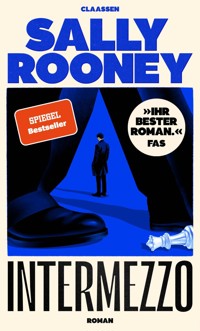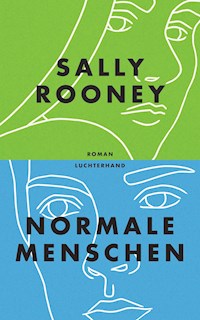9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach dem weltweiten Buch- und Serienerfolg von »Normal People«: Der Nr. 1 Bestsellerroman aus UK & USA - faszinierend, berührend und tiefsinnig! »Ein Roman, der mich mehr als einmal zu Tränen gerührt hat. Rooneys bester Roman.« The Times »Sally Rooney ist wieder ein psychologisch feinsinniges Buch über ihre Generation gelungen. I like!« Brigitte Vier junge Menschen, die einander verbunden sind, in unserer Gegenwart: Gelingt es Ihnen, an eine schöne Welt zu glauben? Alice trifft Felix. Sie ist eine erfolgreiche Schriftstellerin, er arbeitet entfremdet in einer Lagerhalle. Sie begehren einander, doch können sie einander auch trauen? Alice' beste Freundin Eileen hat eine schmerzvolle Trennung hinter sich und fühlt sich aufs Neue zu Simon hingezogen, mit dem sie seit ihrer Kindheit eng verbunden ist. Sie lieben sich, doch ist der Versuch der Liebe den möglichen Verlust ihrer Freundschaft wert? Zwischen Dublin und einem kleinen Ort an der irischen Küste entfaltet Sally Rooney eine Geschichte von vier jungen Menschen, die sich nahe sind, die einander verletzen, die sich austauschen: über Sex, über Ungleichheit und was sie mit Beziehungen macht, über die Welt, in der sie leben. Schöne Welt, wo bist du ist eine universelle Geschichte über den Raum zwischen Alleinsein und Einsamkeit und über die Freiheit, sein Leben mit anderen zu teilen – überwältigend klug, voller Klarheit und Trost. »Sprachlich überraschend, schlagfertig, ironisch, warmherzig – und ein riesiges Lesevergnügen« Anne Kohlick, Deutschlandfunk Kultur *** Für alle Sally Rooney Fans und »Normal People« Fans! ***
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Schöne Welt, wo bist du
Die Autorin
SALLY ROONEY, geboren 1991, studierte am Trinity College und lebt in Dublin. 2017 erschien ihr gefeierter Debütroman Gespräche mit Freunden. Ihr zweiter Roman Normale Menschen wurde 2018 zum weltweiten Bestseller und literarischen Ereignis – er ist die Vorlage für die international erfolgreiche TV-Serie Normal People, deren Drehbuch sie mitverfasste. Sally Rooney gehört zu den herausragendsten Autorinnen der Gegenwart und gilt als ausdrucksstärkste Stimme ihrer Generation. Schöne Welt, wo bist du ist ihr dritter Roman.
Das Buch
Alice trifft Felix. Sie ist eine erfolgreiche Schriftstellerin, er arbeitet entfremdet in einer Lagerhalle. Sie begehren einander, doch können sie einander auch trauen?Alices beste Freundin Eileen hat eine schmerzvolle Trennung hinter sich und fühlt sich aufs Neue zu Simon hingezogen, mit dem sie seit ihrer Kindheit eng verbunden ist. Sie lieben sich, doch ist der Versuch der Liebe den möglichen Verlust ihrer Freundschaft wert? Zwischen Dublin und einem kleinen Ort an der irischen Küste entfaltet Sally Rooney eine Geschichte von vier jungen Menschen, die einander nahe sind, die einander verletzen, die sich austauschen: über Sex; über soziale Ungleichheit und was sie mit Beziehungen macht; über die Welt, in der sie leben. Schöne Welt, wo bist du ist eine universelle Geschichte über den Raum zwischen Alleinsein und Einsamkeit und über die Freiheit, sein Leben mit anderen zu teilen – überwältigend klug, voller Klarheit und Trost.
Sally Rooney
Schöne Welt, wo bist du
Aus dem Englischen von Zoë Beck
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel Beautiful World, Where Are You bei Faber & Faber, London.Die Übersetzung dieses Buchs wurde von Literature Ireland gefördert.© 2021 by Sally Rooney © der deutschsprachigen Ausgabe 2021 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinCovergestaltung: : BÜRO JORGE SCHMIDT, München Umschlagillustrationen: © Sara Herranz Autorenfoto: © Kalpesh LathigraISBN: 978-3-8437-2547-7
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Danksagung
Quellennachweis
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
Motto
»Wenn ich etwas schreibe, denke ich meist, daß es sehr wichtig ist und daß ich eine sehr große Schriftstellerin bin. Ich glaube, das geht allen so. Aber es gibt einen Winkel in meiner Seele, in dem ich sehr wohl und immer weiß, was ich bin, nämlich eine ganz kleine Schriftstellerin. Ich schwöre, daß ich es weiß. Aber es kümmert mich nicht weiter.«
Natalia Ginzburg, »Mein Beruf«
1
Eine Frau saß in einer Hotelbar und behielt die Tür im Auge. Ihre Erscheinung war ordentlich und gepflegt: weiße Bluse, das blonde Haar hinter die Ohren gestrichen. Sie warf einen Blick auf ihr Telefon, das einen Chatverlauf anzeigte, und sah dann wieder zur Tür. Es war Ende März, die Bar war ruhig, und vor dem Fenster rechts von ihr ging gerade die Sonne über dem Atlantik unter. Es war vier Minuten nach sieben, dann fünf, dann sechs. Kurz und ohne erkennbares Interesse betrachtete sie ihre Fingernägel. Um acht Minuten nach sieben trat ein Mann durch die Tür. Er war schlank und dunkelhaarig und hatte ein schmales Gesicht. Er sah sich um, scannte die Gesichter der anderen Gäste, zog dann sein Telefon hervor und checkte die Nachrichten. Die Frau am Fenster bemerkte ihn, aber abgesehen davon, dass sie ihn beobachtete, unternahm sie keine weiteren Anstrengungen, um seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie schienen ungefähr im gleichen Alter zu sein, Ende zwanzig oder Anfang dreißig. Sie ließ ihn dort stehen, bis er sie sah und zu ihr kam.
Bist du Alice?, fragte er.
Bin ich, antwortete sie.
Okay, ich bin Felix. Tut mir leid, ich bin zu spät.
Sie erwiderte sanft: Schon in Ordnung. Er fragte, was sie trinken wolle, und ging dann zur Bar, um zu bestellen. Die Bedienung erkundigte sich, wie es ihm ging, und er antwortete: Gut, und selbst? Er bestellte einen Wodka Tonic und ein Lager. Statt die Flasche Tonic Water mit an den Tisch zu nehmen, leerte er sie mit einer schnellen, geübten Bewegung ins Glas. Die Frau am Tisch trommelte mit den Fingern auf einen Bierdeckel und wartete. Seit der Mann den Raum betreten hatte, wirkte sie aufmerksamer und munterer. Sie sah jetzt nach dem Sonnenuntergang, als fände sie ihn interessant, obwohl sie ihm vorher keine Beachtung geschenkt hatte. Als der Mann zurückkam und die Getränke abstellte, schwappte das Lager etwas über, und sie beobachtete, wie ein Tropfen schnell am Glas herablief.
Du hast gesagt, du wärst gerade erst hergezogen, sagte er. Stimmt das?
Sie nickte, nahm einen Schluck, leckte sich die Oberlippe.
Und warum?, fragte er.
Wie meinst du das?
Ich meine, es gibt nicht so viele Leute, die hierherziehen. Normalerweise ziehen die Leute eher weg. Du bist wohl kaum wegen der Arbeit hier, oder?
Oh. Nein, nicht wirklich.
Ein flüchtiger Blick zwischen ihnen zeigte, dass er wohl eine ausführlichere Antwort erwartete. Ein Flackern huschte über ihr Gesicht, als versuchte sie, eine Entscheidung zu treffen, dann lächelte sie ungezwungen, fast schon konspirativ.
Na ja, ich wollte sowieso umziehen, sagte sie, und dann hörte ich von einem Haus hier etwas außerhalb der Ortschaft – eine Freundin von mir kennt die Besitzer. Offenbar versuchen sie schon ewig, es zu verkaufen, und jetzt haben sie nach jemandem gesucht, der in der Zwischenzeit dort wohnt. Jedenfalls dachte ich, es wäre nett, am Meer zu leben. Ein bisschen impulsiv wahrscheinlich, aber – na ja, das ist die ganze Geschichte, es gibt keinen anderen Grund.
Er trank und hörte ihr zu. Gegen Ende ihrer Bemerkungen schien sie etwas nervös geworden zu sein, was sich in Kurzatmigkeit und einem selbstironischen Gesichtsausdruck äußerte. Gelassen betrachtete er ihre Darbietung und stellte dann sein Glas ab.
Ah, okay, sagte er. Und vorher warst du in Dublin, oder?
Nicht nur. Ich war eine Weile in New York. Ich bin eigentlich aus Dublin, das hab ich dir, glaube ich, geschrieben. Aber bis letztes Jahr habe ich in New York gelebt.
Und was willst du hier machen? Suchst du einen Job oder so?
Sie zögerte. Er lächelte und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, ließ sie dabei nicht aus den Augen.
Tut mir leid, dass ich so viel frage, sagte er. Ich versteh das alles noch nicht so ganz.
Nein, schon in Ordnung. Aber ich bin nicht so gut darin, Fragen zu beantworten, wie du merkst.
Als was arbeitest du denn? Das ist meine letzte Frage.
Sie lächelte zurück, jetzt angespannter. Ich bin Schriftstellerin, sagte sie. Und du? Erzähl doch mal, was du so machst.
Ach, nichts so Außergewöhnliches. Ich würde gern wissen, worüber du schreibst, aber ich werde nicht fragen. Ich arbeite in einem Warenlager etwas außerhalb.
Und was machst du da?
Tja, was mache ich da, wiederholte er philosophisch. Ich hole die Bestellungen aus den Regalen und lege sie in einen Wagen und bringe sie nach vorn, wo sie eingepackt werden. Nicht sehr aufregend.
Das heißt, es gefällt dir nicht?
O Gott, nein, sagte er. Ich hasse diesen Scheißladen. Aber man bezahlt mir kein Geld für etwas, das mir Spaß macht, oder? Das ist das Problem mit der Arbeit, würde sie einem gefallen, würde man sie umsonst machen.
Stimmt, sagte sie und lächelte. Draußen vorm Fenster war der Himmel dunkler geworden, und unten auf dem Campingplatz gingen die Lichter an: das kühle, kristallene Schimmern der Außenleuchten und das wärmere, gelbe Licht in den Fenstern. Die Bedienung war hinter der Bar hervorgekommen und wischte die leeren Tische mit einem Tuch ab. Die Frau, Alice, sah ihr ein paar Sekunden lang zu und richtete dann wieder den Blick auf den Mann.
Und was macht man hier so, um Spaß zu haben?, fragte sie.
Dasselbe wie überall sonst auch. Ein paar Pubs. Ein Club unten in Ballina, gut zwanzig Minuten mit dem Auto von hier. Und es gibt natürlich die Freizeitparks, aber die sind eher für Kinder. Ich nehme an, du hast hier in der Gegend keine Freunde, oder?
Ich glaube, du bist der erste Mensch, mit dem ich mich unterhalte, seit ich hergezogen bin.
Er hob die Augenbrauen. Bist du schüchtern?, fragte er.
Sag du’s mir.
Sie sahen sich an. Jetzt wirkte sie nicht mehr nervös, sondern irgendwie unnahbar, während sein Blick über ihr Gesicht glitt, als versuchte er, etwas zusammenzufügen, eine Sekunde, zwei – doch er schien nicht davon überzeugt zu sein, dass es ihm gelungen war.
Könnte sein, sagte er.
Sie fragte ihn, wo er wohne, und er sagte, in einem Haus ganz in der Nähe, zur Miete, zusammen mit ein paar Freunden. Mit einem Blick aus dem Fenster fügte er hinzu, man könne das Grundstück von da, wo sie saßen, fast sehen, direkt hinter dem Campingplatz. Er beugte sich über den Tisch und versuchte, es ihr zu zeigen, aber dann sagte er, es sei doch schon zu dunkel. Jedenfalls gleich dort drüben, auf der anderen Seite. Während er ihr so nah war, trafen sich ihre Blicke. Sie sah schnell auf ihren Schoß, und als er sich wieder hinsetzte, schien er ein Lächeln zu unterdrücken. Sie fragte ihn, ob seine Eltern noch in der Gegend wohnten. Er sagte, seine Mutter sei im letzten Jahr gestorben, und sein Vater sei »Gott weiß wo«.
Ich meine, fairerweise sollte ich sagen, er ist wahrscheinlich in einer Stadt wie Galway, fügte er hinzu. Er wird vermutlich nicht eines Tages in Argentinien oder so auftauchen. Aber ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen.
Tut mir leid mit deiner Mutter, sagte sie.
Ja. Danke.
Ich habe meinen Vater eigentlich auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Er ist – nicht sehr zuverlässig.
Felix sah von seinem Glas auf. Oh?, sagte er. Trinkt er?
Mhm. Und er – na ja, er denkt sich Geschichten aus.
Felix nickte. Ich dachte, das wäre dein Job, sagte er.
Bei dieser Bemerkung wurde sie rot, was ihn zu überraschen und sogar zu beunruhigen schien. Sehr witzig, sagte sie. Egal. Willst du noch was trinken?
Nach dem zweiten tranken sie ein drittes Glas. Er fragte, ob sie Geschwister habe, sie sagte ja, einen jüngeren Bruder. Er sagte, er habe auch einen Bruder. Am Ende des dritten Drinks war Alice’ Gesicht gerötet, und ihr Blick glasig und strahlend. Felix sah exakt so aus wie zu dem Zeitpunkt, als er die Bar betreten hatte, die gleiche Haltung, der gleiche Ton. Aber während ihr Blick zunehmend durch den Raum wanderte und ein diffuseres Interesse an ihrer Umgebung erkennen ließ, wurde die Aufmerksamkeit, die er ihr schenkte, eindringlicher und entschlossener. Um sich abzulenken, ließ sie das Eis in ihrem leeren Glas klirren.
Möchtest du dir mein Haus anschauen?, fragte sie. Ich will schon die ganze Zeit damit angeben, aber ich kenne hier niemanden, den ich einladen könnte. Ich meine, ich werde natürlich meine Freunde einladen. Aber sie sind alle woanders.
In New York.
Die meisten in Dublin.
Wo ist denn das Haus, fragte er, können wir hinlaufen?
Auf jeden Fall. Das müssen wir sogar. Ich kann nicht fahren, du?
Nicht im Moment, nein. Jedenfalls würde ich das nicht riskieren. Aber ich habe einen Führerschein, doch.
Ach wirklich, murmelte sie. Wie romantisch. Willst du noch was trinken, oder sollen wir los?
Er runzelte die Stirn über die Frage oder darüber, wie sie formuliert war, oder über den Gebrauch des Wortes »romantisch«. Sie wühlte in ihrer Handtasche, ohne aufzusehen.
Ja, lass uns los, warum nicht, sagte er.
Sie stand auf und zog ihren Mantel an, einen beigefarbenen einreihigen Regenmantel. Er sah zu, wie sie den Aufschlag eines Ärmels umkrempelte, damit er zu dem anderen passte. Als sie aufrecht stand, war er nur wenig größer als sie.
Wie weit ist es?, fragte er.
Sie lächelte ihn spielerisch an. Überlegst du es dir anders?, fragte sie. Wenn du keine Lust mehr hast zu laufen, kannst du mich jederzeit stehen lassen und umkehren, ich bin es gewohnt. Das Laufen, meine ich. Nicht stehen gelassen zu werden. Es könnte sein, dass ich daran auch gewöhnt bin, aber das ist nichts, was ich einem Fremden anvertrauen würde.
Darauf erwiderte er rein gar nichts, er nickte nur mit einem flüchtigen Ausdruck düsterer Nachsicht, als hätte er nach ein oder zwei Stunden Unterhaltung beschlossen, diesen Teil ihrer Persönlichkeit, ihre Tendenz, »witzig« und ausschweifend zu sein, zu ignorieren. Beim Rausgehen verabschiedete er sich von der Bedienung. Alice stutzte und sah sich um, als wollte sie die Frau noch einmal betrachten. Draußen auf dem Gehweg fragte sie ihn, ob er sie kenne. Die Wellen rauschten tief und ruhig hinter ihnen, und die Luft war kalt.
Die Frau, die dort arbeitet?, fragte Felix. Ja, ich kenne sie. Sinead. Warum?
Sie wird sich fragen, warum du dich da drin mit mir unterhalten hast.
In flachem Ton erwiderte Felix: Ich vermute mal, sie hat da schon den richtigen Eindruck. In welche Richtung müssen wir?
Alice schob die Hände in die Taschen ihres Regenmantels und schlug den Weg ein, der den Hügel hinaufführte. Sie schien eine Art Herausforderung, vielleicht sogar Ablehnung in seinem Tonfall erkannt zu haben, und anstatt eingeschüchtert zu sein, wirkte sie nur entschlossener.
Warum? Triffst du dich dort oft mit Frauen?, fragte sie.
Er musste sich beeilen, um mit ihr Schritt zu halten. Das ist eine seltsame Frage, antwortete er.
Wirklich? Ich vermute mal, dass ich ein seltsamer Mensch bin.
Geht es dich was an, ob ich mich hier mit Leuten treffe?, fragte er.
Natürlich nicht, das ist deine Sache. Ich bin nur neugierig.
Er schien darüber nachzudenken und wiederholte währenddessen in einem leiseren, weniger sicheren Ton: Ja, aber ich wüsste nicht, was dich das angeht. Nach ein paar Sekunden fügte er hinzu: Du hast das Hotel vorgeschlagen. Nur um das mal klarzustellen. Ich gehe da normalerweise nicht hin. Also nein, ich treffe mich dort nicht sehr oft mit Leuten. Okay?
Schon okay, schon gut. Ich bin nur neugierig geworden wegen deiner Bemerkung über die Frau hinter der Bar, sie habe den »richtigen Eindruck« davon, warum wir dort waren.
Na ja, ich bin mir sicher, sie hat sich zusammengereimt, dass wir ein Date hatten, sagte er. Mehr meinte ich nicht.
Obwohl sie sich nicht zu ihm umdrehte, zeichnete sich auf Alice’ Gesicht mehr Erheiterung ab als zuvor, oder eine andere Art von Erheiterung. Es stört dich nicht, wenn dich Leute, die du kennst, bei einem Date mit einer Fremden sehen?, fragte sie.
Du meinst, weil es peinlich ist oder so? Stört mich nicht, nein.
Den Rest des Weges entlang der Küstenstraße zu Alice’ Haus unterhielten sie sich über Felix’ Sozialleben, oder vielmehr stellte Alice einige Fragen zu dem Thema, die er sich durch den Kopf gehen ließ und beantwortete. Beide sprachen lauter als zuvor, um das Rauschen des Meeres zu übertönen. Er offenbarte keinerlei Überraschung angesichts ihrer Fragen und antwortete bereitwillig, wenn auch knapp und ohne irgendetwas preiszugeben, was sie nicht direkt einforderte. Er sagte, dass er sich in erster Linie mit Leuten traf, die er aus der Schule oder von der Arbeit kannte. Die beiden Kreise überschnitten sich etwas, aber nicht sehr. Er stellte ihr seinerseits keine Fragen, vielleicht hatten ihn ihre vorsichtigen Antworten zu Beginn ihrer Unterhaltung befangen gemacht, vielleicht war er auch einfach nicht mehr interessiert.
Gleich hier, sagte sie schließlich.
Wo?
Sie drückte die Klinke eines kleinen weißen Tors herunter und sagte: Hier. Er blieb stehen und sah auf das Haus vor ihnen, das sich am Ende eines ansteigenden Gartens befand. Keines der Fenster war erleuchtet, und die Fassade des Hauses ließ sich nicht im Detail erkennen, aber seinem Gesicht war abzulesen, dass er wusste, wo sie waren.
Du wohnst im alten Pfarrhaus?, fragte er.
Oh, ich wusste nicht, dass du es kennst. Sonst hätte ich es dir in der Bar erzählt, ich wollte kein Geheimnis daraus machen.
Sie hielt ihm das Tor auf, und er folgte ihr, den Blick noch immer auf das Haus gerichtet, das über ihnen aufragte, dem Meer zugewandt. Um sie herum raschelten die Blätter der Pflanzen im Wind. Mit leichtem Schritt ging sie den Pfad hinauf und suchte in ihrer Handtasche nach den Hausschlüsseln. Sie waren irgendwo in der Tasche zu hören, aber sie schien sie nicht finden zu können. Er stand da, ohne ein Wort zu sagen. Sie entschuldigte sich für die Verzögerung und schaltete die Taschenlampenfunktion ihres Handys ein, leuchtete in ihre Tasche und warf dabei kaltes graues Licht auf die Stufen des Hauses. Er hatte die Hände in den Taschen. Hab sie, sagte sie. Dann schloss sie die Tür auf.
Innen war ein langer Flur mit rot und schwarz gemusterten Bodenfliesen. Ein Lampenschirm aus marmoriertem Glas hing an der Decke, und ein filigraner, graziler Tisch mit Schnitzereien von Ottern stand an der Wand. Sie ließ die Schlüssel auf den Tisch fallen und warf einen schnellen Blick in den trüben, fleckigen Wandspiegel.
Du wohnst hier allein?, fragte er.
Ich weiß, sagte sie. Es ist natürlich viel zu groß. Und es kostet mich ein Vermögen, es zu heizen. Aber es ist nett, oder? Und ich muss keine Miete zahlen. Gehen wir in die Küche? Ich schalte die Heizung wieder an.
Er folgte ihr den Flur entlang in eine große Küche mit Einbauten auf der einen Seite und einem Esstisch auf der anderen. Über dem Spülbecken war ein Fenster, das zum hinteren Garten hinausging. Er blieb in der Tür stehen, während sie in einem der Schränke nach etwas suchte. Sie drehte sich zu ihm um.
Du kannst dich setzen, wenn du magst. Oder bleib stehen, wenn dir das lieber ist. Möchtest du ein Glas Wein? Es ist das Einzige, was ich zu trinken im Haus habe. Aber ich brauche erst mal ein Glas Wasser.
Was für Sachen schreibst du? Wenn du eine Schriftstellerin bist.
Sie drehte sich verwirrt um. Wenn ich eine bin?, fragte sie. Ich nehme mal nicht an, du denkst, ich hätte dich angelogen. In dem Fall hätte ich mir was Besseres ausgedacht. Ich bin Schriftstellerin. Ich schreibe Bücher.
Und verdienst du damit Geld?
Sie warf ihm einen Blick zu, als würde sie eine neue Gewichtigkeit in der Frage wittern, und goss sich ein Glas Wasser ein. Ja, sagte sie. Er ließ sie nicht aus den Augen und setzte sich an den Tisch. Die gepolsterten Sitzflächen der Stühle waren mit knittrigem, rostrotem Stoff bezogen. Alles wirkte sehr sauber. Er rieb mit dem Zeigefinger über die glatte Tischfläche. Sie stellte ihm ein Glas Wasser hin und setzte sich auf einen der Stühle.
Warst du schon mal hier?, fragte sie. Du scheinst das Haus zu kennen.
Nein, ich kenne es nur, weil ich hier im Ort groß geworden bin. Ich wusste nie, wer hier wohnt.
Ich kenne sie selbst kaum. Ein älteres Paar. Die Frau ist Künstlerin, glaube ich.
Er nickte und sagte nichts.
Ich kann dich rumführen, wenn du magst, fügte sie hinzu.
Er sagte immer noch nichts, und diesmal nickte er nicht einmal. Sie wirkte dadurch nicht verunsichert. Es schien einen Verdacht, der in ihr keimte, zu bestätigen, und als sie weitersprach, tat sie es in demselben trockenen, fast schon sarkastischen Tonfall.
Du denkst wahrscheinlich, ich muss verrückt sein, hier allein zu wohnen, sagte sie.
Mietfrei, willst du mich verarschen?, erwiderte er. Du wärst verrückt, wenn du’s nicht tun würdest. Er gähnte unbefangen und sah aus dem Fenster oder vielmehr auf das Fenster, da es draußen mittlerweile dunkel war und die Scheibe nur das Innere des Raumes reflektierte. Wie viele Schlafzimmer hat es, nur so aus Neugier?, fragte er.
Vier.
Wo ist deins?
Als Reaktion auf diese unerwartete Frage veränderte sie zunächst nicht ihren Blick, sondern starrte ein paar Sekunden lang weiter konzentriert auf ihr Wasserglas, bevor sie ihn direkt ansah. Oben, sagte sie. Sie sind alle oben. Soll ich’s dir zeigen?
Warum nicht, sagte er.
Sie standen vom Tisch auf. Im oberen Flur lag ein türkischer Läufer mit grauen Fransen. Alice öffnete die Tür zu ihrem Zimmer und schaltete eine kleine Bodenlampe ein. Links stand ein großes Doppelbett. Der Boden hatte abgezogene Dielen, und an einer Wand befand sich ein mit jadefarbenen Kacheln gefliester Kamin. Rechts war ein großes Schiebefenster mit Blick aufs Meer, in die Dunkelheit. Felix schlenderte zum Fenster und lehnte sich so nahe an die Scheibe, dass sein eigener Schatten den Schein des reflektierten Lichts verhüllte.
Das muss tagsüber eine schöne Aussicht sein, sagte er.
Alice stand noch immer in der Tür. Ja, sie ist schön, sagte sie. Abends ist sie eigentlich sogar noch besser.
Er wandte sich vom Fenster ab, ließ einen abschätzenden Blick über die Details des Zimmers wandern, während Alice ihm zusah.
Sehr schön, schloss er. Sehr schönes Zimmer. Hast du vor, ein Buch zu schreiben, während du hier bist?
Ich werde es wohl versuchen.
Und worum geht’s in deinen Büchern?
Oh, keine Ahnung, sagte sie. Leute.
Das ist ein bisschen vage. Was für Leute denn? Leute wie du?
Sie sah ihn ruhig an, als würde sie ihm etwas mitteilen wollen: vielleicht, dass sie sein Spiel verstand und dass sie ihn sogar gewinnen ließe, solange er nett war.
Was glaubst du denn, wie ich bin?, fragte sie.
Etwas in ihrem ruhigen, kühlen Blick schien ihn zu verunsichern, und er lachte auf. Ähm, na ja, sagte er. Ich habe dich ja erst vor ein paar Stunden kennengelernt, ich weiß noch nicht so genau, was ich über dich denke.
Du lässt es mich dann hoffentlich wissen, wenn es so weit ist.
Vielleicht.
Ein paar Sekunden lang stand sie ganz still im Raum, während er ein wenig herumschlenderte und so tat, als würde er sich etwas ansehen. Sie wussten beide, was geschehen würde, auch wenn keiner von ihnen hätte sagen können, woher sie es wussten. Sie wartete ohne sichtliches Interesse, während er sich weiter im Zimmer umsah, bis er sich schließlich, vielleicht, weil ihm die Energie fehlte, das Unausweichliche weiterhin aufzuschieben, bei ihr bedankte und ging. Sie brachte ihn die Treppe hinunter – einen Teil des Wegs. Sie stand auf den Stufen, als er durch die Tür trat. Es war so eine Sache. Hinterher fühlten sie sich beide schlecht, und sie waren sich gleichermaßen unsicher, warum sich der Abend letztlich als ein solcher Reinfall herausgestellt hatte. Allein stand sie am Fuß der Treppe. Dann drehte sie sich um und sah hinauf zum Treppenabsatz. Folge jetzt ihrem Blick durch die halb offen stehende Schlafzimmertür auf den Streifen weißer Wand zwischen den Pfosten des Geländers.
2
Liebe Eileen. Ich habe so lange auf deine Antwort auf meine letzte Mail gewartet, dass ich dir jetzt tatsächlich – stell dir vor! – eine neue schreibe, bevor du geantwortet hast. Zu meiner Verteidigung, ich habe mittlerweile zu viel Material gesammelt, und wenn ich noch länger warte, fange ich an, Sachen zu vergessen. Du musst wissen, dass unsere Korrespondenz meine Art ist, das Leben festzuhalten, mir Notizen zu machen und dadurch etwas von meiner – ansonsten fast wertlosen oder sogar vollkommen wertlosen – Existenz auf diesem rapide degenerierenden Planeten zu bewahren … Dieser Absatz ist hauptsächlich dazu da, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil du mir noch nicht geantwortet hast, und dich dieses Mal zu einer rascheren Antwort zu nötigen. Was machst du überhaupt, wenn du mir nicht mailst? Sag nicht, du arbeitest.
Ich werde wahnsinnig, wenn ich an die Miete denke, die du in Dublin zahlst. Weißt du, dass es dort jetzt teurer ist als in Paris? Und verzeih mir, aber alles, was Paris hat, fehlt Dublin. Eines der Probleme ist, dass Dublin – und ich meine das wortwörtlich und topografisch – flach ist. Alles muss auf einer einzigen Ebene stattfinden. Andere Städte haben U-Bahn-Netze, was ihnen Tiefe verleiht, und steile Hügel oder Wolkenkratzer für die Höhen, aber Dublin hat nur niedrige, gedrungene, graue Gebäude und Trambahnen, die durch die Straßen fahren. Und es gibt keine Innenhöfe oder Dachgärten wie in Städten auf dem Kontinent, was wenigstens die Oberfläche aufbräche – wenn schon nicht vertikal, dann zumindest konzeptionell. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Selbst wenn nicht, ist es dir vielleicht unbewusst aufgefallen. Es ist schwer, in Dublin sehr weit hoch zu kommen oder sehr tief runter, schwer, sich selbst oder andere zu verlieren oder ein Gefühl für Perspektive zu bekommen. Man könnte das für demokratisch halten, eine Stadt so zu organisieren – sodass alles von Angesicht zu Angesicht geschieht, quasi auf Augenhöhe. Es stimmt schon, niemand schaut von oben auf einen herab. Aber es weist dem Himmel eine Position vollständiger Dominanz zu. Nirgendwo ist der Himmel sinnstiftend durchbrochen oder von irgendetwas aufgelockert. The Spire, könntest du jetzt einwerfen, und klar, den Spire gibt es, doch schmaler könnte die Unterbrechung nicht sein, und er ragt wie ein Zollstock in die Höhe, als würde er die Winzigkeit aller anderen Gebäude um ihn herum demonstrieren wollen. Die totalisierende Wirkung des Himmels ist schlecht für die Leute. Nichts schiebt sich jemals vor ihn und blendet ihn aus. Er ist wie ein Memento mori. Ich wünsche mir, jemand würde ein Loch für dich hineinschneiden.
Letztens habe ich über rechte Politik nachgedacht (haben wir das nicht alle), und wie es kommt, dass Konservatismus (als gesellschaftliche Kraft) mit habgierigem Marktkapitalismus assoziiert wird. Die Verbindung ist nicht offensichtlich, jedenfalls nicht für mich, weil Märkte nichts bewahren, sondern alle Aspekte einer existierenden gesellschaftlichen Landschaft in sich aufnehmen und als Transaktion wieder ausscheiden, jeglicher Bedeutung und Erinnerung beraubt. Was könnte an einem solchen Prozess »konservativ« sein? Aber ich habe auch den Eindruck, dass die Idee des »Konservatismus« an sich falsch ist, weil nichts als solches bewahrt werden kann – ich meine, die Zeit bewegt sich nur in eine Richtung. Dieser Gedanke ist so elementar, dass ich mir sehr klug vorkam, als ich ihn das erste Mal hatte, um mich dann sofort zu fragen, ob ich eine Idiotin sei. Aber ergibt das für dich einen Sinn? Wir können nichts bewahren, insbesondere nicht gesellschaftliche Beziehungen, ohne ihr Wesen zu verändern, ohne auf unnatürliche Weise einen Teil ihres Zusammenspiels mit der Zeit auszubremsen. Sieh dir nur mal an, was die Konservativen mit der Umwelt machen: Deren Vorstellung von Bewahren ist es, zu entziehen, zu plündern und zu zerstören, »weil wir das schon immer so gemacht haben« – aber genau deswegen handelt es sich nicht mehr um dieselbe Erde, der wir dies antun. Ich vermute, du denkst, dass das alles extrem rudimentär ist und hältst mich vielleicht sogar für undialektisch. Aber das sind nur die abstrakten Gedanken, die ich hatte und aufschreiben musste und als deren (willige oder unwillige) Empfängerin du dich nun wiederfindest.
Ich war heute im örtlichen Laden, um mir etwas zum Mittagessen zu kaufen, als mich mit einem Mal ein sehr merkwürdiges Gefühl überkam – die spontane Erkenntnis, wie unpassend dieses Leben ist. Ich meine, ich dachte an den ganzen Rest der menschlichen Population – die zum größten Teil in Umständen lebt, die du und ich bitterste Armut nennen würden –, der noch nie so einen Laden gesehen oder betreten hat. Und deren Arbeit genau das aufrechterhält – genau diesen Lifestyle von Leuten wie uns! All die verschiedenen Softdrinks in Plastikflaschen, all die vorportionierten Mittagsmenüs und Süßigkeiten in luftdichten Verpackungen und aufgebackenen Fertigteile – darin kulminiert sie, die gesamte Arbeit dieser Welt, das ganze Verheizen von fossilen Brennstoffen und die ganze Knochenarbeit auf den Kaffeefeldern und Zuckerplantagen. Alles dafür! Für diesen Minimarkt! Mir wurde schwindlig, als ich darüber nachdachte. Ich meine, mir war richtig elend. Es war, als würde mir mit einem Mal wieder einfallen, dass mein Leben Teil einer Fernsehshow ist und dass jeden Tag Menschen sterben, um diese Show zu produzieren, dass sie auf grauenhafteste Weise zu Tode kommen, Kinder, Frauen, und alles nur, damit ich zwischen verschiedenen Lunchoptionen wählen kann, die alle in mehreren Schichten Einwegplastik verpackt sind. Dafür sterben sie – das ist das große Experiment. Ich dachte, ich müsste mich übergeben. Natürlich kann so ein Gefühl nicht andauern. Ich fühle mich vielleicht noch den Rest des Tages schlecht, den Rest der Woche sogar – und dann? Ich muss mir trotzdem was zu essen kaufen. Und falls du dir Sorgen um mich machst, lass dir versichert sein: Klar habe ich mir was gekauft.
Noch ein Update zu meinem Landleben, und dann mach ich Schluss. Das Haus ist unübersichtlich groß, so als würde es ständig spontan neue, zuvor unbemerkte Räume produzieren. Es ist außerdem kalt und an manchen Stellen feucht. Ich wohne zwanzig Minuten zu Fuß von dem bereits erwähnten Laden entfernt, und es fühlt sich an, als würde ich die meiste Zeit damit zubringen, hin und her zu laufen, um Sachen zu kaufen, die ich beim letzten Mal vergessen habe. Wahrscheinlich verändert mich das tiefgreifend, und wenn wir uns dann wiedersehen, werde ich eine unfassbare Persönlichkeit ausgebildet haben. Vor ungefähr zehn Tagen hatte ich ein Date mit jemandem, der im Warenlager eines Versandhandels arbeitet, und er fand mich schrecklich. Um ehrlich zu sein (und das bin ich immer), ich glaube, ich habe mittlerweile vergessen, wie man sozialen Umgang pflegt. Ich wage nicht, mir vorzustellen, was für Grimassen ich gezogen haben muss bei dem angestrengten Versuch, wie ein Mensch zu wirken, der regelmäßig mit anderen Menschen zu tun hat. Sogar beim Schreiben dieser Mail fühle ich mich ein wenig haltlos und dissoziativ. Es gibt ein Rilke-Gedicht, das wie folgt endet: »Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, / wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben / und wird in den Alleen hin und her / unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.« Eine bessere Beschreibung für meine gegenwärtige Lage könnte ich mir nicht ausdenken, abgesehen davon, dass es April ist und nirgendwo Blätter treiben. Verzeih also den »langen Brief«. Ich hoffe, du kommst mich mal besuchen. Alles, alles, alles Liebe, Alice.
3
An einem Mittwochnachmittag um zwanzig nach zwölf saß eine Frau hinter einem Schreibtisch in einem Großraumbüro in der Dubliner Innenstadt und scrollte durch ein Textdokument. Sie hatte sehr dunkles Haar, das sie locker mit einer Schildpattspange zusammenhielt, und sie trug einen dunkelgrauen Sweater, der in einer schwarzen Zigarettenhose steckte. Mit dem weichen, speckigen Rädchen ihrer Computermaus bewegte sie sich durch das Dokument, ihr Blick glitt zwischen den engen Textspalten hin und her, gelegentlich hielt sie inne, klickte, fügte Zeichen hinzu oder löschte sie. Meistens fügte sie zwei Punkte in den Namen »WH Auden« ein, um ihn zu »W.H. Auden« zu vereinheitlichen. Als sie das Ende des Dokuments erreichte, öffnete sie die Suchfunktion, wählte »Groß- / Kleinschreibung beachten« und suchte WH. Die Suche ergab keine Treffer. Sie scrollte zum Anfang des Dokuments, Wörter und Absätze flogen so schnell vorbei, dass sie mit ziemlicher Sicherheit unlesbar waren, und dann speicherte sie, offenbar zufrieden, ihre Arbeit und schloss die Datei.
Um eins sagte sie zu ihren Kolleginnen, sie würde jetzt mittagessen gehen, und sie lächelten und winkten hinter ihren Monitoren. Sie zog eine Jacke an, ging zu einem Café in der Nähe des Büros und setzte sich an einen Tisch am Fenster. Mit einer Hand aß sie ein Sandwich, in der anderen hielt sie den Roman, den sie las, Die Brüder Karamasow. Ab und zu legte sie das Buch ab, wischte sich Hände und Mund mit einer Papierserviette ab, sah sich im Raum um, als wollte sie prüfen, ob irgendjemand zu ihr hinsah, und widmete sich wieder ihrem Buch. Um zwanzig vor zwei blickte sie auf und sah, wie ein großer, blonder Mann das Café betrat. Er trug Anzug und Krawatte, hatte ein Umhängeband aus Plastik um den Hals und sprach in ein Handy. Ja, sagte er, mir hat man Dienstag gesagt, aber ich rufe zurück und checke das für dich. Als er die Frau bemerkte, die am Fenster saß, veränderte sich sein Gesichtsausdruck, schnell hob er seine freie Hand und formte das Wort »Hey« mit den Lippen. Ins Telefon sagte er: Ich glaube nicht, dass du in cc warst, nein. Zur Frau hin deutete er ungeduldig auf sein Handy und machte mit den Fingern eine Blabla-Geste. Sie lächelte, spielte an der Ecke einer Seite ihres Buchs herum. Genau, genau, sagte der Mann. Hör zu, ich bin jetzt eigentlich schon aus dem Büro raus, aber ich kümmere mich drum, wenn ich wieder zurück bin. Ja. Gut, gut, hat mich gefreut.
Der Mann beendete das Gespräch und kam zu ihrem Tisch herüber. Sie musterte ihn von oben bis unten und sagte: Simon, du siehst so wichtig aus, ich mache mir Sorgen, dass jemand einen Anschlag auf dich verübt. Er hob sein Umhängeband an und betrachtete es. Das liegt an diesem Ding, sagte er. Es gibt mir das Gefühl, dass ich es verdient hätte. Darf ich dir einen Kaffee ausgeben? Sie sagte, sie müsse zurück zur Arbeit. Wie wär’s, sagte er, wenn ich dir einen zum Mitnehmen kaufe und dich zum Büro begleite? Ich brauch mal deine Meinung. Sie klappte ihr Buch zu und sagte Ja. Während er zur Theke ging, stand sie auf und wischte die Sandwichkrümel weg, die ihr in den Schoß gefallen waren. Er bestellte zwei Kaffee, einen mit Milch und einen schwarz, und warf ein paar Münzen in den Becher für das Trinkgeld. Die Frau gesellte sich zu ihm, nahm die Spange aus dem Haar und machte sie wieder fest. Wie war’s noch bei Lolas Anprobe?, fragte der Mann. Die Frau sah auf, ihre Blicke trafen sich, und sie gab einen seltsamen, unterdrückten Laut von sich. Ganz okay, sagte sie. Meine Mutter ist in der Stadt, wir treffen uns alle morgen, um Hochzeitsoutfits zu kaufen.
Er lächelte wohlwollend und verfolgte die Fortschritte, die der Kaffee hinter der Theke machte. Lustig, sagte er. Ich hatte gestern Nacht einen schlechten Traum, du hast geheiratet.
Was war so schlecht daran?
Du hast nicht mich geheiratet.
Die Frau lachte. Sprichst du so auch mit den Frauen bei dir auf der Arbeit?, fragte sie.
Belustigt drehte er sich wieder zu ihr und antwortete: O Gott, nein, da würde ich richtig Ärger bekommen. Zu Recht. Nein, ich flirte nie mit jemandem auf der Arbeit. Wenn überhaupt, flirten sie mit mir.
Ich vermute, wir reden über Frauen mittleren Alters, die wollen, dass du ihre Töchter heiratest.
Ich kann diese negativen kulturellen Bilder von Frauen mittleren Alters nicht teilen. Von allen demografischen Gruppen mag ich sie tatsächlich am liebsten.
Was ist verkehrt an jungen Frauen?
Sie sind einfach ein bisschen …
Er machte mit der Hand eine abwägende Geste, um Reibung, Unsicherheit, sexuelle Chemie, Unentschiedenheit oder vielleicht Durchschnittlichkeit anzudeuten.
Deine Freundinnen sind nie mittleren Alters, gab die Frau zu bedenken.
Und ich bin es auch noch nicht, vielen Dank.
Auf dem Weg nach draußen hielt der Mann die Tür für die Frau auf, damit sie durchgehen konnte, was sie auch tat, ohne ihm zu danken. Was wolltest du mich denn fragen?, wollte sie wissen. Sie gingen die Straße entlang zu ihrem Büro, und er sagte, er bräuchte ihren Rat, weil sich ein Problem zwischen zwei Personen, mit denen er befreundet war, ergeben hätte. Die Frau schien beide namentlich zu kennen. Sie hatten in einer WG zusammengelebt und waren dann eine unklare sexuelle Beziehung miteinander eingegangen. Nach einer Weile war die eine Person mit jemand anderem zusammengekommen, und die andere Person, die noch immer Single war, wollte aus der Wohnung ausziehen, hatte aber kein Geld und wusste nicht, wohin. Eher ein emotionales als ein Wohnungsproblem, sagte die Frau. Der Mann pflichtete ihr bei, fügte aber hinzu: Ich denke trotzdem, dass es für sie gut wäre, auszuziehen. Ich meine, sie kann die beiden offenbar hören, wenn sie miteinander schlafen, nicht so toll. Sie hatten mittlerweile das Bürogebäude erreicht. Du könntest ihr was leihen, sagte die Frau. Der Mann entgegnete, das habe er ihr bereits angeboten, sie habe es abgelehnt. Ehrlich gesagt war ich erleichtert, fügte er hinzu, mein Instinkt sagt mir, ich sollte mich nicht zu sehr einmischen. Die Frau fragte, was der andere Mitbewohner dazu zu sagen habe, und der Mann antwortete, dass er nicht das Gefühl hatte, etwas falsch zu machen, dass die Beziehung der beiden von allein zu Ende gegangen sei, und ob er vielleicht für immer Single bleiben solle? Die Frau verzog das Gesicht und sagte: O Gott, ja, sie muss wirklich dringend aus dieser Wohnung raus. Ich halte die Augen offen. Sie blieben noch einen Moment auf den Stufen stehen. Meine Hochzeitseinladung ist übrigens angekommen, sagte der Mann.
Ach stimmt, sagte sie. Das war ja diese Woche.
Wusstest du, dass sie mich plus eins eingeladen haben?
Sie sah ihn an, wie um sich zu versichern, dass er keinen Witz machte, und hob dann die Augenbrauen. Wie nett, sagte sie. Ich wurde nicht plus eins eingeladen, aber in Anbetracht der Umstände wäre das wohl auch taktlos gewesen.
Willst du, dass ich aus Solidarität allein komme?
Nach kurzem Zögern fragte sie: Wieso, gibt es jemanden, den du mitbringen möchtest?
Na ja, vermutlich das Mädchen, mit dem ich zusammen bin. Wenn es dich nicht stört.
Sie sagte: Hm. Dann fügte sie hinzu: Du meinst hoffentlich Frau.
Er lächelte. Lass uns nett zueinander sein, okay, sagte er.
Nennst du mich etwa hinter meinem Rücken ein Mädchen?
Natürlich nicht. Ich nenne dich gar nichts. Wann immer dein Name fällt, werde ich nervös und verlasse den Raum.
Ohne darauf einzugehen, fragte die Frau: Wann hast du sie kennengelernt?
Keine Ahnung. Vor sechs Wochen?
Sie ist aber keine von diesen zweiundzwanzigjährigen skandinavischen Frauen, oder?
Nein, sie ist keine Skandinavierin, sagte er.
Mit einem übertrieben erschöpften Ausdruck warf die Frau ihren Kaffeebecher in den Mülleimer vor der Tür des Bürogebäudes, und der Mann fügte hinzu: Ich kann auch allein kommen, wenn es dir lieber ist. Wir können uns quer durch den Raum anhimmeln.
So wie du das sagst, muss ich sehr verzweifelt wirken, sagte sie.
Nein, überhaupt nicht.
Ein paar Sekunden lang sagte sie nichts, starrte nur auf den Verkehr. Schließlich meinte sie: Sie sah sehr schön aus bei der Anprobe. Lola, meine ich. Weil du gefragt hast.
Ohne sie aus den Augen zu lassen, erwiderte er: Kann ich mir vorstellen.
Danke für den Kaffee.
Danke für den Rat.
Den Rest des Nachmittags arbeitete sie im Büro mit demselben Textverarbeitungsprogramm, öffnete neue Dateien, schob Apostrophe umher und löschte Kommas. Immer wenn sie eine Datei geschlossen hatte und bevor sie die nächste öffnete, checkte sie routinemäßig ihre Social-Media-Feeds. Ihr Gesichtsausdruck, ihre Haltung blieben unverändert angesichts der Informationen, die sie dort vorfand: ein Bericht über eine schreckliche Naturkatastrophe, ein Foto von jemandes geliebtem Haustier, eine Journalistin, die sich zu Todesdrohungen äußerte, ein Witz, der nur für Menschen ansatzweise nachvollziehbar war, die auch die anderen im Internet kursierenden Witze kannten, auf die er sich bezog, eine leidenschaftliche Verurteilung weißer Vorherrschaft, ein gesponserter Tweet, der Nahrungsergänzungsmittel für werdende Mütter bewarb. Nichts veränderte sich in ihrer äußeren Beziehung zur Welt, was einem Beobachter Rückschlüsse darüber erlaubt hätte, was sie dabei empfand. Nach einer Weile schloss sie ohne erkennbaren Anlass das Browserfenster und öffnete den Texteditor. Gelegentlich kam ein Kollege oder eine Kollegin mit einer arbeitsbezogenen Frage zu ihr, und sie antwortete, oder jemand teilte eine lustige Anekdote mit dem Büro und alle lachten, aber im Großen und Ganzen verlief die Arbeit still.
Um siebzehn Uhr vierunddreißig nahm die Frau erneut ihre Jacke vom Garderobenhaken und verabschiedete sich. Sie wickelte ihre Kopfhörer vom Handy, stöpselte sie ein und ging die Kildare Street entlang in Richtung Nassau Street, bog dann links ab und lief in westliche Richtung. Nach einem achtundzwanzigminütigen Spaziergang blieb sie vor einem neu erbauten Wohnkomplex an der nördlichen Uferstraße stehen und ging hinein, stieg zwei Treppen hinauf und schloss eine abgeplatzte weiße Tür auf. Niemand sonst war zu Hause, aber Schnitt und Einrichtung des Apartments legten nahe, dass sie nicht seine einzige Bewohnerin war. Ein kleines, dunkles Wohnzimmer mit einem Fenster, an dem eine Gardine hing und das den Blick zum Fluss freigab, ging in eine Kochnische mit Ofen, halbhohem Kühlschrank und Spüle über. Die Frau nahm sich eine mit Frischhaltefolie abgedeckte Schüssel aus dem Kühlschrank. Sie entfernte die Frischhaltefolie und stellte die Schüssel in die Mikrowelle.
Nachdem sie gegessen hatte, ging sie in ihr Zimmer. Durch das Fenster konnte man die Straße sehen und die langsamen, wogenden Bewegungen des Flusses. Sie zog Jacke und Schuhe aus, nahm die Spange aus dem Haar und zog die Vorhänge zu. Die Vorhänge waren dünn und gelb und hatten ein Muster aus grünen Rechtecken. Sie zog ihren Pullover aus, schälte sich aus der Hose und ließ beides zusammengeknüllt auf dem Boden liegen. Der Stoff der Hose schimmerte leicht. Dann zog sie sich ein Baumwollsweatshirt und graue Leggins an. Ihr dunkles, lose über die Schultern fallendes Haar wirkte sauber und ein wenig trocken. Sie setzte sich im Schneidersitz auf ihr Bett und öffnete den Laptop. Eine Weile scrollte sie sich durch die Startseiten verschiedener Nachrichtenmedien, öffnete gelegentlich lange Artikel über Wahlen in Übersee und überflog sie. Ihr Gesicht war blass und müde. Zwei Personen kamen in die Wohnung und unterhielten sich im Flur darüber, ob sie Essen bestellen sollten. Sie gingen an ihrem Zimmer vorbei, durch den Schlitz unter der Tür erschienen kurz ihre Schatten, und weiter in die Küche. Die Frau öffnete ein privates Browserfenster auf ihrem Laptop, rief eine Social-Media-Website auf und tippte die Wörter »aidan lavelle« in das Suchfeld. Eine Liste mit Ergebnissen erschien, und ohne die anderen Optionen zu beachten, klickte sie auf das dritte Ergebnis. Ein neues Profil öffnete sich und zeigte den Namen Aidan Lavelle unter einem Foto, das Kopf und Schultern eines Mannes von hinten zeigte. Der Mann hatte dichtes, dunkles Haar und trug eine Jeansjacke. Unter dem Foto stand: trauriger junge von hier. durchschnittshirn. checkt meine soundcloud. Der neueste Eintrag des Users war drei Stunden alt und zeigte das Foto einer Taube in einem Rinnstein, die den Kopf in eine weggeworfene Chipstüte steckt. Darunter stand: genau so. Das Posting hatte 127 Likes. Die Frau lehnte sich in ihrem Schlafzimmer gegen das Kopfende des ungemachten Betts und klickte auf den Beitrag. Darunter erschienen Antworten. Eine Antwort stammte von einer Userin mit dem Namen Actual Death Girl und lautete: sieht ganz nach dir aus. Der Aidan-Lavelle-Account hatte geantwortet: nicht wahr? wahnsinnig gut aussehend. Actual Death Girl hatte die Antwort gelikt. Die Frau klickte sich an ihrem Laptop durch das Profil von Actual Death Girl. Nachdem sie sechsunddreißig Minuten damit verbracht hatte, sich mehrere der Social-Media-Profile anzusehen, die mit dem Aidan-Lavelle-Account verbunden waren, klappte die Frau ihren Laptop zu und streckte sich im Bett aus.
Mittlerweile war es acht Uhr abends. Der Kopf der Frau ruhte auf dem Kissen, die Stirn hatte sie auf ihr Handgelenk gelegt. Sie trug ein dünnes Goldarmband, das schwach im Schein der Nachttischlampe schimmerte. Ihr Name war Eileen Lydon. Sie war neunundzwanzig Jahre alt. Pat, ihr Vater, bewirtschaftete einen Bauernhof im County Galway, und ihre Mutter war Geografielehrerin. Sie hatte eine Schwester, Lola, die drei Jahre älter war als sie. Als Kind war Lola robust, mutig, spitzbübisch gewesen, Eileen hingegen ängstlich und häufig krank. Während ihrer Schulferien spielten sie zusammen ausgetüftelte Rollenspiele, in denen sie menschliche Schwestern waren, die Zugang zu Reichen der Magie bekommen hatten. Lola improvisierte die wichtigsten Ereignisse der Handlung, Eileen folgte ihr. Wann immer greifbar, wurden Cousins und Cousinen, Nachbarskinder oder Kinder befreundeter Familien eingespannt, um Nebenrollen zu übernehmen, unter ihnen ein Junge namens Simon Costigan, der fünf Jahre älter als Eileen war und auf der anderen Seite des Flusses im einstigen Herrenhaus wohnte. Er war ein extrem höfliches Kind, das immer saubere Kleidung trug und danke zu den Erwachsenen sagte. Er litt an Epilepsie und musste hin und wieder ins Krankenhaus, einmal sogar in einem Rettungswagen. Wann immer sich Lola oder Eileen schlecht benahmen, fragte Mary, ihre Mutter, warum sie nicht mehr wie Simon Costigan sein konnten, der nicht nur artig war, sondern sich darüber hinaus dadurch auszeichnete, dass er sich niemals beklagte. Je älter die Schwestern wurden, desto seltener bezogen sie Simon oder andere Kinder in ihre Spiele ein, stattdessen gingen sie nicht mehr so häufig raus, zeichneten fiktive Karten auf Schmierpapier, erfanden kryptische Alphabete und nahmen Kassetten auf. Ihre Eltern betrachteten das alles mit einem freundlichen Mangel an Neugier, versorgten sie gern mit Papier, Stiften und leeren Kassetten, waren aber nicht daran interessiert, sich etwas über die ausgedachten Bewohner ihrer ausgedachten Länder anzuhören.
Als sie zwölf war, wechselte Lola von der kleinen Grundschule im Ort in die Klosterschule für Mädchen in der nächstgrößeren Stadt. Eileen, die schon vorher eine stille Schülerin war, zog sich noch mehr zurück. Ihre Lehrerin sagte ihren Eltern, sie sei begabt, und so wurde sie zweimal pro Woche in einen besonderen Raum gebracht, wo sie zusätzlichen Unterricht in Lesen und Mathematik erhielt. Lola fand an der Klosterschule neue Freundinnen, die auch auf den Bauernhof zu Besuch kamen und manchmal sogar dort übernachteten. Einmal schlossen sie Eileen zum Spaß zwanzig Minuten lang im oberen Badezimmer ein. Danach beschloss ihr Vater, Pat, dass Lolas Freundinnen nicht mehr zu Besuch kommen dürften, und Lola sagte, es wäre Eileens Schuld. Als Eileen zwölf war, wurde sie ebenfalls auf Lolas Schule geschickt, die sich über mehrere Gebäude und Fertigbaueinheiten erstreckte und von insgesamt sechshundert Schülerinnen besucht wurde. Die meisten gleichaltrigen Mädchen wohnten in der Stadt und kannten sich bereits aus der Grundschule. Ihre Verbindungen und Loyalitäten bestanden fort und schlossen Eileen aus. Lola und ihre Freundinnen waren da schon alt genug, um zum Mittagessen in die Stadt zu gehen, während Eileen allein in der Cafeteria saß und die Alufolie von ihren mitgebrachten Sandwiches zupfte. Im zweiten Jahr schlich sich ein Mädchen aus ihrer Klasse von hinten an sie heran und kippte als Mutprobe eine Flasche Wasser über ihrem Kopf aus. Die stellvertretende Direktorin wies das Mädchen an, Eileen einen Entschuldigungsbrief zu schreiben. Zu Hause sagte Lola, das wäre nie passiert, wenn Eileen nicht ständig so tun würde, als wäre sie ein Freak, und Eileen sagte: Ich tue nicht so.