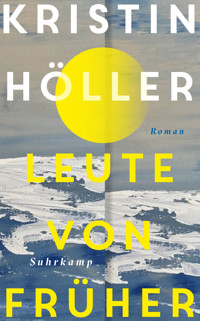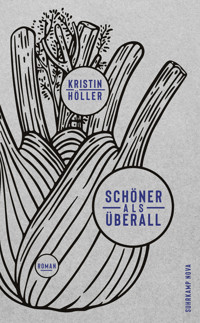
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: suhrkamp nova
- Sprache: Deutsch
Es beginnt wie ein Roadmovie. Im gemieteten Transporter fahren Martin und sein bester Freund Noah über die Autobahn. Auf der Ladefläche der Speer der bronzenen Athene vom Münchner Königsplatz, Trophäe einer rauschhaften Sommernacht. Sechs Stunden später sind sie zurück an den Orten ihrer Kindheit: Die Spielstraßen, die Fenchelfelder, die Kiesgrube haben sie vor Jahren hinter sich gelassen. Auch Mugo ist zurück, die kluge, wütende Mugo, die immer vom Ausbruch aus der Provinz geträumt und Martin damit angesteckt hat. Sie wollte raus aus der Kleinstadt, aus dem Plattenbau mit Blick auf Einfamilienhäuser und Carports. Nun arbeitet sie an der Tankstelle am Ortseingang und will nichts mehr von Martin wissen. Sogar Noah wird ihm in der vertrauten Umgebung immer fremder. Auf sich allein gestellt, ist Martin gezwungen, das Verhältnis zur eigenen Herkunft zu überdenken.
Einfühlsam und mit Witz erzählt Kristin Höller in ihrem Romandebüt vom Erwachsenwerden: von der Verwundbarkeit, der Neugierde, der Liebe und der Wut, von großen Plänen und den Sackgassen, in denen sie oftmals enden. Sie erzählt von der Entschlossenheit der Mütter und dem Erwartungsdruck der Väter, vom Ende einer Freundschaft und der Schönheit von Regionalbahnhöfen. Existenziell, tröstlich, hinreißend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kristin Höller
Schöner als überall
Roman
Suhrkamp
Schöner als überall
Für meinen Vater Frank
1
Unten vor der Tür steht ein Transporter. Der Speer muss weg, sagt Noah, er muss weg, steig ein, los, steig ein! Ich sage, gut, ist ja gut, wir machen das, entspann dich, und Noah rennt um das Auto herum und hastet hinters Lenkrad. Unsere Türen knallen zeitgleich, der Motor ist so laut in der Nacht, es ist noch ganz warm. Noah wendet, er blinkt, er gibt Gas, er atmet zu schnell. Ich weiß nicht was tun bei so viel Aufregung, und darum sage ich erst nichts, bis sich alles beruhigt hat, halbwegs. Die Straßen in der Stadt sind auch jetzt noch ganz voll, wir halten an vier Ampeln, bis wir raus sind. Noahs Finger umschließen den Schaltknüppel, als wäre er ein Schatz, eine Goldkugel, die er nie mehr aus der Hand geben darf.
Dann die Autobahn. Ich denke an den Speer im Laderaum, wie er da liegt hinter uns, lang und glänzend und mit der scharfen Kante vorne, an der sich Noah letzte Nacht die Hand blutig gerissen hat. Nicht schlimm, hat er gesagt, ich komm schon klar, aber das stimmt nicht. Noah kommt nicht klar, gerade und gestern Nacht nicht und eigentlich auch den ganzen langen Tag heute. Noah hat Flecken unter den Armen und eine fettglänzende Stirn, er sieht schlecht aus und ungewohnt. Dabei ist es gar nicht so tragisch, ich würde sogar behaupten, all das ist eine Überreaktion, eine einzige lächerliche Übertreibung, weil Noah langweilig geworden ist und er etwas Drama braucht. Weil eine Zeitlang so viel passiert ist in seinem Leben und nun eben nicht mehr, und damit muss man sich auch erst mal abfinden, und ich glaube nicht, dass er das schon getan hat, und darum vielleicht jetzt das hier.
Ich habe meine Jacke vergessen, sage ich, weil es stimmt. Ich hatte ja kaum Zeit zum Packen, als Noah angerufen hat um kurz vor elf und gesagt, das mit dem Speer müsse jetzt ganz schnell gehen und darum auch das Auto. Da habe ich nur das Nötigste genommen, also Handy, Geld, eine Packung NicNacs und sonst nichts, weil mir nie einfällt, was mir wichtig ist, wenn es darauf ankommt. Und so habe ich die Jacke vergessen, aber das macht nichts, denn es ist ja warm, und es wird warm bleiben die nächsten Stunden; es ist eine Sommernacht, schließlich.
Als wir auf die Autobahn auffahren, frage ich Noah, wo er hin will. Er sagt, dass ihm das egal ist, Hauptsache, niemand sieht diesen verdammten Speer je wieder, am besten irgendwo versenken, vergraben, verbrennen. Verbrennen geht nicht, sage ich, das ist ja Bronze, weißt du, der würde nur heiß werden. Ja, sagt er, das weiß ich auch, sagt er, war nur ein Scherz. Er sieht nicht aus, als sei ihm nach Scherzen, aber das ist nicht neu in letzter Zeit. Ich weiß noch, dass das anders war, früher, als wir Kinder waren und zusammen mit den Kaulquappen in den Pfützen gespielt haben, oder auch noch vor ein paar Monaten, als alles gut lief bei ihm und das Geld auf ihn einprasselte wie billige Bonbons bei Karnevalsumzügen, wie damals, wie dort, wo wir herkommen.
Noah weiß immer wohin, außer jetzt. Jetzt fährt er einfach drauflos, fährt auf der linken Spur und wartet, bis der Tank leer ist – der Tank ist noch ziemlich voll. Ich frage, ob nicht hundert Kilometer reichen, ich meine, hundert Kilometer, wer soll denn danach suchen, das ist doch letzten Endes auch nur Altmetall, wenn man es mal so sieht, oder?, aber Noah schüttelt nur den Kopf und sagt, er muss ganz, ganz sichergehen, denn wenn das rauskommt, dann ist er im Arsch, komplett im Arsch, also wirklich, hundert Prozent. Ich sage, ich weiß ja nicht, so schlimm wird es schon nicht … aber dann wird Noah richtig wild und brüllt, dass ich davon doch keine Ahnung habe und jetzt bitte einfach nur den Mund halten soll, und das tue ich, weil er womöglich recht hat und mein Kopf plötzlich so schwer wird, dass ich ihn anlehnen muss, unbedingt.
Ich schließe die Augen und denke an gestern Nacht. Ich denke an die Party, ich denke an die Gratislongdrinks und an das Fischgrätparkett. Fischgrätparkett ist teuer, aber Fischgrätparkett in München, das ist quasi wie ein Diamantencollier, auf dem man jeden Tag herumspaziert, also einfach ehrlich unbezahlbar. Ich denke an die schlichten, schicken Stehleuchten und die schicken Frauen darunter und an das Prickeln in den Gläsern, die sie mit ihren langgliedrigen Fingern umschlingen.
Ich kenne solche Leute nicht, aber Noah kennt sie, seit der Rolle vor zwei Jahren, seiner allerersten. Am Anfang hatte er nichts, nur einen unterschriebenen Vertrag, und dann kam der Film in die Kinos, kein guter Film, lustig zwar, aber mit zu viel Plastik und Verwechslungen und Menschen, die rückwärts in Swimmingpools fallen. Es ist aber so, dass das ziemlich vielen Menschen gefällt, mir nicht, und Noah eigentlich auch nicht, aber dafür so etwa 5,4 Millionen anderen oder noch mehr, die dafür in den Kinos waren, und auf einmal war Noah berühmt.
Das war neu für ihn, aber überrascht war er nicht, denn er hatte es heimlich immer gewusst; er, seine Eltern, die ganze Reihenhaussiedlung zu Hause, alle haben es gewusst, seit er klein war. Und alle haben gewusst, das ist es, als sein Vater ihn in das Casting geschleust hat, jetzt ist es so weit. Dann kamen die Auftritte im Frühstücksfernsehen und die roten Teppiche, die eigentlich nur aussehen wie Badvorleger, wenn man nah genug dran ist, dann kamen die Partys und die schönen Mädchen, und dann kam erst mal nichts mehr.
Er ist zwar immer noch oft eingeladen, und ich komme immer noch mit. Nur haben die Wohnungen keine Dachterrassen mehr und keine automatischen Eiswürfelspender, und manchmal gibt es auch nur Bier und Wein und keinen Schnaps. Er hat auch immer noch Geld, auf dem Konto und auf einem zweiten und ein paar Scheine in dem kleinen roten Spielzeugferrari auf der Fensterbank, wie früher, nur dass jetzt eben kein neues nachkommt. Dass er damit erst mal auskommen muss, auskommen, sagt er und schnaubt aus dem Hinterhals heraus, ein bisschen haushalten, was zurücklegen. Oder eben Werbung für Joghurt machen, die haben ihn angefragt, vor zwei Wochen, für einen TV-Spot, aber Noah wollte nicht. Nein, hat er gesagt, dass es so weit, also, sicher nicht, eher …
Jetzt geht er weiter auf Partys, und ich auch, denn ich bin immer dabei. Es sind jetzt nur noch Stellvertreter und Assistenten, die ihn einladen, immer noch gute Leute, immer noch alles ganz toll glänzend und angestrahlt, aber eben nicht mehr so wichtig wie am Anfang, als er neu war und ganz und gar unbeschrieben, vor ein, zwei Jahren und noch vor ein paar Monaten. So ist das eben, sage ich zu ihm, obwohl ich doch eigentlich auch nicht weiß, wie es ist, und vor allem nicht, wie es sein soll. Und dann war da dieses Gespräch letzte Woche und irgendein Produzent, der zu ihm gesagt hat, ja, danke, aber sein Gesicht, das sei einfach zu verbraucht, da müsste man immer denken an …
Und gestern Abend stand er da im Sommerhemd, die aufgekrempelten Ärmel hochgeschoben, dass die Armhaare abstanden, ein bisschen, und dachte an früher und wurde ganz unglücklich. Ich sehe das an seinem Kopf, was er denkt, wirklich, ich muss nur von außen draufblicken und weiß, was drin passiert. Martin, sagt er dann immer und zwinkert mit den Augen wie ein Kind, Martin, schau mich nicht so an, ich will das für mich behalten. Ich würde es ihm gern lassen, ich würde ihm gern lassen, was er denkt, aber er ist so schrecklich leicht zu durchschauen, leider. Und wie er da so stand, mit seinem Glas Wein in der Hand, die dritte Person in einem Zweiergespräch, eingeklinkt, abseits, da hab ich gesehen, dass er wieder fürchtet, das könnte es schon gewesen sein, für immer, für ewig gewesen sein, und eine Angst überkam ihn und gleichzeitig eine Wut, dass man sich auf etwas einstellen konnte. Ich hab ihm dann gesagt, dass jeder diese Angst hat, jeder hier, auch ich, vor allem ich, und bei mir ist noch nicht mal etwas passiert, und darum dürfte ich in dieser Rechnung ja wohl richtig Angst haben und nicht er, aber das hört er nicht in solchen Momenten.
Er macht dann immer etwas Unüberlegtes. Gestern Abend hat er Wein getrunken, ein paar Gläser und dann noch ein paar, obwohl er gar keinen Rotwein mag, ich weiß das. Ich weiß, dass er auf seine Zunge beißt, hinten rechts, wenn er Rotwein trinken muss, nicht fest, nur ein bisschen einklemmen, dann ist die Säure leichter zu ertragen. Vor ein, zwei Jahren hat er immer noch abgelehnt, wenn ihm etwas angeboten wurde, das er nicht mochte, aber jetzt will er nicht unangenehm auffallen, nicht auch das noch. Gestern Abend also waren es ziemlich viele Gläser, seine Zunge muss sich taub angefühlt haben, oder vielleicht hat er sich sogar insgesamt taub gefühlt, am ganzen Körper.
Noah kriegt immer gute Laune von Alkohol, die beste von Sekt, mit Wein wird er so mondän, aber das kam gut an auf der Party, und bald scharten sich ein paar junge, teuer angezogene Menschen um ihn und lachten mit breiten Mündern und sogar mit den Augen. Noah ist gut in solchen Runden, er redet und zwirbelt das Glas in seiner Hand und spielt Gespräche nach, die er nie erlebt hat, aber das weiß ja niemand außer mir. Er sagt Sachen wie, ich würde das nie machen, aber Heroin nehmen, das soll sich anfühlen, wie wenn man Papier schneidet, und auf einmal hat man diesen Winkel, in dem die Schere so seidig durchrutscht.
Die Hälfte der Menschen auf solchen Partys ist über vierzig und wichtig, die andere Hälfte ist jung und schön oder sonst irgendwie bemerkenswert. Dann gibt es noch mich; ich bin nichts davon, aber niemand traut sich, mich zu fragen, was ich hier mache. Ich komme mit Noah, das ist meine Absicherung für den Abend. Bei den Jungen sind immer ein paar dabei, die sich schon zu erwachsen fühlen, obwohl sie es noch gar nicht sind, und die darum ganz versessen darauf sind, junge, verrückte Dinge zu tun.
Das hat deshalb gepasst, als Noah plötzlich geschrien hat, Taxi, Taxi, und dabei mit seinen Armen gefuchtelt, als wäre er ein Kind und jetzt endlich Schulferien, und es ging etwas durch die Menschen, wie Elektrik, und sie riefen auch: Taxi, ja, los. Ich habe Noah gefragt, wo er denn hin will heute Abend, und er hat nur noch lauter geschrien in mein Gesicht, die Mundwinkel rot von Wein, und ist rausgestürmt und zehn Leute hinter ihm her. Noah hat zwei Großraumtaxis bestellt, und wir sind eingestiegen und gefahren, immer weiter gefahren durch die Nacht, bis Noah plötzlich halt geschrien hat, halt! Stehen bleiben, hier.
Das war der Königsplatz, groß und leer und schwarz, und wir sind alle raus und standen da, und es war so eine Weite, dass einem ganz schwindelig werden musste. Dann ist Noah losgerannt, über die getrimmten Rasenflächen und immer auf die Athene zu, auf die große, bronzene Athene auf dem Sockel, die da so eisern stand. Wer zuerst oben ist, hat er gerufen, und ich habe noch gedacht, was meint er nur damit, wo denn hoch?, aber da sind alle schon gerannt wie völlig von Sinnen und ich dann hinterher. Wie wir so gelaufen sind über das weite Feld, mitten in der Nacht, mitten in der Stadt, da hab ich wieder gespürt, warum Noah es geschafft hat bis hierher und warum alle das wussten, immer schon. Wenn Noah rennt, dann rennen sie ihm hinterher, folgen ihm überallhin, weil er so einladend läuft und so charmant ausschaut dabei und weil er einfach in den Köpfen herumzündelt, bis alle voller Feuer sind für ihn, obwohl er nicht mal ihre Namen kennt. Und so auch gestern Nacht, sie sind gerannt mit wackligen Füßen, den Alkohol bis unter die Stirn, und haben gejauchzt und die Arme hochgeworfen und sich endlich ganz furchtbar wahrhaftig gefühlt.
Das sind drei Meter, hab ich gesagt, als wir unten standen, mindestens, also mindestens zweieinhalb, komm doch da runter, bitte. Aber Noah wollte nicht und stand schon auf dem Sockel, und die Mädchen klatschten in die feinen Hände und lachten und setzten Weinflaschen an die schönen Münder.
Ich habe Angst gehabt um Noah, keine richtige Angst, eher eine Sorge, berechtigt, denn es war hoch dort oben, und er war betrunken, aber ich habe nichts mehr gesagt, ich meine, er ist erwachsen und berühmt, und er muss das alles selbst wissen. Und dann wollte er noch weiter hoch, wollte auf die Statue, weil alle so geschrien haben und ihn angefeuert, und er hat sich am Speer festgehalten, den die Athene in der linken Hand hält, und seine Füße gegen das Statuenbein gestemmt, und dann ist es passiert.
Er ist einfach abgebrochen, der Speer, gleich oben an ihrer Hand, und Noah ist runtergefallen wie ein Tier, wie ein Insekt mit dem Bauch nach oben. Er hat dagelegen im Schotter, den Bronzestab neben sich, und hat ganz gepresst geklungen. Ich bin hin zu ihm und auf die Knie, aber er hat gesagt, dass alles in Ordnung sei, wirklich, das geht schon, und dann ist er aufgesprungen und hat die Arme hochgerissen wie bei der Tour de France. Es ist, hat er gerufen, es ist alles in Ordnung! Und die Mädchen haben gejubelt und sind herumgehüpft, und alle waren ausgelassen. Ich hab gesehen, dass er Schmerzen hat, hinten an der Schulter, auch wenn er das nicht zeigen wollte, aber er hat sein Gelenk immer so nach hinten gekugelt, heimlich. Noah hat sich also nichts anmerken lassen, sondern einfach ein Ende des Speeres angehoben und sich dann auch noch geschnitten dabei an der scharfen Kante, da war Blut an seiner Hand. Das haben auch die anderen gesehen und diesen riesigen Speer hochgehoben, alle haben mitangefasst, obwohl er so schwer doch gar nicht sein konnte. Ich war betrunken, ein bisschen, aber ich weiß, dass ich nach oben geschaut habe in diesem Moment und die Speerspitze gesehen habe, wie sie traurig aus Athenes Hand herauslugte, und ich habe da schon gedacht, dass das ganz bestimmt Ärger gibt, aber ich wollte nichts sagen, weil Noah gerade einen Lauf hatte, genau in diesem Moment.
Sie haben den Speer über den Platz getragen, alle hielten sich daran fest; die Mädchen platzierten ihre Hände auf der Bronze und trippelten nebenher, dass es aussah wie an einer Ballettstange.
Das war etwas, das werde ich nicht vergessen. Noah war so frei und gelöst in dieser Sekunde und hatte alles vergessen um sich herum, sogar mich. Wenn ich mich umgedreht hätte und zur U-Bahn gelaufen wäre – er hätte es nicht bemerkt, wirklich, er hätte mir bloß am nächsten Tag geschrieben, wo warst du?, hätte er geschrieben, gute Nacht gewesen. Aber ich bin hinterhergegangen, trotzdem, ich bin dem Speer gefolgt und allein über den warmen Königsplatz gelaufen, und als ich mich an den Boden gewöhnt hatte, an die Steine, an das Gras, da kamen Fassaden von links und rechts und machten alles ganz eng, und wir waren wieder in den Straßen.
Ich hatte keine Ahnung, wo die hinwollten, erst, aber dann hat Noah einen Chor aus ihnen gemacht, und sie riefen: Tanzen, tanzen, immer im Rhythmus ihrer Schritte. Es gibt dort einen Club, in den wir manchmal gehen, nur ein paar Meter entfernt, und den haben sie angesteuert, im Gleichgang, wie eine entschlossene, riesige Raupe. Ich wusste, dass das nicht gut ist, denn da waren ja noch Menschen überall, und ein paar davon kannten sicher Noahs Gesicht, aus dem Kino oder aus der Gala oder von Plakaten wenigstens, und wenn man es genau nimmt, dann war das schon so etwas wie Diebstahl, wenn auch aus Versehen, ganz aus Versehen. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern, nur, dass Noah nicht nachgedacht hat gestern Abend, einfach nicht nachgedacht, und diese Bronzestange mit sich herumgetragen in seiner blutenden Hand.
Viel ist dann nicht mehr passiert, eigentlich. Wir haben uns angestellt in die Schlange, sie war nicht sehr lang, und bald war da der Türsteher, der gesagt hat, nein, also, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, nicht mit diesem Teil, ich will nicht wissen, wo ihr das …, schönen Abend noch. Und dann standen wir da wieder draußen mit dem Ding, das so sperrig war und vorne so spitz, und wussten nicht wohin damit, und dann hat Noah gesagt, scheiß drauf, wir bringen das jetzt zu mir, das ist unsere Trophäe, das ist unsere Nacht, und die andern fanden das gut.
Noah wohnt nicht weit von dort im zweiten Stock, in einem Haus mit weißer Fassade und tollem Treppenhaus, in einer Wohnung mit Holzdielen und sogar Kunst an den Wänden, seit kurzem. Wir haben den Speer hochgetragen, das war nicht ganz leicht in den Ecken, und dann haben wir ihn in Noahs Flur gelegt, vorsichtig, alles kein Problem. Dann haben wir noch etwas herumgestanden, und zwei der Mädchen haben ihre Nummern dagelassen, und dann sind die anderen gegangen. Ich bin dortgeblieben, wie ich es manchmal tue, denn mein Zimmer ist klein und außerhalb der guten Viertel. Ich habe eine Maß Wasser getrunken und Noah auch, das machen wir, wenn wir nachts heimkommen, auch wenn wir glauben, dass nichts mehr reinpasst in unsere Bäuche. Wir denken an den Kater am nächsten Tag und trinken alles in einem Zug, den ganzen Liter, und dabei schauen wir uns an, damit der andere nicht aufgibt. Dann habe ich mich hingelegt, auf das Sofa im Wohnzimmer, und geschlafen, bis es hell wurde. Das war sehr bald, denn es ist spät gewesen und Sommer, und die Vorhänge in Noahs Wohnung sind alle weiß und leicht wie in der Raffaello-Werbung. Ich bin aufgestanden und heimgefahren mit der Tram und zu Hause noch mal ins Bett gegangen, und als ich wieder wach wurde, da hatte ich so viele verpasste Anrufe und Nachrichten wie lange nicht mehr, alle von Noah.
Er hat sich den Speer noch mal angeschaut, morgens, und der hat ganz schön wertig ausgesehen im Hellen. Und die Athene, wenn man sie googelt, sei viel größer als letzte Nacht und alles. Dann war es nachmittags, und es kamen die ersten Meldungen, nichts ganz Dramatisches, aber immerhin eine Stellungnahme von der Antikensammlung mit einem Foto des Direktors, wie er mit erzürntem Finger auf die einsame Speerspitze zeigt. Und von der Polizei eine Mitteilung und eine kurze Nachricht online von der Münchner Abendzeitung, in der etwas von mehreren zehntausend Euro Schaden stand und professionellen Metalldieben, und da hat Noah langsam Panik bekommen. Er hat sich an den Türsteher vor dem Club erinnert und an die Menschen auf den Straßen, die vielleicht heute an ihn denken. Ihm sind die Mädchen eingefallen, von denen er zwar die Nummern hat, aber nichts sonst, und dass sie alle zu viel wissen. Und dass er seine Karriere vergessen kann, wenn das rauskommt, dass das sein Ende sein könnte, ein Teeniestar, der abrutscht und kriminell wird.
Ich habe Noah recht gegeben, und dass das ein Problem ist, schon, aber dass wir da sicher eine Lösung finden würden. Dass ich all das gestern Abend geahnt habe, das habe ich ihm nicht gesagt, denn ich wollte es nicht noch schlimmer machen. Ich habe gesagt, dass wir den Speer in den Wald bringen könnten oder ins Wasser werfen, in den Eisbach, oder meinetwegen bis nach Starnberg, das würde doch niemand mitkriegen, und so im Wasser, da wären die Fingerabdrücke auch nicht mehr zu erkennen. Aber Noah hat gesagt, nein, der muss ganz weg, den darf nie wieder jemand sehen, nie mehr. Da war es abends, und ich habe gesagt, dass wir uns da morgen drum kümmern können, so eilig sei es ja schließlich nicht und der Speer immer noch in seiner Wohnung.
Und dann hat mich Noah angerufen, eben, kurz vor elf, ich war schon fast im Schlafanzug. Er hat geflüstert am Telefon und gesagt, dass ich runterkommen soll, wir müssten das jetzt erledigen, los, komm, schnell. Ich habe gefragt, warum er flüstert, aber er hat noch mal geflüstert als Antwort, und zwar, dass ich die Fresse halten soll und nicht solche Fragen stellen und einfach runterkommen, sofort. Ich brauch dich, hat er noch gesagt, und das hat meine Ohren aufgeweckt und meinen ganzen Körper, weil Noah das nie sagt zu mir oder zumindest ganz, ganz selten, und wir wissen beide, dass es öfter andersherum ist, obwohl wir nie darüber sprechen.
Ich bin also runter, und da stand er, mit wippenden Fersen, das Handy noch in der Hand. Er hat gesagt, dass ich einsteigen soll, und das bin ich, und nun sitze ich hier, neben Noah, nachts auf der Autobahn mit geschlossenen Augen, wie damals auf der Fahrt in den Urlaub nach Italien, schläfrig und halbwach dabei.
Ich mache die Augen wieder auf und fühle mich fremd. Ich weiß nicht, wie spät es ist, aber ich habe das diffuse Gefühl, dass ich nicht nur nachgedacht, sondern auch ein bisschen geschlafen habe, nur kurz, wegen der Aufregung vorhin und gestern und überhaupt. Noah neben mir fährt immer noch, was sonst, fährt auf der linken Spur und sieht dabei selbst aus wie eine Statue, seine Hand verbunden mit einer Mullbinde. Ich schaue aus dem Fenster. Ich sehe nichts, oder fast nichts. Nur die Leitplanke und die weißen Linien, die rechts und links neben uns herfahren, und die kleinen Poller, die sagen, wie viel fünfzig Meter sind, damit man es nicht vergisst.
Dann kommt ein Schild. Auf dem Schild steht Ulm. Ulm, sage ich, was wollen wir denn da?, und Noah sagt, weiß nicht, wir fahren weiter. Ich lehne mich zurück und denke gar nichts mehr, also, eigentlich denke ich, soll er doch, dann fahren wir eben sonst wohin. Und das machen wir, wir reden nicht, und ich frage auch nicht, wie der Speer in den Transporter gekommen ist. Ich stelle mir Noah vor im Treppenhaus, nachts im Dunkeln, wie er ihn runterträgt, allein. Auf den Schildern steht Ulm und Stuttgart und Mannheim und irgendwann Koblenz, und ich habe so ein Gefühl, langsam, ein Gefühl für die Strecke und wo sie hinführen könnte. Hinter Mannheim dämmert es, und die Farben am Himmel sind kräftig und so voll, dass ich fast weinen muss bei dem Gedanken, dass das vielleicht jeden Morgen so aussieht und wir es bloß verschlafen, aber ich bin zu müde. Mit jedem Schild wird Noah wieder mehr er selbst, wird wacher und wirft mir Seitenblicke zu, wie er das sonst macht, wenn wir Auto fahren. Ich öffne die Packung NicNacs und schütte ein paar in seine Hand, er schaltet das Radio ein, erst Rauschen, dann Schlager, natürlich, und über uns die rosa Wolken. Wir sind einfach weggefahren, sagt er. Ja, sage ich, scheiß doch auf die Stadt, und er sagt, scheiß drauf, und uns ist alles egal jetzt, alles, was hiergegen spricht und was uns sagt, dass das ein riesiger, riesengroßer Unsinn ist. Wir fahren sechshundert Kilometer ohne Pause, in einem gemieteten Transporter ohne Gepäck, ohne Jacke, nur wir beide auf der leeren Autobahn und hinter uns der Bronzespeer auf der Ladefläche. Es ist fünf Uhr morgens, es ist schon ganz warm, Noah öffnet die Seitenfenster, bis die Trommelfelle im Wind flattern wie Strandlaken, ich drehe den Schlager laut, und so fahren wir die letzten Kilometer nach Hause.
2
Als wir das Ortsschild sehen, ist es früh, aber hell und Samstag. Samstag, das ist hier etwas anderes als in der Stadt. Für uns ist jeder Tag gleich, oder ähnlich zumindest, aber hier, da ist der Samstag das Wochenziel, ein Wunschtag. Es gibt Leute, die essen nur am Wochenende Brötchen, und da kriegt der Samstag direkt ein ganz anderes Gewicht. Der Samstag früher hat sich angefühlt, als sei alles möglich, als könne man fahren, wohin man will, und tun, was man will, und vielleicht sogar über Nacht bleiben. Der Sonntag ist nicht so gewesen, der Sonntag war immer scheiße, denn da hatte alles zu, und der nächste Tag war immer ein Montag, und das war ein Gefühl wie kurz vor dem Ende der Welt.
Der Ort hier fühlt sich auch an wie das Ende der Welt, jetzt und jedes Mal, wenn ich zurückkomme. Das ist nicht sehr oft, dreimal im Jahr vielleicht, und immer nur höchstens eine Woche. Die Autobahn macht einen Bogen um die Stadt, wir fahren drum herum, wir gehören nicht dazu. Wir nehmen die nächste Ausfahrt, und dann kommt die Landstraße und die Fenchelfelder, die so nach Anis riechen am Ende des Sommers, und irgendwann sehen wir die Fabrik für Tiefkühlkost, die unter den Strommasten steht. Es ist eine komische Gegend hier. Wir sind nicht auf dem Land, dafür ist zu viel Beton überall, wir sind nicht in der Stadt, denn hier ist ja nichts, wir sind irgendwo dazwischen, wo man nirgends hinkommt ohne Auto, eine Zwischengegend. Hier wohnen Menschen, die in der Stadt arbeiten und im Grünen leben wollen, aber weit genug rausgetraut haben sie sich nicht. So grün ist es nämlich gar nicht, dafür alles verkehrsberuhigt und flach, und man kann von überall aus sehr weit sehen. In Noahs Zimmer konnte man nachts bei Sturm die Planen auf den Feldern rauschen hören, und es klang wie das Meer, im Halbschlaf.
Hier gibt es keine Geschäfte, bloß einen Friseur und einen Bäcker. Der hat jetzt schon auf, und darum sage ich, stopp, wir können Brötchen holen. Wir parken und gehen rein, und die Frau hinterm Tresen sieht aus, wie eine Bäckereifachverkäuferin eben aussieht, und deshalb kommt sie mir bekannt vor, aber in Wirklichkeit habe ich sie noch nie gesehen. Das hier ist kein Ort, wo man überall gesagt bekommt, wie groß man geworden ist, und dazu vielleicht eine Scheibe Fleischwurst geschenkt kriegt, so ist es hier nicht. Ich kaufe eine Tüte Brötchen voll, wahllos durcheinander, und Noah fährt mich heim. Meine Eltern wohnen in einem Reihenhaus, auf den Gardinen sind kleine Mohnblumen, immer schon, und vor der Haustür eine blaugetöpferte Schnecke. Vom hinteren Garten aus kann man auf Noahs Haus blicken, das Haus seiner Eltern, die beide Architekten sind, und das sieht man. Es steht auf einer Anhöhe, damit alle es ständig angucken müssen, es ist groß mit viel zu vielen Fenstern und überhaupt zu viel Glas. Das Haus ist ein moderner Königspalast, und man kann drinnen vor der Fensterfront stehen und auf alles hinabschauen.
Der Speer, sagt Noah, als wir halten, der muss heute noch weg. Ja, sage ich, klar, und bin plötzlich wieder ganz müde. Wir sehen uns später, wenn ich geschlafen habe, sagt Noah, und ich sage wieder ja, und die Tür schlägt zu. Dann stehe ich allein vor der Häuserreihe, es ist sechs Uhr morgens ungefähr, und ich habe nichts dabei. Ich stehe da im T-Shirt und mit hängenden Armen, in der rechten Hand eine Brötchentüte und sonst nichts. Das ist alles sehr fremd. Wenn ich sonst herkomme, dann habe ich einen Rucksack dabei oder sogar einen Koffer, und meine Eltern holen mich mit dem Auto vom Bahnhof ab und haben gekocht für mich, und es fühlt sich ganz, ganz anders an als jetzt. Die Vorhänge im Schlafzimmer sind noch zu, natürlich, heute ist Samstag. Es gibt keine Geräusche, nur die Vögel in den Thujahecken. Die Klingel schellt viel lauter als sonst. Der Ton bleibt in der Luft hängen, nichts passiert. Ich klingle noch mal, nichts passiert. Ich gehe ein paar Schritte zurück und rufe, Mama, aber nicht so laut, wie ich eigentlich könnte, denn es ist früh, und ich will keine Unruhe machen. Dann klingle ich noch mal, noch ein letztes Mal, und dann guckt der Kopf meiner Mutter oben aus dem Fenster, zerdrückt und klein. Sie schaut herum mit Maulwurfsaugen und sieht mich, wie ich unten stehe, und sie wird ganz aufgeregt und ruft, Martin, was ist passiert?, und dreht sich um und ruft ins Zimmer, es ist Martin, Martin ist da, steh auf, und dann verschwindet ihr Kopf und lugt gleich darauf unten aus der Tür. Ich sehe ihre Blinzelaugen und die plattgedrückten Wirbel am Hinterkopf, der Schlaf macht sie noch ganz neblig von innen. Von Freitag auf Samstag schläft sie immer, als wäre sie tot oder zumindest, als würde sie nie wieder aufwachen. Sie fragt: Was ist passiert? Sie fragt nicht, wie ich hergekommen bin und warum ich nur eine Brötchentüte bei mir trage, warum ich nicht vorher angerufen habe, sie fragt nur wieder: Was ist passiert? Es ist alles gut, sage ich, lass uns reingehen, Mama. Darauf bewegt sie ihren dünnen Körper aus der Tür, emsig fast, und macht mir Platz.
Drinnen ist alles wie immer, ja wirklich, alles sieht ganz genauso aus wie im Winter, als ich das letzte Mal hier war, die Fotos, der Läufer, der Bücherstapel auf der Kommode, die komischen holländischen Gouda-Schuhe an der Wand, alles sieht aus wie sonst. Ich bin ganz schwach, vielleicht der Schlafmangel, vielleicht immer noch der Kater von gestern, jedenfalls fühle ich mich auf einmal so völlig angekommen hier, und darum bleibe ich stehen in der offenen Tür und drücke meine Mutter fest an mich, ganz fest, und atme ihren Schlafgeruch wie früher, als ich klein war. Sie steht da, auf Zehenspitzen in ihrem zweiteiligen Pyjama, legt ihre Arme um mich, klopft mir auf den Rücken, lacht erst und sagt dann: Was ist denn mit dir? Und als ich nicht antworte, sagt sie bloß, es wird alles gut, Martin, alles. Ich frage mich, wann es das letzte Mal gut war bei mir, und denke, dass das sehr lange her ist. Ich muss mich hinlegen, sage ich. Sie nickt und löst sich von mir, sie geht mir gerade bis zur Schulter, wenn wir so voreinander stehen. Dann nimmt sie mir die Brötchen ab, schaut in die Tüte und sagt, mein Junge, du bist eine einzige Überraschung.
Auf dem Weg nach oben treffe ich meinen Vater, er trägt einen Frotteebademantel und setzt im Gang seine Brille auf. Hallo Martin, sagt er. Hallo Papa, sage ich. Wir umarmen uns stumm auf der Treppe wie zwei müde, lange Riesen, wir sind beide zu groß für diesen Flur und für dieses Haus überhaupt. Ich geh jetzt schlafen, sage ich, und mein Vater nickt und drückt mir bloß zwei Finger in den Nacken, wie damals, zur Aufmunterung.
Mein Zimmer ist klein und dunkel, die Rollläden sind unten wegen der Hitze. Wenn es sehr heiß ist, dann bunkern sich meine Eltern ein und sitzen den ganzen Tag still und glücklich in ihrer kühlen Höhle. Ab und zu geht einer raus, um sich in Erinnerung zu rufen, wie warm es draußen ist, und wenn das länger als eine Handvoll Sekunden dauert, ruft der andere panisch, Tür!
Der Raum hier oben ist mein Zimmer, aber irgendwie auch nicht mehr. Alles, was hier noch steht, ist von mir, aber nutzlos, ich habe es zurückgelassen vor zwei Jahren. Ich bin froh, dass es dunkel ist, dass ich das alles nicht sehen muss: die Pokale, die alten CDs, die Poster an den Wänden. Es ist noch zu früh für Nostalgie, ich kann hier nichts anschauen, ohne mich zu schämen, und darum lasse ich das Licht aus, besser. Mein Bett riecht nach mir selbst im Winter, nach meinem Winter-Ich, sozusagen, aber vielleicht bilde ich mir das bloß ein, weil so richtig weiß man ja nie, wie man riecht. Mugo hat immer gesagt, dass ich ganz süß rieche, wie eine Blume, ganz aus mir selbst heraus. Das hat nie wieder wer zu mir gesagt, aber es ist auch nie wieder wer gewesen wie Mugo. Ich denke oft an sie, immer noch, es ist auch schwer in diesem Bett, zurück in diesem Ort, es ist alles wieder so nah. Ich merke, dass ich jetzt schlafen muss, weil alles weich ist hier und kühl und dunkel, und ich denke, dass ich jetzt eigentlich bald aufgestanden wäre, sechshundert Kilometer von hier, ich denke an den Transporter, an den Speer, an Noahs Angst, die Blinzelaugen meiner Mutter, die Überraschung und an Mugo, immer wieder an Mugo. Dann bin ich weg.
Als ich wieder aufwache, klappern meine Eltern unten mit Besteck. Ich gehe runter, und da ist Frühstück auf der Terrasse, obwohl, eigentlich ist es eher ein Mittagessen, es ist schon so spät. Meine Mutter fasst mir an den Arm; manchmal denke ich, das ist die freundlichste Geste der Welt. Man kann niemandem böse sein, der einem freundlich an den Arm fasst. Ich habe schon eingekauft, sagt sie, das Gesicht voller Erwartung. Meine Mutter mag Besorgungen; oft sitzt sie in der Küche und schreibt die Einkaufsliste mit einer Freude, als wären es Wunschzettel. Sie mag Dinge erledigen und dann abhaken oder durchstreichen. Sie mag außerdem: Gartenarbeit und neue Desserts ausprobieren, wenn ihre Schwester zu Besuch kommt. Es gibt Erdbeeren mit Milch, sagt sie, weil das etwas ist, das so alt ist wie ich oder eigentlich noch viel älter und das wir immer gegessen haben im Sommer unter der Markise, wenn es heiß war. Es gab mal ein Erdbeerfeld, gleich hinter den Häusern, das wurde verkauft an einen Investor, der dort jetzt Wohnanlagen gebaut hat, aber vorher gab es noch einen Sommer voller Erdbeeren, die niemandem mehr gehörten, die waren klein und verwachsen, und wochenlang sind wir jeden Tag in die Felder gegangen, haben uns in die alten Strohrillen gelegt und die Früchte gegessen. Wir haben sie im Liegen gepflückt, das war das Leichteste auf der Welt. Ich war da ungefähr zehn Jahre alt und seitdem fast nie wieder so glücklich.