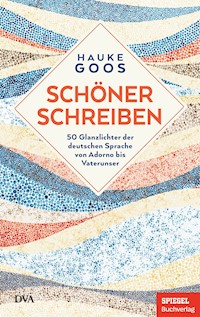
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Über die Kraft und Magie der deutschen Sprache
Seit vielen Jahren sammelt Hauke Goos in seiner beliebten SPIEGEL-Kolumne »Schöner schreiben« Glanzstücke der deutschen Sprache: Sätze aus Romanen, Auszüge aus Briefen oder Passagen aus Reden, die zeigen, was Sprache leisten kann – nicht nur Inhalte zu übermitteln, sondern dabei auch originell, elegant und kraftvoll zu klingen. Die 50 schönsten dieser Fundstücke erscheinen nun erstmals in einem Buch. Klassiker finden sich darunter, aber auch moderne Sprachartisten: Büchner und Kafka, Rosa Luxemburg, Sigmund Freud und Wolfgang Herrndorf, die Bibel, Joseph Roth und Benjamin von Stuckrad-Barre. Jedes einzelne eine Einladung, einen Autor, ein Werk oder eine Schreibschule kennenzulernen und die Magie der deutschen Sprache zu entdecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Seit vielen Jahren sammelt Hauke Goos in seiner beliebten SPIEGEL-Kolumne »Schöner schreiben« Glanzstücke der deutschen Sprache: Sätze aus Romanen, Auszüge aus Briefen oder Passagen aus Reden, die zeigen, was Sprache leisten kann – nicht nur Inhalte zu übermitteln, sondern dabei auch originell, elegant und kraftvoll zu klingen. Die 50 schönsten dieser Fundstücke erscheinen nun erstmals in einem Buch. Klassiker finden sich darunter, aber auch moderne Sprachartisten: Büchner und Kafka, Rosa Luxemburg, Sigmund Freud und Wolfgang Herrndorf, die Bibel, Joseph Roth und Benjamin von Stuckrad-Barre. Jedes einzelne eine Einladung, einen Autor, ein Werk oder eine Schreibschule kennenzulernen und die Magie der deutschen Sprache zu entdecken.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
Hauke Goos, Jahrgang 1966, schreibt seit 2001 für das Reporter-Ressort des SPIEGEL. Im Frühjahr 2021 erschien das von ihm und Alexander Smoltczyk herausgegebene SPIEGEL-Buch Ein Sommer wie seither kein anderer. Wie in Deutschland1945der Frieden begann – Zeitzeugen berichten. Hauke Goos lebt mit seiner Familie in Hamburg.
Hauke Goos
Schöner schreiben
50 Glanzlichter der deutschen Sprachevon Adorno bis Vaterunser
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2021 by Deutsche Verlags-Anstalt, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München,
und SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
Covergestaltung: Favoritbuero, München
Coverabbildung: flovie/Shutterstock.com
Satz: DVA/Andrea Mogwitz
E-Book Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-28500-5V002
www.dva.de
Für Annette
Inhalt
Vorwort
Die Vermessung der Komik
Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt
Schweigsame Sterne, vergeblich befragt
Stefan Zweig, Magellan
Eine verzweifelte Liebe im Exil
Irmgard Keun über Joseph Roth
Spiel mit der Hoffnung
Christian Kracht, Faserland
Wie tief man mit Worten schneiden kann
Sigmund Freud an C.G. Jung
Aus dem Mordgewühl
Friedrich Schiller, Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs
Die Frau, die Kafkas Genie erkannte
Milena Jesenská über Franz Kafka
Die Kunst des Tröstens
Erich Kästner, Das fliegende Klassenzimmer
Wie man einen Freund zum Teufel jagt
Alfred Kerr, Gerhart Hauptmanns Schande
Der letzte Liebesbrief
Ingeborg Bachmann an Paul Celan
Der berühmteste Gedankenstrich der deutschen Literatur
Heinrich von Kleist, Die Marquise von O....
Wie man mit vier Worten20000Verse vernichtet
Arno Schmidt, Arno Schmidts Wundertüte
Von Schlangen, Adlern und Geiern
Sebastian Haffner, Anmerkungen zu Hitler
Wenn ein Sterbender über das Leben schreibt
Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur
Die Kraft der Lakonie
Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem
Wahnsinn in Worte gefasst
Georg Büchner, Lenz
»Bozsik, immer wieder Bozsik«
Herbert Zimmermann, Kommentar zum Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft1954
Ein Märchen – und der Schrecken, der im Wort »aber« steckt
Hans Christian Andersen, Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern
Gottes Wort und Teufels Beitrag
Hiob1,19–21
Wenn die Weltgeschichte vorbeirauscht
Rosa Luxemburg an Luise Kautsky
Warum wir begehren, was wir fürchten
Elias Canetti, Masse und Macht
Der Versuch, den Tod selbst zu beeindrucken
Werner Herzog, Vom Gehen im Eis
Bewegung in der Windstille
Franz Kafka, Die Aeroplane in Brescia
Spiel mir das Lied vom Tod
Karl May, WinnetouIII
Zwei Worte, eine Welt
Theodor W. Adorno imSPIEGEL
Die Magie des Adjektivs
Joseph Roth, Das Neue Tage-Buch
Diesseits und jenseits der Schmerzgrenze
Siegfried Unseld an Thomas Bernhard
Wie man Verhältnisse unverzittert beschreibt
Marie-Luise Scherer, Der unheimliche Ort Berlin
Die Magie des Doppelpunkts
Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit
Ein trauriger kleiner Satz, der alles zerstört
Benjamin von Stuckrad-Barre, Soloalbum
Warum es besser ist, das Leben auszuhalten
Rainer Maria Rilke an Ilse Erdmann
Unschuld und frühes Leid: Es war einmal …
Brüder Grimm, Aschenputtel
Der Meister des Strichpunkts
Thomas Mann, Friedrich und die große Koalition
Ein anderer Blick auf Amerika
Wolfgang Koeppen, Amerikafahrt
Worte gegen die Sprachlosigkeit
Adalbert Stifter, Die Sonnenfinsternis am8. Juli1842
Die Traurigkeit des Revolverschützen
Gabriele Tergit, Wer schießt aus Liebe?
Wenn die Sprache modrig im Mund zerfällt
Hugo von Hofmannsthal, Brief des Lord Chandos
Der Zauber des letzten Satzes
Patrick Süskind, Das Parfum
Die Ohnmacht der Allmächtigen
Anna Seghers, Das siebte Kreuz
Die Kunst der Beleidigung
Joschka Fischer im Deutschen Bundestag
Wie man wahrhaftig über die Liebe schreibt
Urs Widmer, Liebesnacht
Warum Verachtung mitunter hilft
Rudolf Borchardt an Robert Davidsohn
Die Farben des Heimwehs
Uwe Johnson, Jahrestage
Wie aus Verzweiflung Literatur entsteht
Anonyma, Eine Frau in Berlin
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Otfried Preußler, Der Räuber Hotzenplotz
Der Blick einer schönen Seele auf die Welt
Rahel Varnhagen an Karl August Varnhagen
Das ganze Leben in einer Sentenz
Unbekannt, Todesanzeige
Reden über die Absurdität der Welt
Mariana Leky, Was man von hier aus sehen kann
»Ich gebe nur Denkanstöße«
Marc-Uwe Kling, Die Känguru-Chroniken
In Herrlichkeit. Amen.
Vaterunser
Nachweise
Vorwort
vielleicht ist alain delon ein gutes Beispiel. Gerade weil es da nicht um ein Buch geht, nicht um Literatur, nicht mal um Prosa, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. »Der eiskalte Engel« also, ein Gangsterfilm von 1967, im Original heißt er, angemessen rätselhaft, »Le Samouraï«. Delons größter Film, immer noch. Er spielt einen Killer, der jeden Trick kennt, der jede Falle vorausahnt, der gelernt hat, dass man seine Gefühle kontrollieren muss, wenn man überleben will. Ein Profi. Selbstverständlich stirbt er am Ende dann doch, aber vorher hat er einen der größten Sätze der Filmgeschichte.
Männer an einem Tisch, so geht die Szene los. Sie spielen, sie rauchen, sie verabreden sich zum Pokern, um zwei Uhr in der Nacht. Er solle Geld mitbringen, sagt einer der Männer zu Delon. Für den Fall, dass er verliere.
Was antwortet man da? Wie antwortet man so, dass es einen Eindruck hinterlässt, bei den Pokerfreunden, beim Publikum? Dass es im Gedächtnis bleibt?
»Ich verliere nie«, sagt Delon, mit unbewegtem Gesicht. »Niemals wirklich.«
Fünf Worte. Eine Welt. Der Satz ist so großartig, dass ich im Kino, als ich den »Eiskalten Engel« zum ersten Mal sah, sofort nach einem Stift kramte. Ein Filmzitat – und gleichzeitig große Literatur, lakonisch, illusionslos, lebensklug. Ein schöner Gedanke, perfekt ausgedrückt: dass einer auch dann gewinnen kann, wenn er verliert. Gerade dann. Dass er etwas gewinnt im Moment der Niederlage. Etwas, das die Niederlage bedeutungslos macht, Würde zum Beispiel. Und dass es vor allem auf Haltung ankommt, im Film, in der Literatur, im Leben.
Je ne perds jamais. Jamais vraiment.
Vielleicht erklärt dieses Beispiel, warum ich »Stellen« sammle. Prosastellen. Sätze, Absätze, kurze Passagen, ein paar Zeilen lang meistens, selten länger als eine Seite. Und warum ich bei der Frage, wo sich solche Stellen finden lassen, ziemlich großzügig bin.
Was eine Stelle für mich zur »Stelle« macht? Wenn ein Inhalt seine Form findet, das vor allem. Wenn das, was gesagt werden soll, präzise und elegant gesagt wird, konzise und anschaulich, verständlich und originell. »Die Würde des Menschen ist unantastbar« ist auch deshalb ein großer Satz, weil man ihn nicht besser sagen kann.
Die angemessene Form für einen Inhalt zu finden ist Arbeit, meistens jedenfalls. Daher kommt das Glücksgefühl, wenn man auf Sätze stößt, an denen alles, aber auch wirklich alles stimmt – jeder, der gern schreibt oder liest, kennt das. Passagen, in denen ein Autor oder eine Autorin einen Gedanken, eine Erfahrung, die Summe jahrelangen Nachdenkens zu Sätzen verdichtet hat, die man genau so schreiben muss. Die man, jetzt, da man’s gelesen hat, gar nicht anders schreiben kann. Die etwas Kompliziertes einfach erscheinen lassen oder etwas Abstraktes so ausdrücken, dass es anschaulich wird; dass es leuchtet. Die etwas in Sprache fassen, das sich kaum in Sprache fassen lässt. Die zeigen, dass jemand sich Arbeit gemacht hat.
Was rief der Benediktinermönch Dom Pérignon in dem Moment, in dem er den Champagner erfand? Sicher, er hätte von Gärung berichten können, von enzymatischen Zersetzungsprozessen oder von der Lösung der Kohlensäure – es wäre alles richtig gewesen, nur erklärt hätte es eben nichts. Er rief: »Komm schnell, ich trinke Sterne.«
Natürlich ist so ein Satz Literatur. So wie Delons Satz Literatur ist. So wie Parteiprogramme (manchmal) Literatur sind. Oder Gesetzeskommentare. Oder Gebrauchsanweisungen. »Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker«: Literatur auch das, irgendwie. Die Warnung in Londoner U-Bahnstationen, »Mind the gap«: rätselhaft, dunkel, Literatur und ein Rat fürs Leben noch dazu.
Zugegeben: Das Sammeln von Prosastellen ist unter allen Hobbys, die es auf der Welt gibt, eines der partyuntauglichsten. Der eine erzählt davon, wie er alle Fußballstadien dieser Erde besucht (groundhopping nennt sich das), die nächste baut den Kölner Dom aus Wäscheklammern nach, wieder ein anderer lässt seine Drohne steigen und fotografiert aus der Höhe geometrische Muster.
Ich sammle Stellen.
Nun ja. Wenn man Glück hat, kann man immerhin kurz erklären, was einen an schöner Prosa begeistert. Was den Unterschied macht zwischen einem Gedanken, einer Szene, einem Bild, das jemand halt irgendwie aufschreibt – und einer Passage, die das Gemeinte auf einzigartige Weise ausdrückt: mit einem verblüffenden Sprachbild zum Beispiel (»Ich trinke Sterne«), mit einem Gedankenstrich an der richtigen Stelle, mit einem überraschenden Adjektiv, mit Rhythmus, einer Melodie, mit einem ganz eigenen, magischen Sound.
Man erkennt diese Stellen sofort. Weil man innehält, weil man zurückliest, weil man staunt. Und sich freut. Und die Stelle herausreißt. Oder sie auf dem Smartphone archiviert. Oder sie ausdruckt und zu den anderen legt, in die Schublade mit den »Stellen«, die in Wahrheit eine Schatztruhe ist.
Erich Kästner zum Beispiel, in seinem Fliegenden Klassenzimmer, als Martin, der Klassenprimus, sich in den verschneiten Park schleicht, weil er mit seinem Kummer endlich allein sein will. Und der Lehrer ihm nachgeht und dann erst einmal stumm danebensteht, weil er weiß, wie Kummer sich anfühlt. »Er wusste«, schreibt Kästner, »dass man mit dem Trösten nicht zu früh beginnen darf.«
Karl Marx und Friedrich Engels, das Kommunistische Manifest mit seiner siegesgewissen Revolutionserwartung: »Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen.«
Friedrich Wilhelm Murnau, ein Zwischentitel in seinem stummen Vampirfilm »Nosferatu«, selten hat sich Unheil beiläufiger angekündigt: »Als er die andere Seite der Brücke erreichte, kamen ihm die Phantome entgegen.«
Oder Otfried Preußler, der den Räuber Hotzenplotz erfand und seinen Roman Krabat so enden lässt: »Während sie auf die Häuser zuschritten, fing es zu schneien an, leicht und in feinen Flocken, wie Mehl, das aus einem großen Sieb auf sie niederfiel.«
Die Amerikaner, die vor allem, lieben das Sammeln von Stellen. Von ersten und letzten Sätzen, von Prosapassagen und Absätzen, das Internet ist voll mit Listen und Rankings. Die 34 besten Romananfänge aller Zeiten; die 100 schönsten Sätze der Literaturgeschichte, alles mind-blowing und most beautiful. Und jeder Fund, jeder Hinweis eine Einladung, ein Buch, einen unbekannten Autor, eine Schreibschule zu entdecken.
Wie es ja ohnehin zu dieser seltsamen Passion gehört, sich treiben zu lassen. Von Buch zu Buch, von Autor zu Autor, von Zitat zu Gedicht zu Zeile zu Aphorismus, einmal quer durch die Literaturgeschichte, von Büchner zu Kafka zu Rosa Luxemburg zu Wolfgang Herrndorf zu den Känguru-Chroniken und wieder zurück.
Vor Kurzem las ich, dass Vladimir Nabokov, der Lolita-Autor, in den Büchern anderer »magische Stellen« suchte. Ein schöner Kompromiss, möglicherweise: Schmetterlinge zu sammeln für den Party-Smalltalk – und Magie für die Zeit zwischen den Partys. Weil man mit Schönheit, mit Anschaulichkeit, mit Eleganz ziemlich gut durch den Alltag kommt, wenn man beruflich etwas mit Schreiben zu tun hat, aber auch sonst.
Seit zwei Jahren habe ich auf SPIEGEL.de die Kolumne »Schöner schreiben«. Ein leicht missverständlicher Titel, die Leser könnten annehmen, ich würde eine Art Schreibtraining anbieten. Dabei will ich vor allem teilen: meine Fundstücke, das zuallererst, meine Begeisterung für Eleganz und sprachliche Schönheit, meine Freude über »Stellen«.
Ein Spiel, mehr nicht. Und wie alle Spiele nur absolut ernsthaft zu betreiben, weil sich Schönheit nur so angemessen feiern lässt. Und was die Ernsthaftigkeit angeht: Man liest ja im Übrigen auch, weil man sich Hinweise erhofft. Darauf, wie man Stil und Substanz verbindet, wie das Leben gelingt, was das alles hier bedeuten soll. Da hilft es natürlich, wenn ein anderer schon etwas begriffen hat, während man selbst noch tastet. Ich verliere nie. Niemals wirklich.
Eine Sucht, das auch. Der Schriftsteller Jörg Fauser, der sich mit Süchten auskannte, hat sein Schreiben einmal so beschrieben: »Immer auf der Suche nach einem Satz, der mehr sagt, als du weißt …«
Die Leserinnen und Leser meiner Kolumne haben das Spiel sofort angenommen. Einer bezeichnete die kleinen Texte als »Amuse-Gueules«, für einen anderen sind die Kolumnen »wie eine Windharfe im Maschinengewehrgeknatter« des Nachrichtengeschäfts. Schön.
Manche schicken Vorschläge. Jeder Vorschlag ist willkommen, auch wenn nicht jeder Vorschlag in eine Kolumne mündet. Ein sehr großer Dank gilt Ernst Mannheimer, der seine eigenen Fundstücke (und seine Begeisterung für Kunst, für Literatur, für Kluges aller Art) mit verschwenderischer Großzügigkeit teilt. Ich verdanke ihm zahllose großartige Stellen; einige finden sich in diesem Buch wieder.
Schiller also und Christian Kracht, Rahel Varnhagen und Joschka Fischer, Benjamin von Stuckrad-Barre und Hiob, die Eiseskälte von Alfred Kerr, die selbstverzückte Bewunderung von Thomas Mann: 50 »Stellen«, 50 Glücksmomente. Und 50 Verneigungen, das vor allem.
Die Vermessung der Komik
Geschichten wisse er keine, sagte Humboldt und schob seinen Hut zurecht, den der Affe umgedreht hatte. Auch möge er das Erzählen nicht. Aber er könne das schönste deutsche Gedicht vortragen, frei ins Spanische übersetzt. Oberhalb aller Bergspitzen sei es still, in den Bäumen kein Wind zu fühlen, auch die Vögel seien ruhig, und bald werde man tot sein.
Alle sahen ihn an.
Fertig, sagte Humboldt.
Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt
die frage »wasist komik?« ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Wie stellt man Komik her? Was an Komik ist eigentlich komisch, und für wen? Kann jemand komisch sein, der keinen Humor hat? Oder ist Humorlosigkeit vielleicht sogar die Voraussetzung für Komik?
Komisch wirke jeder Mensch, der seinen Weg verfolge, ohne sich um den Kontakt mit den anderen zu bekümmern, schrieb der Philosoph Henri Bergson 1900 in einem Essay, dem er den Titel Le Rire gab, zu Deutsch: Das Lachen.
Am komischsten sind Geschichten, die von jemandem handeln, der selbst nicht komisch ist – und der genau das nicht weiß. Der den Unterschied zwischen Ernst und Komik nicht erkennt, weil er Komik nicht kennt. Weniges ist unterhaltsamer als ein Mensch, der keinerlei Gespür für Witz, für Timing, für Pointen hat – und der sich daranmacht, einen Witz (oder eine Geschichte) zu erzählen.
1780 schrieb Johann Wolfgang von Goethe ein Gedicht, das er »Wanderers Nachtlied« nannte. Es ist ebenso schön wie kurz:
Über allen Gipfeln
Ist Ruh’,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Zwei Jahrhunderte später hat Goethes Gedicht in Daniel Kehlmanns Roman Die Vermessung der Welt einen grandiosen Auftritt. Kehlmann erzählt, wie sich zwei kauzige Genies Anfang des 19. Jahrhunderts aufeinander zubewegen: der Mathematiker Carl Friedrich Gauß und der Naturforscher Alexander von Humboldt.
Humboldt war bemerkenswert neugierig. Er fuhr in Bergwerke ein und schlug sich durch den Amazonas-Dschungel, bestieg Vulkane, maß die Temperatur von Meeresströmungen und bestimmte die Bläue des Himmels.
Kehlmann beschreibt, wie Humboldt, gemeinsam mit seinem Gefährten Bonpland, im Jahr 1802 den Chimborazo besteigt, den höchsten Berg Ecuadors. Träger begleiten die beiden. Humboldt ist im Frack unterwegs, mit weißer Halsbinde und rundem Hut, dazu trägt er dünne Stiefel. Das ist nach der Mode der Zeit, praktisch ist es nicht. Denn der Chimborazo ist mehr als 6000 Meter hoch, die beiden leiden unter Schwindel und Brechreiz, sie bluten aus Lippen und Zahnfleisch. Bald verlangt es die Gefährten nach Ablenkung.
Geschichten wisse er keine, sagt Humboldt – ein Welterforscher, der inwendig leer ist. Eine Geschichte ist ja nichts anderes als das Destillat einer Erfahrung. Wozu bereist einer die Erde, wenn er am Ende nichts erzählen kann?
Weil Humboldt keine eigene Geschichte parat hat, muss er sich eine fremde borgen. Zum Glück fällt ihm Goethes Gedicht ein. Alexander von Humboldt, der nicht erzählen kann, der letztlich auch nichts zu sagen hat, versucht sich an der größten Erzählung von allen: dem Leben und Sterben des Menschen, Todesnähe und Vergänglichkeit.
Aus Poesie macht dieser Humboldt alsdann Prosa, plattfüßige, leblose Prosa, zielstrebig und mit missmutiger Gründlichkeit: »in den Bäumen kein Wind zu fühlen«. Es steigert das Vergnügen erheblich, dass Kehlmann dieses Desaster im Konjunktiv erzählt, mit großer ironischer Distanz, als würde er seine Figuren durch ein umgedrehtes Fernglas beobachten: »Auch die Vögel seien ruhig.«
Humboldts Blick auf die Welt ist bei Kehlmann der Blick eines Sammlers, der Blätter presst oder Käfer auf Nadeln spießt. Humboldt zeichnet, was er sieht, er bestaunt, was er zeichnet, aber er versteht nicht, was er bestaunt. Die Schätze, die er zusammenträgt, machen ihn nur reicher, nicht tiefer. Bald, sagt Humboldt, werde man tot sein.
Komisch ist das, weil Humboldt dabei vollkommen ernst ist. Weil es Humboldt vollkommen ernst ist, während seine Zuhörer allmählich versteinern. Sie sind nicht vorbereitet auf einen, der am Chimborazo, in weißer Halsbinde und mit blutenden Lippen, ohne jede Regung mal so eben eines der schönsten deutschen Gedichte zerstört.
Und was sagt Humboldt, nachdem das Werk vollbracht ist, nach einer Geschichte, die keine ist, nach einer Übersetzung, die nichts übersetzt? »Fertig.« Mehr nicht.
Gibt es etwas Lustigeres? Und zugleich Traurigeres?
Schweigsame Sterne, vergeblich befragt
Immer gleich blau und spiegelnd das Meer, immer gleich wolkenlos und glühend der Himmel, immer gleich stumm, gleich tonlos die Luft, immer gleich weit und gleich rund der Horizont, ein metallener Schnitt zwischen demselben Himmel und demselben Wasser, der allmählich sich tief ins Herz schneidet. Immer das gleiche riesige blaue Nichts um die winzigen Schiffe, dies einzig Bewegte inmitten der gräßlichen Unbewegtheit, immer das gleiche grausam scharfe Licht des Tags, in dem man nur immer das Eine, das Gleiche, dasselbe gewahrt, und immer des Nachts die gleichen kalten und schweigsamen Sterne, die vergeblich befragten.
Stefan Zweig, Magellan. Der Mann und seine Tat
seit der mensch seine Heimat verließ, um jenseits des Horizonts nach fruchtbareren, schöneren Flecken zu suchen, weiß er, dass das Meer sehr groß sein kann. »Wie viele Himmel und wie viele Länder ist es wohl her/Seit wir draußen sind auf dem Meer«, dichtete Rio Reiser, und Hans Albers, der vom Meer eine Menge und von Sehnsucht womöglich noch mehr verstand, sang: »Wie blau ist das Meer, wie groß kann der Himmel sein?/Ich schau’ hoch vom Mastkorb weit in die Welt hinein.«
Stefan Zweig folgt Magellans Reise ins Unbekannte, Unerforschte, die am Ende eine Reise in den Tod sein wird. Ferdinand Magellan war Kaufmann. Er wollte auf dem kürzesten Weg zu den Gewürzinseln gelangen und auf dem schnellsten Weg reich werden. Der Missionar Bartolomé de las Casas beschrieb ihn als »unscheinbar« und »wacker in seinen Gedanken und zu großen Taten aufgelegt«.
Zweig feiert diesen Magellan als größten Seefahrer aller Zeiten. Der Portugiese hat auf seiner Route gen Westen tatsächlich einen paso gefunden, an der Südspitze Südamerikas, einen Durchlass, die später nach ihm benannte Magellanstraße; von dort aus will er weiter nach Westen, zu den Gewürzinseln, und dann zügig nach Hause. Doch der Stille Ozean, der ihn und seine Männer von der Heimat trennt, ist größer als erwartet. Wer vom Mastkorb in die Welt hineinschaut, sieht sehr wenig Welt und sehr viel Nichts.
Stefan Zweig, der vom Meer einiges und noch mehr von der Verzweiflung verstand, beschreibt die Eintönigkeit durch ein vierfaches »immer gleich« – was überhaupt nicht eintönig wirkt, sondern, im Gegenteil, drängend, beklemmend. Und wie findet Zweig von der Weite des gleichgültigen Ozeans zurück zum Menschen, zum Gefühl? Durch den Schnitt, der das Meer vom Himmel trennt und der, allmählich natürlich, tief ins Herz geht. Worauf Zweig, der von der Sprache mindestens ebenso viel verstand wie von der Verzweiflung, das »immer gleich« vom Anfang wiederaufnimmt und variiert: immer das gleiche Nichts, immer das gleiche Licht.
Und was sieht man, wenn es nichts zu sehen gibt? Das eine, das Gleiche, dasselbe, und zwar: immer. Die Männer auf Magellans Schiffen waren der gleißenden Leere so sehr ausgeliefert, dass sie irgendwann anfingen, Leder zu rösten und Ratten zu essen.
Siebenmal hat Zweig bis hierhin das Wort »immer« verwendet, und weil die Verzweiflung erst nachtschwarz werden muss, bevor es mit der Geschichte weitergehen kann, folgt ein achtes »immer«: schweigsame Sterne, immer des Nachts vergeblich befragt.
Weil aber selbst das endloseste Meer ein Ufer hat, erreichte Magellan mit seinen Schiffen irgendwann Land. Darum ging es, darum geht es immer, bis heute: zu wissen, dass es einen Weg gibt, aufzubrechen, um diesen Weg zu finden, heimzukehren, um die Gewissheit zu verkünden. Und vorher die Ungewissheit auszuhalten, die schreckliche Angst, dass alles doch nur ein Irrtum sein könnte, ein Missverständnis.
Magellan selber wurde dann auf einer Philippinen-Insel erschlagen. Seine Leute (18 von anfangs über 200) liefen am 6. September 1522, nach beinahe drei Jahren, zerlumpt, entstellt und längst vergessen in den Hafen von Sevilla ein.
Stefan Zweig, Österreicher und »Jude aus Zufall«, veröffentlichte sein Magellan-Buch im November 1938, wenige Monate nach dem sogenannten Anschluss seines Heimatlandes ans Deutsche Reich. Bald darauf ging er, gemeinsam mit seiner Frau, nach Brasilien, »nachdem die Welt meiner eigenen Sprache für mich untergegangen ist«, wie er in seinem Abschiedsbrief schrieb.
Ein »herrliches Wagnis« hatte er die Ausfahrt der fünf winzigen Schiffe genannt, »zum heiligen Menschheitskrieg wider das Unbekannte«.
Ein Wagnis und eine Zumutung war es für Zweig, fern der geistigen Heimat Europa das Leben »vom Grunde aus« neu aufzubauen. Nach dem sechzigsten Jahre, schrieb er, »bedürfte es besonderer Kräfte, um noch einmal völlig neu zu beginnen«. Es sollten seine letzten Worte sein. Zweig spürte diese Kräfte nicht mehr, er war verzweifelt und erschöpft.
Im Februar 1942 nahmen er und seine Frau sich in Petrópolis das Leben.
Eine verzweifelte Liebe im Exil
Bis zur Erschöpfung spielte er zuweilen die Rolle eines von ihm erfundenen Menschen, der Eigenschaften und Empfindungen in sich barg, die er selbst nicht hatte. Es gelang ihm nicht, an seine Rolle zu glauben, doch er empfand flüchtige Genugtuung und Trost, wenn er andere daran glauben machen konnte. Seine eigene Persönlichkeit war viel zu stark, um nicht immer wieder das erfundene Schattenwesen zu durchtränken, und so empfand er sich manchmal als ein seltsam wandelndes Gemisch von Dichtung und Wahrheit, das ihn selbst zu einem etwas erschrockenen Lachen reizte.
Irmgard Keun über Joseph Roth
die sprache istdas, woran man sich klammert, wenn man alles andere verloren hat: das Zuhause, die Heimat, die Hoffnung.
Die junge Schriftstellerin Irmgard Keun hatte den berühmten Autor Joseph Roth im belgischen Seebad Ostende kennengelernt, während der Emigration; ein kurzes Innehalten auf der Flucht vor den Nazis. Keun, 31 Jahre alt, hatte »das Gefühl, einen Menschen zu sehen, der einfach vor Traurigkeit in den nächsten Stunden stirbt«. Roth, sagte sie später, war verzweifelt, aber er war auch »der beste und lebendigste Hasser«.
Hass war ihr Stimulans und auch seins. Beide hatten Deutschland verlassen müssen. Roths Bücher waren von den Nazis verbrannt, Keuns Bücher waren verboten worden. Beide waren entwurzelt, verloren, einsam zu zweit. Von 1936 bis 1938 waren sie ein Paar.
Beide tranken: Keun heftig, Roth außerordentlich heftig. Er trank gegen seine Einsamkeit und gegen die Unsicherheit, er trank, weil seine Frau an einer unheilbaren Nervenkrankheit litt, er trank, als sie an Schizophrenie erkrankte. Der Alkohol machte ihn ruhelos, die Ruhelosigkeit bekämpfte er mit Alkohol. »Noch nie«, sagte er, »hat einem Alkoholiker der Genuss des Alkohols so wenig gefallen wie mir.«
Roth trank, um zu schreiben, er schrieb, um trinken zu können. Er trank, weil Hitler 1933 an die Macht gelangt war, er trank, weil seine Heimat Österreich sich 1938 jubelnd ans Deutsche Reich anschloss. »Um Gottes willen, Freund, sammeln Sie sich«, bat Stefan Zweig, »ich habe zum erstenmal wirkliche Angst um Sie. Machen Sie mit dem Saufen Schluß!«
Zweig bat vergebens, Keun und Roth waren Gefährten auf abschüssiger Bahn. Irmgard Keun brauchte den Alkohol, um frei zu werden fürs Schreiben, Roth trank, um sich frei zu machen von den Beschwernissen des Lebens – und um klarer zu sehen. Unter ein Selbstbildnis schrieb er: »Böse, besoffen, aber gescheit.« Beide tranken gegen den Untergang ihrer Welt an, gegen den Untergang der Welt überhaupt, gegen das eigene Versinken. Das passte eine Weile zusammen und dann nicht mehr.
Wobei etwas nicht zu Ende sein muss, nur weil es vorbei ist. Manches dauert fort, mitunter tiefer als zuvor. Wie aber blickt man auf einen Menschen zurück, den man verlassen musste, aber nicht vergessen kann?





























