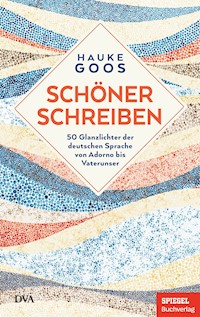19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Deutsche Verlags-Anstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Messer, ein leerer Koffer, ein Paar Handschuhe aus Jute: Was Alltagsgegenstände heute noch über den Krieg erzählen – prominente und unbekannte Kriegskinder und -enkel berichten
In vielen Familien ist der Zweite Weltkrieg bis heute präsent, manchmal in ganz alltäglichen Dingen: einem Kleiderbügel, den die Mutter auf der Flucht dabeihatte, einer Keksdose, die für eine verlorene Kindheit steht, oder einer Trillerpfeife, die dem Vater gehörte, der aus dem Krieg nicht zurückkam. Mit ihnen verbindet sich die Erinnerung an Zeiten voller Angst und Leid, für die die Menschen, die sie oft noch als Kind miterlebt haben, zuweilen keine Sprache finden.
Annette und Hauke Goos stellen 36 solcher Erinnerungsstücke vor und bringen ihre Besitzer, darunter prominente Stimmen wie Björn Engholm, Marie-Luise Marjan, Paul Maar, Rita Süssmuth und Peter Stephan Jungk, zum Erzählen: Die so entstandenen Gesprächsprotokolle geben Zeugnis davon, welche seelischen Verwüstungen Krieg selbst in der Kinder- und Enkelgeneration hinterlässt. Und sie zeigen, wie die Gegenstände uns helfen können, unsere Eltern (besser) zu verstehen. Die beeindruckenden Geschichten und Menschen hinter den Gegenständen werden von dem Fotografen Dmitrij Leltschuk einfühlsam in Szene gesetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
In vielen Familien ist der Zweite Weltkrieg bis heute präsent, manchmal in ganz alltäglichen Dingen: einem Kleiderbügel, den die Mutter auf der Flucht dabeihatte, einer Keksdose, die für eine verlorene Kindheit steht, oder einer Trillerpfeife, die dem Vater gehörte, der aus dem Krieg nicht zurückkam. Mit ihnen verbindet sich die Erinnerung an Zeiten voller Angst und Leid, für die die Menschen, die sie oft noch als Kind miterlebt haben, zuweilen keine Sprache finden.
Annette und Hauke Goos stellen 36 solcher Erinnerungsstücke vor und bringen ihre Besitzer, darunter prominente Stimmen wie Björn Engholm, Marie-Luise Marjan, Hanna Schygulla, Rita Süssmuth und Peter Stephan Jungk, zum Erzählen: Die so entstandenen Gesprächsprotokolle geben Zeugnis davon, welche seelischen Verwüstungen Krieg selbst in der Kinder- und Enkelgeneration hinterlässt. Und sie zeigen, wie die Gegenstände uns helfen können, unsere Eltern (besser) zu verstehen.
Die beeindruckenden Geschichten und Menschen hinter den Gegenständen werden von dem Fotografen Dmitrij Leltschuk einfühlsam in Szene gesetzt.
Zu den Autoren
Annette Goos, Jahrgang 1967, studierte Psychologie und Publizistik, bevor sie als Reporterin zum Fernsehen ging. Seit ein paar Jahren verfasst sie unter dem Titel »100 Fragen – eine Bilanz« Biografien.
Hauke Goos, Jahrgang 1966, arbeitete nach dem Geschichtsstudium zunächst für das SAT.1-Magazin »Akte«, ehe er 1999 zum Magazin SPIEGELreporter kam. Von 2001 bis 2022 schrieb er für das Reportagenressort des SPIEGEL, heute leitet er dort das Sportressort. Bei DVA sind bislang von ihm erschienen »Ein Sommer wie seither kein anderer« (zusammen mit Alexander Smoltczyk, 2021) und der Kolumnenband »Schöner schreiben« (2021).
Annette und Hauke Goos haben vier Kinder und leben in Hamburg.
Besuchen Sie uns auf www.dva.de
ANNETTE GOOS · HAUKE GOOS
Warum hängt daran dein Herz?
Wie Erinnerungsstücke aus der Kriegszeit helfen, unsere Eltern zu verstehen
Deutsche Verlags-Anstalt
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2024 by Deutsche Verlags-Anstalt, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München,
und SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co.KG, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg
Bildbearbeitung: Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt
Umschlagabbildungen: Dmitrij Leltschuk, Tinka Dietz/DER SPIEGEL (vorne); Dmitrij Leltschuk (hinten)
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31809-3V003
www.dva.de
Inhalt
Vorwort
»Mich hat auch nie jemand gefragt, wie es mir geht«Reinhold Bussmann
»Die haben dann tatsächlich auf uns geschossen!«Barbara Langner
»Ich hätte gern diesen Vater gehabt«Andreas Borchert
»Das tut weh. So etwas vergisst man nicht«Marie-Luise Marjan
»Mein Vater wollte die Kontrolle über sein Leben zurückgewinnen«Geoff Kronik
»Ich stelle mir vor, wie verzweifelt mein Vater war, als er in diesen Kalender schrieb«Rüdiger Schulz
»Ich fragte: ›Mami, lebst du noch?‹ Aber sie gab keine Antwort«Jutta Montag-Assamoi
»Welchen Preis ist man bereit zu zahlen, um seinen Werten treu zu bleiben?«Björn Engholm
»Die Mädchen sagten: Der Heino ist dumm, der kann das nicht«Heino Susott
»Der Kleiderbügel erinnert mich daran, was meine Mutter durchgemacht hat«Regina von Horn
»Erst im Alter wurde mir klar, dass ich immer die Sehnsucht nach einem Vater in mir hatte«Dietrich von Horn
»Das ist das Problem meines Lebens geworden: Ich bin nicht genug«Hanna Schygulla
»Was Krieg zerstören kann, das habe ich bei meiner Mutter erlebt«Klaus Lantermann
»Und dann ist dieses Leben plötzlich ausgelöscht, einfach so«Waltraut Staffeldt
»Ich bin vor Heimweh beinahe zugrunde gegangen«Walter Schmidt
»Jedes neue Fluchtziel schrieben sie in den Deckel dieses Koffers«Maren Schmücker
»Die Angst sitzt mir tief in den Knochen. Mir fehlt das Urvertrauen«Rainer Maria Kohler
»Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater mich je gelobt hätte«Friedrich Wilhelm Huckenbeck
»Eines wusste ich ganz sicher: Wenn ich einmal Kinder haben würde, dann wollte ich auf keinen Fall so werden wie mein Vater«Gespräch mit Paul Maar, Sohn Michael und Enkel Bruno
»Dieses Messer trug meine Mutter immer in ihrer Rockfalte«Andrea Dickel
»Ich suche noch heute nach der Liebe meines Vaters. Obwohl ich ihn zutiefst verachte«Niklas Frank
»Für Schwäche hatte mein Vater wenig übrig«Maren Hoffmann
»Ich sah, wie Menschen Tote auf Schubkarren wegtransportierten«Helmut Scherb
»Mein Vater sagte: Man muss ihnen die Hand reichen, man muss vergeben können«Peter Stephan Jungk
»Ich kann nicht sagen, dass meine Mutter mir fehlt«Cordula Hill-Ebenau
»Meine Großmutter sagte, das schaffen wir noch«Dirk Langner
»Ich habe jahrelang auf meinen Vater gewartet«Renate Bienzeisler
»Und dann kommt alles wieder hoch, dann gerate ich in Panik«Gerhart Baum
»Es tut mir leid, dass ich kein besseres Bild von meinem Vater habe«Erhard Brüchert
»Die geschmolzenen Löffel sind für mich ein Sinnbild für Krieg und Gewalt«Anne-Katrin Hoestermann
»Den Panzer hat meine Mutter immer in Ehren gehalten«Manfred B. Müller
»Der Becher erzählt all das, worüber mein Vater nicht reden wollte. Sein ganzes beschädigtes Leben ist in diesem Becher drin«Günter Kern
»Es erinnerte meine Mutter an die Zeit, als alles noch möglich schien«Christel Platz
»Wir haben Hitler anfangs nicht ernst genommen. Wir haben dafür bezahlt«Josef Eisinger
»Natürlich sind aus der Kriegszeit Narben geblieben. Aber auch die Narben geben Kraft«Rita Süssmuth
»Ich musste im Heim bleiben, es durfte ja niemand erfahren, dass es mich gibt«Wolfgang Asser
»Eine Kindheit, die ich nie hatte«Jürgen Coprian
»Wir Babyboomer sind groß geworden mit Sätzen wie: Stell dich nicht so an! Was sollen die Nachbarn denken?«Interview mit der Therapeutin Ingrid Meyer-Legrand
Vorwort
»Viele Kriegskinder befürchten: Wenn ich über die Schreckensbilder rede, öffnet sich eine Schleuse, und diese Schleuse kann nie wieder geschlossen werden. Dann kann ich den Strom des Schmerzes nicht mehr stoppen.«
Ingrid Meyer-Legrand, Therapeutin
An einem Spätsommertag des Jahres 2023 saßen wir mit dem Schriftsteller Paul Maar in der Berliner Altbauwohnung seines Sohnes zusammen und sprachen über Krieg. Über den Zweiten Weltkrieg, aber auch über Krieg im Allgemeinen. Seit der russische Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 den Krieg zurück nach Europa gebracht hatte, war das Thema von beunruhigender Aktualität.
Maar war sieben, als der Zweite Weltkrieg endete. Drei Jahre später kehrte sein Vater aus der Gefangenschaft nach Hause zurück. Wir wollten mit ihm darüber sprechen, was Krieg zerstört, welche Spuren er hinterlässt; was vom Krieg bleibt, auch wenn längst wieder Frieden ist.
Der Krieg, sagte Maar, habe seinen Vater verändert. Auf alten Fotos sei zu erkennen, dass er ein liebevoller Vater gewesen war. Später gab er seinem Sohn aus kleinsten Anlässen Ohrfeigen oder verprügelte ihn in der Waschküche mit einem Stück Gartenschlauch, das er sich eigens für diesen Zweck zurechtgeschnitten hatte.
Maar hat Generationen von Kindern mit seinen »Sams«-Büchern glücklich gemacht. Es sind heitere Bücher, aber manchmal meint man beim Lesen, einen Schatten wahrzunehmen, der über den Figuren liegt. Die Sams-Geschichten handeln von der Welt, wie sie ist, sie erzählen aber auch von einer Welt, wie sie sein könnte – wenn man einen Gefährten wie das Sams hat und wenn man die Wunschpunkte klug nutzt.
Mit seinem Vater, sagte Maar, habe er nie über dessen Kriegserlebnisse gesprochen. Es ging nicht: Der Sohn konnte nicht fragen, der Vater wollte nicht erzählen. Irgendwann war der Vater tot, aber das Bedauern, mit ihm nicht ins Gespräch gekommen zu sein, ist Paul Maar geblieben. »Ich hätte mich gern noch mit ihm über meine Kindheit und über die Schläge unterhalten«, sagte Maar an diesem Spätsommertag nach einer langen Pause, seine Stimme klang ein wenig brüchig. »Und ihm erzählt, dass mir das schon damals sehr weh getan hat. Und dass das unser Verhältnis vielleicht sogar ein bisschen eingetrübt hat.«
Von Eintrübungen erzählt dieses Buch. Von Beschädigungen, die von der Generation der Eltern an die Generation der Kinder weitergegeben wurden, von Gewalt, von Schmerz. Und von einer großen Sprachlosigkeit, auf beiden Seiten. Auch beinahe achtzig Jahre nach Kriegsende gibt es unter den Überlebenden fast nur Versehrte.
Der Zweite Weltkrieg hinterließ allein in Deutschland 1,7 Millionen Witwen und 2,5 Millionen Halb- und Vollwaisen. 500000 Menschen waren bei Bombenangriffen ums Leben gekommen, bis zu 600000 starben auf der Flucht. Schätzungen zufolge wuchs etwa ein Viertel der zwischen 1929 und 1945 Geborenen in dauerhafter Armut und Unsicherheit auf, bei einem weiteren Viertel waren die familiären, sozialen oder materiellen Umstände über einen langen Zeitraum prekär.
Historiker fassen diese Jahrgänge unter dem Begriff »Kriegskinder« zusammen, deren Kinder wiederum werden »Kriegsenkel« genannt. Es ist die Generation der Babyboomer, die lange auf Distanz zu den eigenen Eltern gegangen war, weil sie deren Gefühlsarmut, das übergroße Sicherheitsbedürfnis und den Pragmatismus nur schwer ertrug – und die jetzt überrascht feststellt, dass vieles von dem, was sie an den eigenen Eltern störte, in ihnen fortlebt.
Die Babyboomer fragen sich: Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn sie von Menschen geprägt wurde, die als Kinder miterleben mussten, wie ihre Welt in Trümmer fiel? Die Zeugen wurden von Tod und Verwüstung, von Vertreibung und Hunger, die aufwuchsen mit dem Gefühl von Verlassenheit und völligem Ausgeliefertsein. Von Menschen, die über ihre Erlebnisse nie gesprochen haben – weil sie es nicht konnten oder weil niemand fragte. Wie sollten gerade sie ihren Kindern Lebenszuversicht und Selbstvertrauen vermitteln?
Im August 2019 erschien im SPIEGEL ein Artikel, in dem Kriegskinder und Kriegsenkel zu Wort kamen. Sie alle hatten einen Gegenstand aus der Kriegszeit aufbewahrt: Erbstücke von den Eltern, Erinnerungen an die eigene Kindheit, an ein Leben, in dem nichts sicher war, aber alles existenziell; Kindheitstrümmer, im Wortsinn.
Es waren gewöhnliche Dinge: Mal war es eine Munitionskiste, in der seit jeher das Schuhputzzeug lag, mal eine gusseiserne Kuchenform, die die Mutter mit auf die Flucht genommen hatte, mal eine Holzschachtel für Zigaretten, in deren Deckel Ortsnamen eingebrannt waren: Reval, Schwarzes Meer, Kaukasus.
Relikte des Krieges, Zeugen der Zerstörung. In vielen deutschen Haushalten sind sie zu finden, viele von ihnen bis heute im alltäglichen Gebrauch. Wenn die Menschen keine Worte fanden, um das Grauen zu beschreiben, dann würden eben die Gegenstände sprechen, das war die Idee.
Das Echo auf den Artikel war überwältigend.
»Mein Großvater hat den Krieg überlebt«, schrieb ein Leser. »Als Soldat der Wehrmacht, buchstäblich von der ersten bis zur letzten Minute. 1939 eingezogen und in den letzten Kriegstagen in Gefangenschaft gekommen. Keines seiner vier Kinder konnte glückliche Familien aufbauen. Überall Tod, Suizide, Scheidung, Gewalt.«
»Meine Schwiegermutter kann bis heute nicht von ihrer Flucht erzählen«, schrieb ein anderer. »Das Erlebte ist für sie zu fürchterlich, um es dadurch noch mal zu erleben.«
»Mittlerweile lebt mein Vater nicht mehr«, schrieb ein Dritter, »mit ihm wurden seine Gemeinheiten und meine Traumata begraben. Ich bin, so schlimm es ist zu schreiben, froh, dass er weg ist.«
Was für ein Satz.
Offenbar hatten die Gegenstände etwas ausgelöst. Vielleicht fiel es den Menschen leichter, über etwas Abstraktes wie Angst, Einsamkeit, Trauer oder Zerstörung zu sprechen, wenn man sie nach etwas Konkretem fragte. Nach Dingen, auf denen sich die Erinnerung an den Krieg abgelagert hat, in denen die traumatischen Erlebnisse der Kriegszeit eingeschlossen sind wie in Bernstein.
Und so entstand dieses Buch. Indem wir über die Geschichte von Gegenständen sprachen, hofften wir herauszufinden, welche Spuren der Krieg in den Seelen ihrer Besitzer hinterlassen hat. Woher all die Verhaltensauffälligkeiten kommen, die verharmlosend »Macken« genannt werden und die oftmals – wie wir heute wissen – sichtbarer Ausdruck eines Traumas sind.
Sechsunddreißig Gespräche sind es am Ende geworden. Sechsunddreißig Begegnungen, intensiv und häufig aufwühlend, in denen die Befragten nach lang verschütteten Bildern suchten, in denen sie um die richtigen Formulierungen rangen und oftmals still wurden, wenn sie die Erinnerungen wieder einholten; manche weinten.
Die Kriegskinder waren es gewohnt, allenfalls in kleinen Geschichten von ihren Erlebnissen zu erzählen: die tiefgehende, gründliche Zerstörung verkleinert zur Anekdote, der Schrecken aufgelöst in eine Pointe. Nur so, erklärte uns die Therapeutin Ingrid Meyer-Legrand später, sind die Kriegskinder in der Lage, überhaupt über das zu sprechen, was sie traumatisiert hat.
Und so wollten auch unsere Gesprächspartner zunächst vor allem erzählen, wie sie im Krieg und in den Monaten danach gelebt hatten, wie es im Luftschutzkeller gewesen war oder auf der Flucht. Wir hingegen wollten wissen, was diese Erlebnisse mit ihnen gemacht haben. Wie sich der Krieg auf ihr weiteres Leben ausgewirkt hat, auf ihren Alltag, auf ihre Träume. Auf das Verhältnis zu ihren Kindern – zu uns also.
Sie berichteten auf der Sachebene, uns interessierte die Gefühlsebene; sie redeten vom scheinbar Unwesentlichen, um ans Wesentliche nicht rühren zu müssen.
Die Generation der Kriegskinder hat nie gelernt, über ihr Inneres zu sprechen, erklärte uns die Therapeutin: Weil es sie als Subjekt, mit eigenen Gefühlen und Bedürfnissen, gar nicht gibt. »Sie sind kaum geübt darin, nach innen zu schauen und zu sagen, wie es ihnen geht und was sie belastet. Das haben sie schlicht nicht gelernt. Die Vergangenheit wird einfach nur als Schwere wahrgenommen, als Last, das ist das höchste der Gefühle.«
Antworten, die wir immer wieder hörten: Das war halt damals so. Das ging den anderen genauso. Darüber habe ich nie nachgedacht. Psychologen nennen das »pathologische Normalität«.
Eine Generation des Wie, nicht des Warum. Eine Generation also, die sich selbst fremd ist.
Mit jedem Gespräch, das wir führten, wurde uns klarer, dass die Gegenstände allenfalls Türöffner waren. Ein Anlass, überhaupt ins Gespräch zu kommen, aber nicht das Hauptthema. Stattdessen ging es bei den Kriegskindern oft sehr bald um das schwierige Verhältnis zu den eigenen Eltern. Zum Vater, der ja meist schon im Ersten Weltkrieg gekämpft hatte und traumatisiert nach Hause gekommen war; zur überforderten Mutter. Bei Kriegsenkeln wiederum war häufig der Schmerz zu spüren, von den eigenen Eltern nicht das bekommen zu haben, was Kindheit ausmacht: Wärme, Geborgenheit, Zuspruch, Anerkennung. Sie beschrieben die Gefühlstaubheit der Eltern, die nicht loben und auch nicht umarmen konnten, denen Struktur, Ordnung und Kontrolle so wichtig war, dass kein Platz blieb für Lebensfreude, Zärtlichkeit und Spontaneität.
Wir Babyboomer sind groß geworden mit Sätzen wie:
Was sollen die Nachbarn denken?
Reiß dich zusammen!
Stell dich nicht so an!
Nimm dich nicht so wichtig!
Ich glaub, dir geht’s zu gut!
Die Fotos in diesem Buch hat Dmitrij Leltschuk gemacht, wir wurden auf ihn aufmerksam, als er vor ein paar Jahren für das SPIEGEL-Buch »Mich hat Auschwitz nie verlassen« Überlebende des Holocaust fotografierte. Sein Blick ist neugierig, genau und voller Wärme, jedes seiner Porträts zeigt die Quersumme eines gelebten Lebens: die Freuden und den Schmerz, Zufriedenheit und Trauer.
Bei den Gegenständen, die Dmitrij fotografiert hat, ist es ähnlich. Wenn man nur genau genug hinschaut, erzählen die Beulen, Schrammen, Abschabungen, Risse und Kratzer, die ihnen eingeschrieben sind, Zeitgeschichte. Seine Fotos erwecken die Dinge zum Leben, gleichzeitig legen sie in den Strukturen und Texturen die Lebensgeschichten ihrer Besitzer frei.
Auf vielen seiner Porträts sind im Hintergrund schwere Möbel zu erkennen, massive Schrankwände, dunkles Holz, Wohnungen, vollgestellt mit Erinnerungsstücken. Wer einmal im Leben alles aufgeben musste, versichert sich auch durch die Wahl des Mobiliars, die Anordnung von Kleinigkeiten, dass er hier, endlich, in Sicherheit ist.
Sechsunddreißig Erinnerungsstücke. Wenn man ihre Geschichten kennt, begreift man, was die Kriegskinder geleistet haben.
Sechsunddreißig Gesprächspartner, der älteste 99, die jüngste 54 Jahre alt. Jede, jeder von ihnen hat seinen eigenen Weg gefunden, mit dem Grauen des Krieges und den Erschütterungen, die er mit sich bringt, fertigzuwerden.
Sechsunddreißig Begegnungen, die uns berührt und bereichert haben – und die uns geholfen haben, auch unsere eigenen Eltern mit anderen Augen zu sehen.
Es bleibt ein Gefühl großer Dankbarkeit. Dank für die Zeit, für die Geduld und für die große Bereitschaft, jede unserer Frage so gut wie möglich zu beantworten, über jeden Einwand nachzudenken.
Für uns Kriegsenkel bleibt die trostreiche Erkenntnis: Auch wenn das Verhältnis zu den eigenen Eltern schwierig war, geht es nicht um Vorwürfe oder Schuld, sondern um Verständnis. Unsere Eltern haben getan, wozu sie in der Lage waren. Beschädigt durch den Krieg, häufig sprachlos gemacht durch das Erlebte, waren sie am Ende immer auch Kinder ihrer Zeit.
Hamburg im Februar 2024
Annette und Hauke Goos
© Dmitrij Leltschuk
»Mich hat auch nie jemand gefragt, wie es mir geht«
Zu seiner Mutter hatte Reinhold Bussmann lange Zeit ein distanziertes, beinahe kaltes Verhältnis. Dass sie sich ein anderes Leben erträumt hatte, begriff er erst, als er nach ihrem Tod ein kleines Portemonnaie in ihrer Schublade entdeckte.
Reinhold Bussmann als Kind
© Dmitrij Leltschuk
Dieses Portemonnaie fand ich nach dem Tod meiner Mutter 2017 in ihrer Nachttischschublade. »Knippke« hieß das bei uns im Osnabrücker Land, wegen des Klickverschlusses. Es ist aus schwarzem Veloursleder, ein wenig riecht es sogar noch nach ihrem Parfum. Meine Mutter nahm es nur zu besonderen Anlässen mit, zu Hochzeiten, oder wenn sie sonntags in die Kirche ging.
Schon bei ihrer standesamtlichen Trauung im Frühsommer 1940 hat sie das Portemonnaie in der Handtasche gehabt. Da war meine Mutter gerade mal 19 Jahre alt. Ihr Mann galt als gute Partie, seine Familie hatte im Nachbardorf eine kleine Tischlerei.
Als ihr erstes Kind geboren wurde, mein Halbbruder, war ihr Mann bereits im Krieg. Er war gleich zu Beginn eingezogen worden und kam nach Frankreich. Sie hatten also kaum Zeit miteinander gehabt. Aber sie hatten Zukunftspläne. Nach dem Krieg, so hoffte meine Mutter, würde sie mit ihm eine große Familie haben. Ein schönes Leben. So war es den Menschen ja versprochen worden: Frankreich würde schnell fallen und Deutschland den Endsieg feiern.
© Dmitrij Leltschuk
Kurz nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion im Sommer 1941 änderte sich schlagartig alles: Der Mann meiner Mutter kam nach Russland, an die Ostfront. Im März 1945, erzählte meine Mutter später, sei er noch ein letztes Mal auf Heimaturlaub bei ihr gewesen. Einige Bauern versteckten ihre Söhne da bereits in den Wäldern, damit sie nicht noch Hitlers Wahnsinn geopfert würden.
Ihr Mann hingegen fuhr in eiserner Pflichterfüllung zurück an die Front. Sie sah ihn nie wieder.
Meine Mutter saß dann mit meinem inzwischen fünfjährigen Halbbruder unversorgt da. Sie lebte im Haus ihrer Eltern und half in deren kleiner Landwirtschaft mit. 20 Mark bekam sie jeden Monat von der Fürsorge, und weil das nicht reichte, musste sie sich etwas hinzuverdienen: Sie schuftete auf großen Bauernhöfen, für 50 Pfennig die Stunde.
Für Trauer war kein Platz. Die Menschen haben die Zähne zusammengebissen, das Leben ging einfach weiter. Mit aller Brutalität.
1949 ließ meine Mutter ihren verschollenen Mann für tot erklären. Sonst hätte sie keine Kriegerwitwenrente bekommen. Bis dahin hatte sie wohl gehofft, er käme doch noch zurück.
Bauernkate der Familie Bussmann, 1944
© Dmitrij Leltschuk
Mit 29 lernte sie dann meinen Vater kennen, er kam aus der entfernteren Nachbarschaft und war zehn Jahre jünger als sie. Gleichaltrige, unversehrte Männer gab es ja nach dem Krieg kaum noch. Geheiratet haben die beiden nicht; die Eltern meines Vaters wollten für ihren Sohn keine Frau, die schon ein Kind hatte und dann auch noch deutlich älter war.
1950 wurde ich geboren. Ich war kein Wunschkind.
Meine Mutter lebte nun mit meinem Halbbruder und mir bei meinen Großeltern. Für sie waren wir Kinder wohl eher eine Belastung. Meine Mutter meinte, sie müsse mich bei jeder Witterung im Kinderwagen nach draußen stellen, auch im Spätherbst. Mit 13 Monaten bekam ich eine Lungenentzündung, an der ich beinahe gestorben wäre. Meine Großmutter erzählte mir später, meine Mutter habe sich geweigert, einen Arzt zu rufen. Heute denke ich, sie wäre vielleicht froh gewesen, wenn ich die Lungenentzündung nicht überlebt hätte. Das sage ich ohne Anklage.
1957 kam ich zur Schule. Zur Einschulung ging ich ganz allein. Auf dem Schulhof standen die Mütter der anderen Kinder und guckten mich an: Wo ist denn deine Mutter? Ich sagte, die ist nicht mitgekommen. Vielleicht, denke ich heute, hat sie sich zu sehr geschämt, weil sie keinen Mann hatte. Was ich früh begriffen habe: dass ich meinen Weg allein gehen muss.
Ich habe angefangen, Geschichten zu erfinden. Wenn jemand fragte: Was macht denn dein Vater?, sagte ich, er sei im Krieg gefallen. Die Leute im Dorf wussten natürlich, dass das nicht stimmen konnte, ich bin ja erst 1950 geboren.
Irgendwann begann ich, meine Mutter nach meinem Vater zu fragen. Aber ich bekam keine Antwort. Nichts. Sie hat nicht ein Wort gesagt. Kinder fragen einmal, vielleicht zweimal, dann nicht mehr. Weil sie denken, sie hätten etwas falsch gemacht.
Gerettet habe ich mich, indem ich mich in die Natur flüchtete. Als Kind war ich immer draußen unterwegs, bin rumgestromert, um der Stimmung zu Hause zu entkommen. Um mir schöne Bilder zu verschaffen. Und ich habe die Welt der Bücher entdeckt, die Literatur.
Natürlich habe ich mich nach einer heilen Familie gesehnt. Aber das Verhältnis zu meiner Mutter blieb kalt und distanziert. Es gab eigentlich keine schönen Momente, keine Zärtlichkeit, kein Lob, keine Anerkennung.
Dabei legte meine Mutter großen Wert auf Umgangsformen. Im Dorf war sie beliebt, immer freundlich gegen jedermann. Sie hat vielen Menschen geholfen und konnte auch andere trösten. Nur ihre eigenen Kinder nicht.
Dreimal wurde ich zur Kur geschickt. Alle Kinder weinten beim Abschied von ihren Eltern – nur ich nicht. Alle hatten Heimweh und wollten nach Hause – ich nicht.
Meine Cousine brachte es später mal auf den Punkt, sie sagte: Du warst über. Für dich hatte niemand Zeit. Dich gab es gar nicht. Du warst nicht vorgesehen. Und das stimmte, sie hatte recht.
Ich habe meine Mutter immer als fremde Frau wahrgenommen, die nur behauptete, meine Mutter zu sein. Als Kind versucht man ja herauszufinden: Wer beschützt mich, bei wem bin ich geborgen? Das waren bei mir die Großeltern, später der Halbbruder. Nicht meine Mutter. Sie war eine Fremde, die im Haus lebte wie ein Schatten. Auf der einen Seite verweigerte sie sich komplett der Mutterrolle, auf der anderen Seite forderte sie, dass ich sie als Autoritätsperson akzeptierte.
Am schlimmsten waren meine ersten zehn Lebensjahre. Wenn meine Mutter sich überfordert fühlte, von der harten Landarbeit, von der Hausarbeit, vom Leben, konnte sie furchtbare Wutanfälle bekommen, dann warf sie auch mal mit Sachen um sich. Einmal hat sie mich mit dem Kopf ins Plumpsklo gesteckt, meine Tante hat mich gerettet. Das war mein furchtbarstes Erlebnis. Ich schreibe gerade meine Lebensgeschichte auf, und ich habe sehr lange gebraucht, um diese Szene überhaupt zu Papier bringen zu können. Um zu begreifen: Ja, das hat diese Frau wirklich getan.
Als Kind hatte ich immer eine unheimliche Wut in mir, eine Wut auf meine Mutter. Ich habe dann auf meine Art Gewalt ausgeübt. Einmal hatte meine Mutter einen neuen Fahrradsattel erworben. Ich holte eine Axt aus dem Schuppen und schlug damit sechs Kerben hinein.
Bussmanns Mutter Elli mit ihrem ersten Mann, 1941
© Dmitrij Leltschuk
Mein Vater spielte in meiner ganzen Kindheit keine Rolle. Er war einfach nicht da. Später hat er wohl geheiratet und mit seiner Frau zwei weitere Kinder bekommen. Im Jahr 2002, da war ich schon 52, rief er mich plötzlich an: Ja, hier ist dein Vater, so meldete er sich. Wir haben beide so getan, als wäre es völlig normal, dass wir mal telefonieren.
Er erzählte, dass seine Frau gestorben sei und dass er sich einsam fühle. Wir vereinbarten, uns zu treffen, um uns kennenzulernen. Er werde mir einen Brief schreiben, sagte er. Aber der kam nie. Irgendwann rief mich meine Mutter an und fragte: Hast du etwas von deinem Vater gehört? Ich sagte, nein. Sie sagte: Von dem wirst du auch nichts mehr hören. Der ist tot.
Als ich zwölf war, lernte meine Mutter einen 16 Jahre jüngeren Mann kennen, einen Vertriebenen. Mit ihm blieb sie über fünfzig Jahre lang zusammen, bis zu ihrem Tod.
Ich mochte diesen Menschen nicht, obwohl er gut zu meiner Mutter war. Ich habe dann zugesehen, dass ich wegkomme, mit 16 zog ich zu meinem Halbbruder nach Bielefeld. Für mich war das eine große Befreiung.
Während meines Studiums arbeitete ich als Privatsekretär bei einer Psychoanalytikerin. Durch sie bekam ich den Anstoß, mich mit meiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es begann eine jahrelange, harte Arbeit. Es war eine Kraftanstrengung, ich habe dabei viele Tränen geweint. Aber ich habe dadurch vieles besser verstanden. Zum Beispiel, warum meine Mutter immer fürchterlich geheult hat, wenn wir in die Kirche gingen oder auf eine Hochzeit. Sie heulte bei jeder Gelegenheit, als Kind war mir das unglaublich peinlich. Heute ist mir klar, dass sie in solchen Momenten an ihre eigene Hochzeit gedacht haben muss, an ihren Verlust, an all die Hoffnungen, die sich nicht erfüllt hatten.
Meine Mutter hat selbst auch nie Liebe erhalten, wie auch? Das Landleben auf dem kleinen Hof ihrer Eltern war schwer, meine Mutter musste von klein auf mithelfen. Es war ein Leben voller Entsagung, voller Härte.
»Mich hat auch nie jemand gefragt, wie es mir geht, beklag du dich also auch nicht«, diesen Satz sagte meine Mutter oft zu mir.
Als ich älter war, mit Ende dreißig, habe ich meine Mutter wieder ab und zu besucht. Freunde hatten mir gesagt: Eltern zu haben, das ist wie Hausaufgaben machen. Das ist Lernen. Es ist besser für dich, wenn du dich an dem Lernprozess beteiligst, auch wenn es dir schwerfällt. Ich habe mir dann tatsächlich Mühe gegeben. Und auch meine Mutter gab sich Mühe. So kamen wir langsam aneinander heran, am Ende hatten wir immerhin ein wenigstens freundschaftsähnliches Verhältnis. Über die Vergangenheit haben wir nie gesprochen. Wenn ich das Thema darauf brachte, fing sie an zu weinen, es hatte dann keinen Sinn weiterzureden.
Also habe ich intellektuell versucht, mich in sie einzufühlen. Ich habe gelernt: Das, was meine Mutter an guten Eigenschaften hatte, war nicht für mich da. Obwohl ich ihr Kind war. Sie hatte sich nach einem anderen Leben gesehnt. Ich musste begreifen, dass ich ihr dieses Leben nicht geben konnte.
Lange hatte ich die Hoffnung: Wenn es meiner Mutter besser geht in ihrem Leben, dann ist vielleicht auch für mich Platz. Aber diese Hoffnung war nicht zu erfüllen. Das war eine Illusion. Die Trauer darüber, dass meine Mutter nicht für mich da sein konnte, wurde ich nie ganz los.
Wenn ich all das heute erzähle, kommt manchmal das Gefühl auf, ich würde meine Mutter verraten. Das vierte Gebot sitzt tief in mir drin: Du sollst Vater und Mutter ehren. Dieses »Es lag doch an dir, dass es nicht funktioniert hat. Du hast Schuld, du hättest deine Mutter mehr lieben müssen, dann hättest du auch mehr zurückbekommen.«
Einschulung 1957
© Dmitrij Leltschuk
Das Portemonnaie habe ich aufbewahrt, weil es mir half, meine Mutter besser zu verstehen. Für mich symbolisiert es den Traum von einem besseren Leben.
Als sie starb, kurz nach ihrem 97. Geburtstag, war ich am Abend vorher noch bei ihr. Ich wollte sie begleiten, aber zu viel Nähe konnte ich selbst in diesem Moment nicht aushalten. Ich wollte nicht über Nacht bei ihr bleiben, und ich hätte auch nicht ihre Hand halten können. Ich habe ihr dann meine Hand auf die Stirn gelegt, das war das Äußerste für mich. Es war das erste Mal, dass ich meine Mutter berührt habe.
Mach’s gut, sagte ich zum Abschied. Dann bin ich rückwärts aus dem Zimmer gegangen, so als würde ich mich von einer Majestät verabschieden. Ich wollte ihr nicht den Rücken zukehren, das war für mich ein Zeichen von Respekt.
Am nächsten Tag starb sie. Für mich war es, trotz allem, ein versöhnlicher Abschied. Ich hatte meine Hausaufgaben gemacht. Und zum ersten Mal hatte ich das Gefühl: Ich bin frei.
Reinhold Bussmann, Jahrgang 1950 (Hamburg)
© Dmitrij Leltschuk
© Dmitrij Leltschuk
»Die haben dann tatsächlich auf uns geschossen!«
Barbara Langner verlebte in Schlesien eine Kindheit wie im Paradies: ein Landhaus mit 1000 Quadratmetern Wohnfläche, mehrere Hausmädchen, Abendgesellschaften mit Klaviermusik und Billard. Dann musste ihre Familie vor der Roten Armee fliehen.
Barbara Langner (rechts) mit ihrer Cousine, September 1941
© Dmitrij Leltschuk
Diesen Rechen fand ich im Nachlass meiner Mutter. Er gehörte meiner Großmutter, 1945 muss sie ihn mit auf die Flucht genommen haben. Ein sogenanntes Rateau, beim Roulette schiebt der Croupier damit die Jetons zusammen.
Meine Großmutter stammte aus dem Großbürgertum. Mein Großvater hatte als Ingenieur viel Geld mit Patenten verdient und besaß später zwei Holzwollefabriken. Die beiden wohnten den Winter über in Berlin, um dort ins Theater, auf Bälle oder ins Konzert gehen zu können, und im Sommer in Schlesien, in der Nähe von Hirschberg. Dort hatte die Familie ein Landhaus.
Mein Vater war 1939 eingezogen worden. Er war Anwalt und hatte seine Kanzlei in Berlin. Offizier wollte er nicht werden; er hatte offenbar Angst, als Jurist an Todesurteilen mitwirken zu müssen. Als einfacher Gefreiter marschierte er dann zu Fuß bis nach Leningrad und zurück.
Meine Mutter schrieb ihm täglich einen Brief, ich malte immer ein Bild dazu. In seinen Briefen berichtete er nur von schönen Blumen um den Schützengraben herum, er wollte nicht, dass wir uns sorgten.
Landhaus der Familie Lantzsch im schlesischen Rabishau, 1930
© Dmitrij Leltschuk
1943 bekam ich einen Bruder. Zu der Zeit wurden Mütter mit Kindern aufgefordert, Berlin zu verlassen. Also ging meine Mutter mit mir und dem Baby nach Schlesien in das Landhaus der Großeltern.
Dort hatte ich eine paradiesische Kindheit. Ich lebte wie eine Prinzessin, das einzige Kind unter lauter Erwachsenen. Ich konnte machen, was ich wollte. Wir hatten zwei Hausmädchen, während wir zu Abend aßen, räumten sie mein Zimmer auf. Vor dem Schlafengehen stellte ich meine Schuhe vor die Zimmertür, und am nächsten Morgen waren sie geputzt.
Das Landhaus hatte ein Erdgeschoss und zwei Etagen, jeweils mit etwa 360 Quadratmetern. Es gab große Wandmalereien, alles war sehr kunstvoll eingerichtet. In jedem der sechs Gästezimmer waren die Möbel in einem anderen Farbton gehalten, am schönsten fand ich Zimmer Nummer 4: gelb mit rot. Einmal hatte ich die Idee, jede Nacht in einem anderen Bett zu schlafen, für mich war das ein herrliches Spiel. Die Mädchen fanden das sicher nicht so lustig, sie mussten dafür jeden Abend ein anderes Bett herrichten.
Es gab ein riesiges Musizier- und Spielezimmer, mit einem Klavier, gepolsterten Sitzgruppen drumherum und einem großen Tisch in der Mitte, auf dem Billard gespielt wurde. Abends wurde er umgebaut, für Roulette.
An den Abenden hatten wir oft Gäste. Ich wurde dann abgefüttert und musste pünktlich ins Bett. Oft sagte meine Mutter zu mir: »Trödel nicht so, ich muss mich noch umziehen.«
Der jüngere Bruder meines Vaters spielte bei diesen Abendgesellschaften Klavier und machte auch den Croupier. Wahrscheinlich hat er dabei dieses schwarze Rateau benutzt. Im September 1944 ist er gefallen, mit 22 Jahren. Für meine Großmutter muss das furchtbar gewesen sein, er war der Nachzügler, ihr Kleiner. Ich denke, dass sie das Rateau als Erinnerung an ihn auf die Flucht mitgenommen hat.
Jeden Abend hat meine Mutter meine Haare gekämmt und geflochten. Dabei hat sie oft gesagt: »Es kann sein, dass du eines Tages mal nicht mehr in einem so schönen Bett liegst. Dass du nur auf Stroh schläfst. Dass du mal frieren musst.« Ich habe dann immer gedacht: Komisch, was erzählt sie denn da?
Am 3. Januar 1945 wurde mein Vater an der Westfront verwundet. Weil die Lazarette dort überfüllt waren, durfte er zurück nach Schlesien. Er hatte eine Wunde am Oberschenkel und an der Hand, später musste ihm ein Finger abgenommen werden, die linke Hand blieb steif.
Anfang Februar 1945, als die Russen näher rückten und bei uns im Ort schon die Flüchtlinge in Scharen vorbeizogen, sollte mein Vater mit dem Lazarett nach Bad Mergentheim evakuiert werden. Er hat daraufhin den Militärarzt für einen Marschbefehl bestochen. »Kommen Sie in das Haus meiner Eltern«, hat er zu ihm gesagt, »Sie können dort mitnehmen, was Sie wollen, Wäsche, Geschirr, Silber, alles. Ich brauche von Ihnen nur ein Dokument, dass ich mit meiner Familie nach Bad Mergentheim fliehen darf, und nicht mit der Truppe.« Der Arzt fuhr mit einem kleinen Laster vor, der war nachher vollbeladen.
Eltern von Barbara Langner, Mai 1942
© Dmitrij Leltschuk
So konnte uns mein Vater in Uniform mit seinem Marschbefehl begleiten. Unsere Flucht begann im Februar 1945, ich war sieben Jahre alt. Natürlich hatte ich Angst, aber meine Mutter sagte: »Wenn wir alle ganz fest zusammenhalten, kann uns nichts passieren.« Das habe ich ihr geglaubt. Sie hatte bereits im Ersten Weltkrieg fliehen müssen, sie wusste, was uns bevorstand. Also packte sie warme Kleidung für alle ein, Lebensmittel und auch die Fotografien, denn die waren unwiederbringlich. Und das Silberbesteck, das konnte man gut verkaufen. Ich durfte nur eine einzige Sache mitnehmen, ich entschied mich für ein Buch, Grimms Märchen.
Niederschlesien war bereits von den Russen eingekesselt, wir flohen nach Süden. Dort gebe es einen Durchbruch, hieß es.
Wir hatten einen Lastwagen von Ford mit Holzvergaser sowie einer Ladefläche und einer Plane darüber. Insgesamt waren wir 20 Personen, damit war der Wagen überladen. Mein Vater, der humpelte und einen Arm in der Schlinge trug, musste bei heftigen Minusgraden die ganze Fahrt über auf dem Kotflügel sitzen. Im geschützten Fahrerhaus saßen im Wechsel meine Tante mit ihrem Säugling und meine Mutter mit meinem kleinen Bruder.
Als unser Treck früh morgens noch im Dunkeln loswollte, haben wir lange gebraucht, bis wir auf der Straße eine Lücke fanden, so viele Menschen waren unterwegs, viele mit Pferd und Wagen. Es ging im Schritttempo voran. Es war lausig kalt, die Straßen waren spiegelglatt und am Rand türmte sich der Schnee; man konnte nicht überholen.
Barbara Langner, 1941
© Dmitrij Leltschuk
Unterwegs mussten wir einige unserer Sachen wegwerfen, weil der Lastwagen zu voll war. Er war uralt, ständig hatten wir Pannen. Ich saß hinten auf der Ladefläche, immer wieder sah ich leere, umgekippte Kinderwagen am Straßenrand liegen. Die Kinder waren erfroren.
Abends kamen wir in Schulen oder Hallen unter, dort war Heu oder Stroh ausgebreitet. Auf der Höhe von Dresden erlebten wir von der Straße aus den großen Angriff auf die Stadt. Die feindlichen Flugzeuge flogen über uns hinweg, die Bomben gingen runter, und wir sahen die Stadt brennen.
Alle mussten dann raus aus dem Auto. Wir sollten uns in den Schnee werfen, mein Vater sagte zu mir: »Mach dich so klein wie möglich. Wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, denkt der Pilot, du seiest ein Stein.« Ich hatte furchtbare Angst und habe noch Jahrzehnte später davon geträumt.
Als wir Hof erreichten, brach der Laster endgültig zusammen, wir mussten ihn stehen lassen. Jeder müsse sich nun selbst durchschlagen, hieß es. Also zogen meine Eltern mit meinem Bruder und mir allein weiter, nur mit dem Nötigsten bepackt. Wir fuhren mit der Bahn. Ständig gab es Bombardierungen, dann mussten wir raus und uns verstecken.
Einmal setzte meine Mutter mich auf einem Bahnsteig neben einem hohen Stapel ab. Nach einer Weile sah ich, dass das tote, gefrorene Soldaten waren, die man dort gelagert hatte.
Mein Vater hatte mir irgendwann ein rotes Kopftuch umgebunden, er sagte, so erkennt man dich sofort in der Menge. Wir kamen dann für einige Zeit in einem Dorf unter. Einmal ging ich mit meinem Bruder, der in seinem Kinderwagen lag, durch die Straßen. Plötzlich kamen Tiefflieger. Sie flogen unglaublich tief, so etwas hatte ich zuvor noch nie gesehen. Und ich trug mein rotes Kopftuch. Die haben dann tatsächlich auf uns geschossen! Eine Frau schrie mir zu, ich solle zu ihr ins Haus kommen. Ich riss meinen Bruder aus dem Kinderwagen und rannte los. Das sind Momente, die man nie vergisst.
Unsere Flucht endete nach circa drei Wochen in Beckstein, damals ein kleiner Ort mit wenigen Einwohnern. In einem uralten leer stehenden Haus fanden wir eine Bleibe. Mein Vater, der immer alles positiv sehen wollte, sagte zu mir: »Ist das nicht ein wunderschönes Haus? Es wurde 1492 gebaut, genau in dem Jahr, in dem Amerika entdeckt wurde. Und weißt du was? Wir werden jetzt leben wie im Mittelalter.«
Daraus wurden dann mehr als fünf Jahre. Wir bewohnten ein Zimmer, kaum 20 Quadratmeter groß, daneben war eine Kammer mit einem Stockbett. Oben schlief ich, unten schliefen meine Eltern; für meinen Bruder gab es ein Kinderbett. Zugedeckt wurde ich mit dem alten Militärmantel meines Vaters. In dem Zimmer schlief meine Großmutter, sie war zu uns gekommen, nachdem mein Großvater unterwegs gestorben war. Wasser mussten wir aus dem Keller in Eimern nach oben schleppen, ein Plumpsklo gab es im Hausflur.
Meine Mutter war sehr lebenstauglich. Gleich nach unserer Ankunft fragte sie beim nächsten Bauern an, ob er eine Magd brauche. Die Fremdarbeiter waren weg, die Männer gefallen oder noch in Kriegsgefangenschaft; sie konnte gleich anfangen. Jeden Abend kam sie mit einer Schüssel Mehl oder irgendetwas anderem Notwendigen nach Hause.
Bald schlug sie mir vor, ich könne als eine Art Kindsmagd dort arbeiten. Ich könne auf die Kinder aufpassen oder den Arbeiterinnen das Essen aufs Feld bringen. Das habe ich gemacht und dafür dann zum Beispiel ein Schinkenbrot bekommen. So gab es zu Hause einen Esser weniger. Und ich war stolz.
© Dmitrij Leltschuk
Wir hatten natürlich keine Spielsachen. Mein Vater nahm Packpapier und schrieb Gedichte darauf, malte etwas dazu, machte ein Loch ins Papier und zog eine Schnur hindurch. Das waren dann unsere Kinderbücher.
Ich habe das als schöne Zeit in Erinnerung, trotz der Entbehrungen. Endlich konnte ich mit anderen Kindern spielen, das fand ich herrlich. In Schlesien war nie ein Kind zu mir zum Spielen gekommen, meine Großmutter hatte das nicht gewollt. Ich hing immer am Gartenzaun und sah draußen die Kinder, ich durfte nie dazu. Ich bin in einem goldenen Käfig aufgewachsen. Für mich begann erst in Beckstein eine normale Kindheit.