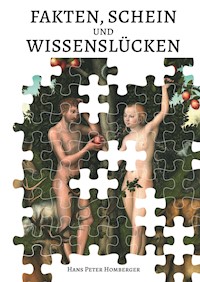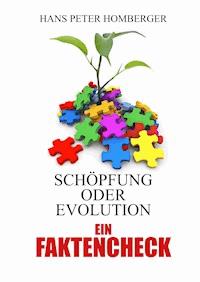
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wie entsteht Leben und was ist Leben überhaupt? Mit analytischer Sachkenntnis und aus neutraler Perspektive fokussiert der Autor auf das Wesentliche und verlässt sich dabei auf empirische Fakten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 103
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
ERSTER TEIL: Gedanken über Erkenntnis
Woher kommen wir und wohin gehen wir?
Gedanken über das Leben
Merkmale des Lebens
Komplexität
Ordnung und Unordnung
Der Maxwell’sche Dämon
Komplexität und Entropie
Entsteht Ordnung zufällig?
Fraktale
Die Zelle als Grundlage des biologischen Lebens
Zytoplasma
Membran
Zellwand
DNS und Chromosomen
Mitochondrien
Das endoplasmatische Retikulum mit den Ribosomen
Vakuolen
Woher kommt alles?
Erkenntnisansätze
Gedankenexperimente
Die Wissenschaft kommt nicht zur Ruhe
Falsche Darstellung
Das Verneinen einer Kontroverse
Anerkannte Standards
Gedanken zum Schöpfungsbericht aus dem Alten Testament
Biblische Schöpfungsgeschichte als Urtheorie?
Aus dem Nichts
Das Miller-Experiment
ZWEITER TEIL: Rahmenbedingungen
Das Raum-Zeit-Kontinuum als Voraussetzung für Leben
Der Zustand vor allem
Der Raum
Die Gerade
Die Fläche
Die Zeit
Lichtgeschwindigkeit – „The Stairway to Heaven“?
„Wölbung“, Gravitation und Raumkrümmung
Aggregatzustände der Materie
DRITTER TEIL: DIE CHEMIE DES LEBENS
Vom Teil und vom Ganzen
LUCA
Konzepte des biologischen Lebens
Das genetische Alphabet
Vorstellungen über den Anfang des Lebens
Waren die Proteine zuerst da?
Der Bau und die Funktion von Proteinen
Gab es zuerst Nukleinsäuren?
Desoxyribosenukleinsäure als Informationsträger
RNS oder die RNS-Welt
Gedanken zur Wahrscheinlichkeit
PERSÖNLICHE SCHLUSSFOLGERUNG
Die Bedeutung von Wissen und Glauben
Quellenverzeichnis der Abbildungen
Quellenangaben und Anmerkungen
Vorwort
Unsere Zeit ist harmoniebedürftig. Extrempositionen sind verpönt. Konsensfindung und „Political Correctness“ machen Schule, selbst wenn dabei Fakten subjektiven Eindrücken weichen müssen. Und Fakten gibt es viele, sodass sie sich teilweise widersprechen und es somit fraglich ist, ob es sich dabei überhaupt um Fakten handelt.
Aber immer mehr Menschen merken, dass gesicherte Tatsachen mit oberflächlichem Halbwissen vermischt und instrumentalisiert werden. Die Faktenflut verunsichert und Menschen ziehen sich auf ihren „gefühlten“ Informationsstand zurück.
„Willkommen im postfaktischen Zeitalter“, möchte man ihnen zurufen. Ich glaube, dass sich die Gesellschaft zurzeit tief spaltet. Die einen durchschauen den Einsatz gesicherter und gefälschter Tatsachen als Waffen der Massenmanipulation. Sie haben es aufgegeben, sich an zu diesem Zweck konstruierten Fakten zu orientieren, und betrachten die Welt aus der Perspektive neutralen Basiswissens. Andere glauben den Halbwahrheiten, Gerüchten und Lügen; sie ignorieren die Faktenwelt des „gesunden Menschenverstandes“ zunehmend und ziehen sich auf ihre „gefühlte“ Wahrnehmung der Welt zurück. Diese Entwicklung ist auf vielen Gebieten zu beobachten. Vor allem in der Bildung der öffentlichen Meinung bzw. des kollektiven Bewusstseins werden die Menschen zunehmend müde, im Hinblick auf Grundlagen und Antworten auf existentielle Fragen ständig Fakten zu checken. Hauptsächlich sind davon Politik, Philosophie, Religion und viele gesellschaftliche Fragen betroffen, welche auch von den Medien im Zuge der Wertvermittlung gerne aufgegriffen werden. So herrschen auch im andauernden Disput zwischen den atheistisch gesinnten Evolutionsvertretern in der Biologie und den theistisch ausgerichteten Anhängern von „Intelligentem Design“ hartnäckige Vorstellungs- und Verhaltensweisen, die oft nicht das Resultat einer Prüfung seriösen Basiswissens sind.
Folgende Haltung ist oft anzutreffen, auch wenn dies nicht zugegeben wird: „Ich weiß sehr wohl, dass die publizierten wissenschaftlichen Resultate keinen Beweis für die zufällige Entstehung des Lebens liefern, weigere mich jedoch, einen Schöpfergott anzuerkennen. Gott ist eine Hypothese, auf die ich gerne verzichte.“
Es sind leider nicht viele, die sich Zeit nehmen für einen „Faktencheck“ und sich bei wichtigen Fragen in den Fuchsbau der Details vorwagen. Dabei besteht eine hohe Erwartung an die Sorgfaltspflicht der Menschen, wissenschaftliche Resultate immer wieder zu hinterfragen und unvoreingenommen zu interpretieren. Hält man sich zudem an die Regeln der wissenschaftlichen Methoden und verändert keine Resultate, um vorgefasste Meinungen zu unterstützen, so ist dies bestimmt kein intellektueller Spaziergang. Doch ohne ein Minimum an Basiswissen ist es unmöglich, ein stabiles und seriöses Denkgerüst aufzubauen. Dies gilt besonders bei Fragen zur Entstehung des Lebens. Aber auch in Kenntnis von solidem Grundlagenwissen und jüngster wissenschaftlicher Fakten kommen wir hinsichtlich der Frage nach dem Ursprung des Lebens nur zu einer bescheidenen Aussage. Trotz vieler guter Forschungsarbeiten und Experimenten von unzähligen passionierten Wissenschaftlern haben wir keine Ahnung, wie, wo und vor allem warum Leben existiert.
Im Folgenden will ich zeigen, dass es in der wissenschaftlichen Faktenwelt extreme Gegenpositionen gibt, die sich manchmal auf ein und dieselbe Tatsache beziehen. In der Interpretation der Fakten spielt eben allzu oft die individuelle Weltanschauung mit. Unüberbrückbar scheint der Graben zwischen dem theistischen und dem atheistischen Weltbild zu sein. Wissenschaftler und Intellektuelle sind Atheisten, allenfalls noch Agnostiker. Unkundige und naive Menschen glauben an einen Schöpfer. So die weit verbreitete Meinung. Das Ziel dieses Büchleins ist, zu zeigen, dass beide Lager letztlich auf Glauben angewiesen sind. Die Vorstellung der Entstehung des Lebens ohne einen intelligenten Schöpfer ist dem Glauben an einen Schöpfergott nicht überlegen. Anhand der folgenden Betrachtungen fordere ich beide Lager heraus, unvoreingenommen über diese Fragen nachzudenken. Es geht hier nicht um einen Gottesbeweis, sondern um Plausibilitätsüberlegungen und intellektuelle Redlichkeit. Vielleicht lernen wir dabei, dass der Wissenschaft auch Grenzen gesetzt sind.
Hans Peter Hornberger, Mai 2017
ERSTER TEIL:Gedanken über Erkenntnis
Woher kommen wir und wohin gehen wir?
Hinsichtlich dieser Frage sind die Resultate der Wissenschaften für viele Menschen ein leuchtendes Fanal, denn die Aura der Wissenschaftlichkeit ist ein wichtiges Kriterium für den Wahrheitsgehalt der philosophischen Lebensgrundlage vieler Menschen. Aber Wissenschaftlichkeit ist nicht mit Wahrheit gleichzusetzen. Es erstaunt nicht, dass diese zwei Begriffe in der Folge der subjektiven Wahrnehmung zu unlösbaren Disputen führen. Unterschiedliche Sichtweisen über existentielle Fragen werden von den jeweiligen „Gegenparteien“ oft als pseudowissenschaftlich taxiert, auch wenn die Aussagen wissenschaftlich gestützt sind.
Es ist nachgerade unmöglich, über die wichtigsten Fragen der Menschen nachzudenken, zu reden und zu schreiben, ohne sich scharfer Kritik auszusetzen. Aber eine intellektuell redliche Auseinandersetzung mit dem Thema unserer Herkunft und des Ursprungs unserer Umwelt muss trotzdem sein, denn diese Fragen beantworten sich nicht von selbst.
Was sind wissenschaftliche Aussagen über den Begriff und das Phänomen „Leben“? Was sind die physikalischen Rahmenbedingungen, die als Voraussetzung für die Existenz von Leben notwendig sind? Helfen uns hier Erkenntnisse aus der Physik, um daraus plausible Grundlagen abzuleiten und logische Schlüsse zu ziehen? Wir werden sehen, dass wir uns letztlich mit den neuesten Resultaten aus der Molekularbiologie befassen müssen.
Gedanken über das Leben
Die Wissenschaft des Lebens ist die Biologie. Es ist daher verständlich, dass im Biologieunterricht1 schon früh eine Definition von Leben postuliert wird:
Merkmale des Lebens
Zelluläre Organisation: Die kleinste Einheit des Lebens ist die Zelle. Alle Lebewesen bestehen aus einer (Einzeller) oder vielen Zellen (Vielzeller). Zwei Grundformen von Zellen lassen sich unterscheiden: die ursprüngliche Protocyte ohne Zellkern, aus denen Prokaryoten bestehen, und die Eucyte mit Zellkern, dem Zelltyp der Eukaryoten
2
.
Stoffliche Zusammensetzung: Es gibt keinen ausschließlich den Lebewesen vorbehaltenen Baustoff. Kennzeichnend sind dagegen das Mengenverhältnis und die Struktur der am Aufbau der Lebewesen beteiligten chemischen Elemente. Für das Leben charakteristische chemische Verbindungen sind die Nukleinsäuren und die Proteine, Letztere vielfach auch als Enzyme bezeichnet, ferner Lipide sowie Polysaccharide als Struktur- und Speichersubstanzen und Phosphate als Energieüberträger.
Stoffwechsel und Homöostase: Leben ist durch einen hohen Ordnungsgrad gekennzeichnet, wie er nur in thermodynamisch offenen Systemen möglich ist. Lebende Systeme stehen daher mit ihrer Umwelt in einem ständigen Stoff- und Energieaustausch. Die Stoff- und Energieumwandlungen erfolgen über den Stoffwechsel. Dabei wird das innere Milieu eines Organismus trotz Schwankungen in der Umwelt durch Regulationsmechanismen innerhalb bestimmter Grenzen konstant gehalten (Homöostase). Lebende Systeme befinden sich also in einem dynamischen Gleichgewicht (Fließgleichgewicht).
Reizbarkeit (Reaktionsfähigkeit): Lebende Systeme haben die Fähigkeit, Vorgänge in ihrer Umwelt wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Die Mittler dieser Eindrücke (Reize) sind im einfachen Fall reizempfindliche Zellen, die bei höheren Lebewesen zu komplizierten Sinnesorganen umgebildet sind.
Beweglichkeit: Die Fähigkeit zur Bewegung ist ein Charakteristikum alles Lebendigen, auch wenn die Bewegung u. U. nur innerhalb der Zelle erfolgt (z. B. als Plasmaströmung). Bei Vielzellern sind Muskelzellen auf diese Funktion spezialisiert. Ihr Wirkmechanismus ist jedoch für alle Eukaryoten gültig und beruht auf dem Zusammenspiel der Proteine Actin und Myosin.
Zusammenspiel von Nukleinsäuren und Proteinen: In allen lebenden Systemen enthalten Nukleinsäuren (DNS) die Information für ihre eigene Synthese sowie für die Synthese von Proteinen. Diese sind in Form von Enzymen für den Stoffwechsel notwendig, wie auch für die Synthese der Nukleinsäuren und anderer Biomoleküle.
Fortpflanzung: Leben geht nur aus Leben hervor. Dank ihrer Fähigkeit zur Fortpflanzung existieren Lebewesen auf der Erde. Diese Fähigkeit basiert auf der Teilungsfähigkeit der Zellen sowie der Fähigkeit der Nukleinsäure DNS zur identischen Verdopplung.
Wachstum und Differenzierung: Um aus einer befruchteten Eizelle einen Organismus entstehen zu lassen, der ein typischer Vertreter seiner Art ist, sind gezielt gesteuerte Wachstums- und Differenzierungsprozesse notwendig. Die genetische Information für diese Prozesse ist in der Nukleinsäure DNS enthalten.
Individualität: Die Lebewesen einer Art sind nicht identisch in ihren Merkmalen. Durch Abweichungen bei der Verdopplung der DNS (Mutationen) sowie ständige Neuverteilung der Erbanlagen bei der sexuellen Fortpflanzung entstehen variable Lebewesen, die jeweils einzigartig sind.
Evolution und Anpassung: Ständige Veränderungen des Erbguts in Form von Mutationen und anschließende Selektion führen zur Entwicklung der Lebensformen, die funktionale Anpassungen an die Umwelt darstellen.
Das ist eine einfache Schulbuchdefinition.3 Doch es gibt dazu sehr viele Zusatzaussagen. So hat auch die NASA4 im Jahr 2002 versucht, das Definitionsproblem von „Leben“ zu lösen. Die hochrangig besetzte Kommission kam zu folgendem Ergebnis: Das Leben ist ein chemisches System, das immer eine stoffliche Grundlage hat und über die Fähigkeit verfügt, sich seiner veränderlichen Umwelt anzupassen. Durch Mutation verändert sich das Erbgut, das so neu gemischt und weitergegeben wird.
Das ist also die biologische Standard-Definition von „Leben“. Gesamtheitlich betrachtet, bleiben nach dieser Erklärung unzählige Fragen offen und es bleibt umstritten, ob es eine umfassende Definition von Leben überhaupt geben kann.5 Als Modell für eine materialistische Betrachtung genügen diese Definitionen aber, solange wir uns bewusst sind, dass Leben ganzheitlich betrachtet komplizierter ist.
Was wir gemeinhin als Leben bezeichnen, ist eine Zusammensetzung von Atomen und Molekülen. Aber nur, weil wir in der Biologie wissen, dass ein bestimmter Gegenstand aus etwa 15 kg Kohle, 4 kg Stickstoff, 1 kg Kalk, 0,5 kg Phosphor und Schwefel, etwa 200 g Salz, 150 g Kali und Chlor und Spuren von etwa 15 anderen Materialien sowie aus 4 bis 5 Eimern Wasser besteht, können wir daraus nicht schließen, dass er lebt. Was aber macht tote Materie lebendig? Oder umgekehrt: Wann ist ein Lebewesen tot? Die materielle Zusammensetzung eines lebendigen Organismus unmittelbar vor dessen Tod ist die gleiche wie kurz nach Eintreten des Todes.
Stofflich ist in dieser kurzen Zeit nichts Auffälliges passiert. Vom Moment des Todes an beginnt der Zerfall des Organismus in die elementaren Einzelteile. Dieser Vorgang ist irreversibel. Der zweite Hauptsatz der Wärmelehre, der sog. Entropiesatz, beschreibt dieses Phänomen: Ein Zustand strebt nach dem größten Maß an Unordnung, wenn nicht Arbeit in entgegengesetzter Richtung geleistet wird. Rudolf Julius Emanuel Clausius (1822-1888), der deutsche Physiker, welcher den Begriff „Entropie“ eingeführt hat, formulierte es kurz:
„Bei jedem natürlichen Vorgang nimmt die Entropie (die Unordnung) zu.“
Auf diesen Fakten aufbauend, kann man Leben als ein System, ein Prinzip oder ein Konzept verstehen, das selbstständig und geordnet der Entropiezunahme entgegenwirkt.
Hört Leben auf, beginnt der natürliche Zerfall. Die Konsequenz aus diesem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik fordert uns heraus, nach der Ursache von Leben, d. h. der Bildung von hoher Ordnung und Komplexität aus Unordnung und Chaos zu suchen. Mit anderen Worten, es stellt sich die Frage, ob hinter dem Ursprung des Lebens Zufall oder Intelligenz steht.
Seit Langem bemüht man sich in den Naturwissenschaften, das Phänomen Leben zu erklären, indem Möglichkeiten von chemischen Reaktionswegen für die Entstehung der bekannten Biomoleküle aufgezeigt werden. Evolutionsbiologen hoffen, dabei Wege zu entdecken, wie dies zufällig, d. h. ohne übergeordnete Lenkung geschehen könnte. Es darf also kein externes Eingreifen in den Prozess stattfinden. Das heißt, die Zusammensetzung der verfügbaren Ausgangsstoffe, die Temperatur sowie der pH-Wert der Reaktionsumgebung dürften nicht gelenkt werden. Auch das Ausschalten von Einflüssen, die dem gewünschten Resultat entgegenwirken (z. B. der Einfluss von Sauerstoff), wäre verboten.
Absolut nicht erlaubt ist der Einsatz von Molekülen, die bereits durch lebende Systeme gebildet wurden.
Bis jetzt konnten solche Resultate nicht gezeigt werden. Als Hoffnungsschimmer werden Wahrscheinlichkeiten von < 1:1050 genannt, dass das eine oder andere Ereignis doch so hätte stattfinden können. Gegner der Evolutionstheorie begründen damit die Unmöglichkeit der Zufallstheorie.