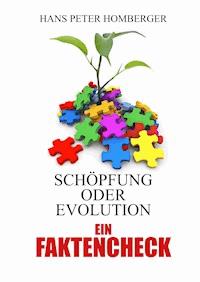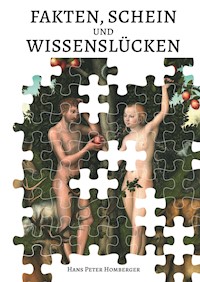
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Relativitätstheorie und die Evolutionstheorie sind in weiten Teilen der Gesellschaft als wissenschaftlich erwiesen anerkannt. Befassen wir uns jedoch näher mit den neusten Erkenntnissen aus der Theoretischen Physik, der Chemie und der Biochemie, stossen wir auf bislang ungeklärte Rätsel und Phänomene, die die Gültigkeit unseres aktuellen Wissensstandes infrage stellen. Wissen wir wirklich, was wir zu wissen glauben oder führt uns die apodiktisch beanspruchte Deutungshoheit der Wissenschaften in einen berechtigten Kulturpessimismus. Wo liegt die Grenze zwischen Glauben und Wissen? Im Zeitalter der "Fake News" und der Algorithmisierung des Wissens stellt sich die Frage nach einem intellektuell redlichen Umgang mit Wissenslücken mehr denn je.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
In dem folgenden Text wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich die männliche Form verwendet. Sie bezieht sich auf Personen beiderlei Geschlechts.
Inhaltsverzeichnis
Fakten im Schatten von Wissenslücken
Was wissen wir und was glauben wir?
Wissen und Wissenschaftlichkeit.
Wahrheit und Wirklichkeit.
Grenzen der Wissenschaft.
Wissensgrundlagen.
Wissenschaft und Ethik.
Sind Erkenntnisse Fakten?
Empirie
Deduktion und Induktion
Wissenschaft studiert die Schöpfung ohne Schöpfer.
Dialektik
Die rätselhafte Welt der Physik
Offene Fragen für Wissensdurstige
Methodische Ausgrenzung produziert Artefakte
Quantenphysik – Jagd auf bewegte Ziele
Schrödingers Tür zur Metaphysik
Schöpfung oder Evolution – ein Faktencheck.
Irrungen und Wirrungen in der Biologie.
Gedanken über das Leben.
Proteine
Nukleinsäuren.
RNS (Ribosenukleinsäure)
Wissen und Halbwissen.
Allgemeines Wissen
Verschwörungstheorien.
Glaube
Atheismus, eine Glaubensgemeinschaft?
Die Digitale Transformation
Digitalisierung – die Pulverisierung und «Entseelung» des Wissens
Neue Lebens- und Arbeitswelt.
Hoffnungen und Ängste.
Vertrauen
Lückenhaftes Wissen über den Cyberspace
Wissen ist Macht
Was macht Wissen mit uns?
Wer trägt die Verantwortung?
Code.org
Persönliche Schlussfolgerung
Fakten im Schatten von Wissenslücken
Was wissen wir und was glauben wir?
Erkenntnisse aus der Wissenschaft sind für viele Menschen von großer Bedeutung beim Entwurf ihres Lebenskonzeptes. Einblicke in die Naturwissenschaften, die Philosophie und die Theologie haben sich dabei als nützlich erwiesen, aber auch zu Konfusion beigetragen. Der vereinfachten Berichterstattung der Medien vertrauen die meisten, auch wenn bekannt ist, dass die Beurteilung von wissenschaftlichen Resultaten komplex ist. Es ist wichtig, dass sich die Wissenschaft «sozialisiert» und aus dem Elfenbeinturm heraustritt. Diese Öffnung darf aber nicht zu oberflächlicher Darstellung komplexer Zusammenhänge führen. Vereinfachungen bergen die Gefahr der Täuschung in sich, und diese muss vermieden werden.
Für Laien ist es nicht einfach, sich die Grundlagen zu erarbeiten, die zum Verständnis eines wissenschaftlichen Disputs notwendig sind. So ist es fraglich, ob die neuesten Erkenntnisse der Theoretischen Physik aus unserem eingeschränkten Blickwinkel und Erfahrungshorizont verstanden werden können. Trotzdem reden viele Menschen über Quantenphysik, Relativitätstheorie, Unschärferelation und Schwarze Löcher, als gehörten diese Themen zur schulischen Grundausbildung. In der Schule kann das Wissen, das zu einem umfassenden Verständnis physikalischer Diskurse notwendig ist, kaum vermittelt werden. Selbst Experten haben nicht für jedes komplexe physikalische Phänomen eine Erklärung, während Laien oft darüber sprechen, als sei alles klar und eindeutig.
Wissenschaftliches Vorgehen ist Arbeiten mit Modellen. Modelle helfen, komplexe und abstrakte Situationen und Vorgänge besser zu verstehen. Die Modelle müssen gut erklärt und verstanden werden. Alle Grundlagen, die zu einem Modell geführt haben, müssen transparent dargelegt und allfällige Annahmen deklariert werden.
Modelle und Vergleiche hinken immer, und es ist gewagt, auf deren Basis absolute Schlüsse zu ziehen. Wissen über eine Sache ist nie absolut, weil es immer mehrere Standpunkte gibt, von denen aus ein Sachverhalt betrachtet werden kann und muss.
Stehen sich zwei Menschen gegenüber und hält man eine Münze rechtwinklig vor ihre Augen, so wird der eine behaupten, die Münze sei mit einer Zahl bedruckt, der andere wird feststellen, dass eine Figur oder ein Kopf die Oberfläche prägt.
Dieses Beispiel zeigt uns, dass es wichtig ist, wissenschaftlichen Modellen mit Skepsis zu begegnen.
Eine wahre Aussage über die oben beschriebene Situation ist, dass beide Beobachter recht haben. Es ist eine Tatsache, dass die Münze zwei Seiten mit unterschiedlicher Aufprägung hat. In unserem Beispiel schließt die Beschreibung der Wirklichkeit oder der Wahrheit eine weitere räumliche Dimension ein. Wäre es unmöglich, die Münze dreidimensional um die eigene Achse zu drehen, könnte man ihre beiden Seiten nicht überprüfen.
Dies müssen wir beachten, wenn wir uns mit den Begriffen «Wissen» und «Wissenschaftlichkeit», «Wahrheit» und «Wirklichkeit» auseinandersetzen.
In der Frage nach dem Ursprung des Lebens und dem Sinn der menschlichen Existenz führt die subjektive Wahrnehmung der Betrachter oft zu unlösbaren Disputen. Es ist nachgerade unmöglich, über diese Fragen nachzudenken, zu reden und zu schreiben, ohne sich scharfer Kritik auszusetzen.
Wissen und Wissenschaftlichkeit
Am Anfang der wissenschaftlichen Methoden stehen oft keine Fakten, sondern Annahmen, die zwar plausibel sind, aber nicht in wissenschaftlichem Sinne hergeleitet und bewiesen werden können. Diese Annahmen werden «Axiome» genannt. Sie bilden den Ausgangspunkt für ein System von daraus logisch abgeleiteten Hypothesen bzw. Theorien. Der Beweis, ob ein Axiom und eine daraus abgeleitete Hypothese wahr sind, kann nicht erbracht werden. Ihr Wahrheitsgehalt wird vorausgesetzt. Wissenschaftliche Experimente dienen dazu, Hypothesen und Theorien zu untermauern.
Ein bekanntes Beispiel hierfür sind die Newton’schen Axiome, die zu den Grundlagen der Physik gehören:
Das Trägheitsprinzip:
Ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung, solange keine äußeren Einflüsse auf ihn wirken.
Beschleunigungsprinzip:
Wechselwirkungsprinzip:
Wo immer möglich, versucht man den hypothetischen und theoretischen Wissensbestand durch Experimente zu bestätigen. Die Erfolge der Raumfahrt stammen zum großen Teil aus dem Experimentierfeld der Newton’schen Axiome.
Naturwissenschaftliche Gesetze gründen auf theoretischen bzw. experimentellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Wissen baut auf einem axiomatischen und/oder auf einem empirischen Informationsstand auf, der wiederum von Daten, deren Qualität, Zugänglichkeit und Interpretation abhängig ist.
Insbesondere die variable Zugänglichkeit und die perspektivische Interpretation von Daten erklären den unterschiedlichen Informationsstand einzelner Menschen, Gesellschaften und Kulturen. Wissen ist also an Personen gebunden und darum standpunktabhängig.
Mit dieser Tatsache haben sich bekannte Philosophen befasst, beispielsweise Gottfried Wilhelm Leibniz. Er führte den Begriff der «Perspektive» und den zugehörigen Begriff des «Standpunktes» in die Philosophie ein. Immanuel Kant betonte, dass die Philosophie, will sie Wissenschaft sein, den Menschen auf einen seiner menschlichen Denksituation angemessenen Standpunkt verweisen muss. Somit können wissenschaftliche Erkenntnisse nur dann miteinander verglichen und zu einem theoretischen Gedankengebäude zusammengefügt werden, wenn sie von einem konsensbasierten Standpunkt aus erarbeitet werden.
Wissenschaftlichkeit ist aber auch mit dem Anspruch objektiver Gültigkeit und Überprüfbarkeit verbunden. Wissenschaftliche Aussagen sollen logisch widerspruchsfrei sein, sie sollen uns im Bemühen, unsere Umwelt zu verstehen, unterstützen.
Wahrheit und Wirklichkeit
Das oben beschriebene Beispiel der zwei Seiten einer Münze zeigt die Wichtigkeit des Perspektivismus in der Erkenntnistheorie auf. Die Standpunktabhängigkeit unserer subjektiven Wahrnehmung besagt, dass Auffassung und Interpretation der Wirklichkeit nicht absolut, sondern relativ sind. Der perspektivistische Objektivismus setzt aber die Existenz einer absoluten, objektiven Wirklichkeit voraus, die aufgrund der unterschiedlichen Standpunkte und Eigenschaften der Betrachter unterschiedlich interpretiert wird. Er geht davon aus, dass ein vom Betrachter unabhängiger und darum nicht mehr perspektivischer Zustand einer Sache existiert.
«Die Münze zeigt auf der einen Seite die Prägung eines Kopfes und auf der anderen die einer Zahl.» Diese Aussage entspricht einer umfassenderen Wahrheit als die Aussagen der «einseitigen» Beobachter. Um dorthin zu gelangen, müssen wir die Situation aus einer höheren (dritten oder räumlichen) Dimension beurteilen. Bleibt uns diese räumliche Perspektive verborgen oder wird sie zur Beurteilung einer Sache nicht genutzt, verpassen wir eine Möglichkeit, der Wirklichkeit näher zu kommen.
Grenzen der Wissenschaft
Werfen wir einen Blick auf Gotthold Ephraim Lessings Ideendrama «Nathan der Weise» (1779). Auf die Frage des Sultans, welche der drei monotheistischen Religionen – Christentum, Judentum oder Islam – die wahre Religion sei, antwortet Nathan mit einem Gleichnis, indem er die «Ringparabel» erzählt:
Ein Mann besitzt ein wertvolles Familienerbstück, das seit Generationen an den liebsten Sohn weitergegeben wird. Es handelt sich um einen besonderen Ring, der seinem Träger Gottgefälligkeit verleihen soll. Dieser Mann hat jedoch alle seine drei Söhne gleich lieb und kann sich nicht entscheiden, an welchen er den Ring vererben soll. So lässt er von dem Ring Duplikate anfertigen und verteilt die identisch aussehenden Ringe an alle drei Söhne. Nach dem Tod des Vaters kommt es zu einem Streit zwischen den Brüdern, welcher der echte Ring sei. Niemand wagt ein Urteil zu sprechen. Ein Richter sagt jedoch, man solle jeden der Ringe als den «wahren» ansehen, denn alle spiegeln die Liebe des Vaters wider.
Lessings «Ringparabel» ist ein Plädoyer für die Toleranz unter den Religionen. Sie beschreibt die Vision der Gleichberechtigung zwischen drei Glaubensrichtungen, die alle mit einem exklusiven Absolutheitsanspruch auftreten.
Die Akzeptanz dieser Geschichte bedingt aber den Ausschluss der Dimension der Wirklichkeit. Faktisch gibt es nur einen echten Ring, nämlich den, welchen der Vater von seinem Vater erhalten hat. In der Tat wird in dieser Parabel der verbale, ideologische und immaterielle Disput mit einem Trick auf die materielle Ebene transformiert.
Der perspektivistische Objektivismus geht von der Existenz einer absoluten Wahrheit aus, die von unterschiedlichen Beobachtungswinkeln ausgehend ungleich aufgefasst wird. Wahrheit lässt sich aber nicht an der Wirklichkeit vorbei hervorzaubern.
Aufgrund der Perspektivenabhängigkeit menschlichen Wissens führt ein absoluter Wahrheitsanspruch oft zu unüberbrückbaren Konflikten, sei es auf religiöser Ebene oder in der Wissenschaft.
Der Mathematiker David Hilbert (1862–1943) war der Überzeugung, dass sich alle mathematischen Wahrheiten beweisen lassen. Er zielte darauf ab, die Mathematik auf ein System widerspruchsfreier Axiome zu gründen, um auf dieser Grundlage alle offenen mathematischen Fragen zu lösen. (Axiome: Grundsätze von theoretischen Systemen, die innerhalb dieses Systems nicht begründet werden können.)
Hilbert entwickelte ein Gedankenexperiment, das unter dem Namen „Hotel Infinity“ bekannt wurde, um den Unendlichkeitsbegriff zu verdeutlichen:
Stellen Sie sich vor, Sie treffen spätabends in einem Hotel ein, das sich rühmt, unendlich viele Zimmer zu haben. Der Rezeptionist teilt Ihnen jedoch mit, dass kein Zimmer mehr frei ist, weil unendlich viele Gäste anwesend sind. In diesem Hotel gibt es folglich kein freies Zimmer mehr. Wie schaffen Sie es, in Hilberts Hotel dennoch ein Zimmer zu erhalten, ohne es mit einem anderen Gast teilen zu müssen? Sie schlagen dem Portier vor, den Gast aus Zimmer 1 in Zimmer 2 zu verlegen, den aus Zimmer 2 in Zimmer 3 und so weiter. Da es unendlich viele Zimmer gibt, können alle Gäste verlegt werden, und Zimmer 1 wird für Sie frei.
David Hilbert stellte am 8. August 1900 beim Internationalen Mathematiker-Kongress in Paris die «Hilbertschen Probleme» vor, eine Liste von 23 Problemen der Mathematik, die zu jenem Zeitpunkt ungelöst waren. Unter anderem vertrat er die Meinung:
Mathematische Aussagen sind Zeichenketten in einer gewissen Syntax (ein Regelsystem zur Kombination elementarer Zeichen zu zusammengesetzten Zeichen in natürlichen oder künstlichen Zeichensystemen).
Diese Syntax muss verifiziert werden können.
Der Beweis einer Aussage ist eine Liste von (axiomatischen oder konsekutiv aus der jeweils vorangehenden Aussage folgenden) Aussagen.
Die Bestätigung des ersten Satzes durch die letzte Aussage gilt als Beweis.
Ob etwas ein Axiom ist, muss rechnerisch überprüft werden können.
Das Resultat dieses Prozesses ist eine Theorie.
Hilbert zielte darauf, die Arithmetik (und in der Folge die Mathematik) auf ein System von widerspruchsfreien Axiomen zu gründen. Er war überzeugt davon, dass damit jede Frage, jedes Problem widerspruchsfrei gelöst werden könnte.
Sein Programm erwies sich allerdings als nicht durchführbar, wie Kurt Gödel mit seinem 1930 veröffentlichten «Unvollständigkeitssatz» zeigen konnte. Vereinfacht ausgedrückt besagt dieser: Innerhalb eines klaren Regelsystems sind Aussagen möglich, die zwar wahr sind, aber nicht mit den Regeln des Systems bewiesen werden können. Somit kann selbst die logisch strenge Mathematik nicht alle Fragen beantworten.
In weiteren Arbeiten führte Gödel Prinzipien des logischen Denkens mit der mathematischen Beweisführung zusammen. Gödels «Vollständigkeitssatz» sagt unter anderem aus, dass logisches Argumentieren und formale Rechenoperationen in der Mathematik eines sind. Gödels Methoden ließen sich später auf Computer-Algorithmen anwenden und lieferten wichtige Grundlagen für die moderne Informatik. Im Zuge dieser Entwicklung wurde denkbar, dass Computer den mechanischen Teil der Logik bewältigen und autonom durchführen können.
Heute können Computerprogramme im Prinzip die Arbeit der formalen Beweisführung übernehmen. Sie können formale Beweise überprüfen und automatische Beweise generieren. Viele dieser formal-mechanisch erstellten Beweisketten sind gigantisch unüberschaubar und auch von Experten nicht mehr überprüfbar.