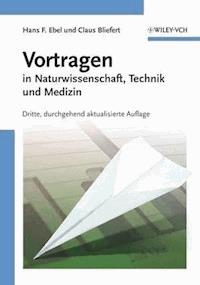43,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die aktuelle Auflage wurde gründlich überarbeitet; moderne Entwicklungen wie z.B. online submission, open access, crossref, Internetdienste u. v. m. wurden mit aufgenommen.
Hier schlagen auch die "Profis" aus dem Verlagswesen noch gerne nach!
Aus Rezensionen voriger Auflagen:
"Ein echtes Arbeitsbuch, das alles Notwendige zur Vorbereitung und zum Nachschlagen bei der Arbeit enthält."
—bild der wissenschaft
"[Dieses Buch] profitiert vom langjährigen Umgang der Autoren mit den wissenschaftlichen Texten anderer Forscher. Mit Akribie werden viele Details zur Schreibtechnik, zu Tabellen und Abbildungen sowie zu Formen des Zitierens vermittelt."
—Frankfurter Allgemeine Zeitung
"Flüssig im Stil und verständlich in der Sache"
—farbe + lack
"Ein höchst nützliches, aus langjähriger Erfahrung entstandenes Handbuch, das wirklich auf jeden Schreibtisch gehört"
—Chemie in unserer Zeit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1299
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Teil I Ziele und Formen des wissenschaftlichen Schreibens
1 Berichte
1.1 Kommunikation in den Naturwissenschaften
1.2 Zweck und Form des Berichts
1.3 Das Laborbuch
1.4 Die Umwandlung von Laborbuch-Eintragungen in einen Bericht
1.5 Verschiedene Arten von Berichten
2 Die Dissertation
2.1 Wesen und Bestimmung
2.2 Die Bestandteile einer Dissertation
2.3 Anfertigen der Dissertation
3 Zeitschriften
3.1 Kommunikationsmittel Fachzeitschrift
3.2 Entscheidungen vor der Publikation
3.3 Die Bestandteile eines Zeitschriftenartikels
3.4 Anfertigen des Manuskripts
3.5 Vom Manuskript zur Drucklegung
4 Bücher
4.1 Eingangsüberlegungen
4.2 Planen und Vorbereiten
4.3 Anfertigen des Manuskripts
4.4 Satz und Druck des Buches
4.5 Die letzten Arbeiten am Buch
Teil II Sonderteile und Methoden
5 Schreibtechnik
5.1 Einführung
5.2 Textverarbeitung und Seitengestaltung
5.3 Arbeiten mit dem Textprozessor
5.4 Elektronisches Publizieren
5.5 Allgemeine Gestaltungsrichtlinien
6 Formeln
6.1 Größen
6.2 Einheiten
6.3 Besondere Einheiten der Chemie
6.4 Zahlen und Zahlenangaben
6.5 Mit Formeln und Gleichungen umgehen
6.6 Umsetzung der Regeln mit einem Formelprogramm
6.7 MATHTYPE und MATHML
7 Abbildungen
7.1 Allgemeines
7.2 Strichzeichnungen
7.3 Zeichnen mit dem Computer
7.4 Halbton- und Farbabbildungen
7.5 Übersicht über Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme
8 Tabellen
8.1 Zur Logik von Tabellen
8.2 Zur Bedeutung von Tabellen
8.3 Zur Form von Tabellen
8.4 Bestandteile von Tabellen
8.5 Tabellenblätter, Listen, Datenbanken
9 Das Sammeln und Zitieren der Literatur
9.1 Informationsbeschaffung
9.2 Der Aufbau einer eigenen Literatursammlung
9.3 Technik des Zitierens
9.4 Die Form des Zitats
9.5 Bestandteile von Quellenangaben
10 Die Sprache der Wissenschaft
10.1 Die Sprache als Mittel der wissenschaftlichen Kommunikation
10.2 Kriterien des sprachlichen Ausdrucks
10.3 Besonderheiten der wissenschaftlich-technischen Sprache
10.4 Wissenschaft und Öffentlichkeit
Anhänge
A Zitierweisen
B Ausgewählte Größen, Einheiten und Konstanten
Literatur
Register
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
Ebel, H. F., Bliefert, C.
Vortragen
in Naturwissenschaft, Technik und Medizin
2004
ISBN-13: 978-3-527-31225-0
ISBN-10: 3-527-31225-2
Ebel, H. F., Bliefert, C.
Diplom- und Doktorarbeit
Anleitungen für den natunvissenschaftlich-techmischen Nachwuchs
2003
ISBN-13: 978-3-527-30754-8
ISBN-10: 3-527-30754-0
Ebel, H. F., Bliefert, C., Kellersohn, A.
Erfolgreich Kommunizieren
Ein Leitfaden für lngenieure
2000
ISBN-13: 978-3-527-29603-3
ISBN-10: 3-527-29603-4
Bürkle, H.
Karriereführer für Chemiker
Beruflicher Erfolg durch Aktiv-Bewerbung und Management in eigener Sache
2003
ISBN-13: 978-3-527-50069-7
ISBN-10: 3-527-50069-3
Debus-Spangenberg, I.
Karriereführer für Biowissenschaftler
Beschäftigungsfelder – Arbeitgeberwunsche – Crashkurs Bewerben
2004
ISBN-13: 978-3-527-50086-4
ISBN-10:3-527-50086-3
Autoren
Dr. Hans Friedrich Ebel
Im Kantelacker 15
64646 Heppenheim
Prof. Dr. Claus Bliefert
Meisenstraße 60
48624 Schöppingen
Walter Greulich
WGV Verlagsdienstleistungen GmbH
Hauptstraße 47
69469 Weinheim
5. Auflage 2006
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2006 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 9783527308026
Epdf ISBN 978-3-527-62498-0
Epub ISBN 978-3-527-66027-8
Mobi ISBN 978-3-527-66026-1
Vorwort
Schreiben und Publizieren sind noch näher aneinander gerückt. Schreiben als die Kunst, seine Gedanken verständlich und elegant in Worte zu fassen, ist nicht mehr zu trennen von der Kunst, diese Gedanken publik zu machen. Dazu muss man die modernen Mittel und Strategien des Kommunizierens und Publizierens kennen und sie sinnvoll einsetzen können. Wir haben in diesen beiden Arten von Kunstfertigkeit letztlich immer eine Einheit gesehen, gerade in der Sicht des Naturwissenschaftlers, der sich ja in seinen Publikationen und sonstigen Schriftstücken nicht nur in Worten mitteilt, sondern auch mit Bildern, Formeln und anderen Mitteln. Die elektronische Revolution, die besonders das Schreiben und Publizieren umgewälzt hat, wurde von Naturwissenschaftlern und Technikern angestoßen und vorangetrieben und hat deren Arbeitsplätze und das Geschehen daran grundsätzlich verändert. Täglich vollzieht sich an den Schreibtischen dieser Wegbereiter von Neuem eine digitale Evolution. Ein Begriff wie Personal Publishing, durch die Informationstechnologie unserer Tage erst denkbar geworden, belegt die Richtigkeit und Trägfähigkeit unseres umfassenden Ansatzes.
Um mit den Neuerungen Schritt halten zu können, die sich ebenso schnell wie nachhaltig vollziehen, haben wir unsere Autorschaft auf eine noch breitere Basis gestellt: Zu den beiden Altautoren (HFE, CB) ist ein Physiker (WG) gestoßen, der – mit allen Raffinessen des modernen Publikationswesens vertraut – die Schlagkraft unseres Teams erhöht. Zu dritt, so glauben wir, können wir unsere Kolleginnen und Kollegen noch detaillierter und aktueller über alles unterrichten, was für sie im Zusammenhang mit „Schreiben und Publizieren“ wichtig ist. Unser Buch ist dabei noch mehr zu einem Nachschlagewerk geworden; doch halten wir den Versuch für gerechtfertigt, die vielen Methoden und Lösungsansätze, die heute zur Verfügung stehen, an einer Stelle gebündelt darzustellen.
Die Lesbarkeit unseres Textes haben wir der Fülle der Informationen nicht geopfert. Wir waren immer und sind weiterhin bestrebt, die einzelnen Kapitel und Abschnitte so zu gestalten, dass sie auch einzeln „lesbar“ bleiben. Wer aber das Buch nicht so sehr zum Lesen – um Zusammenhänge zu erfahren – in die Hand nimmt, sondern um gezielt Auskunft über bestimmte Sachverhalte zu erlangen, wird in dem umfangreichen Register einen verlässlichen Wegweiser finden.
Gegenüber der 4. Auflage (1998) können wir noch mit einer Neuerung aufwarten, die in einem Rückgriff auf Bewährtes besteht: Das frühere Kapitel 10 „Die Sprache der Wissenschaft“ ist wieder da – in überarbeiteter und erweiterter Form! Nach der 3. Auflage (1994) hatte es dem Stoff weichen müssen, den wir eingebracht hatten, um alle die in Gang gekommenen Neuerungen angemessen darstellen zu können. Nun sind wir also in jener Richtung noch weiter gegangen und haben gleichzeitig altes Terrain zurückgewonnen. Dies hat der Verlag möglich gemacht – dahinter steckt das Vertrauen in diesen Titel und die gute Aufnahme, die er nun schon über so viele Jahre gefundenhat. Für dieses Vertrauen möchten wir uns auch im Namen künftiger Leser und Benutzer des Buches bedanken. Bei Wiley-VCH geht unser Dank in erster Linie an unseren Lektor, Dr. Frank WEINREICH, der uns wie schon bei unseren anderen Büchern wiederum sehr viel Verständnis entgegengebracht hat. Weiterhin sei Peter J. BIEL für die – wie immer – problemlose Herstellung dieses Buches gedankt.
Danken wollen wir noch in andere Richtungen. Unter den Lesern der 4. Auflage, die uns mit wertvollen Hinweisen unterstützt haben, sei Dr. Lutz WITTENMAYER vom Lehrstuhl für Physiologie und Ernährung der Pflanzen des Instituts für Bodenkunde und Pflanzenernährung an der Martin-Luther-Universität in Halle (Saale) hervorgehoben. Er hat uns an seiner langen Erfahrung als Forscher und Hochschullehrer, Autor und Herausgeber teilhaben lassen und damit an mehreren Stellen zu Verbesserungen beigetragen. Für die Autoren eines Buches der Art, wie wir es hier vorlegen, sind der persönliche Kontakt und die Verbindung zur Grundlagenforschung wie auch zu praktischen Fragen – hier der Ernährung und Düngung von Kulturpflanzen – immer Gewinn und freudiges Erlebnis.
Auch gebührt unserem Freund William E. Russey herzlicher Dank: Einige Gedanken in dieser Neuauflage von „Schreiben und Publizieren“ stehen schon in dem englischsprachigen Pendant The art of scientific writing (EBEL, BLIEFERT und RUSSEY; 2. Aufl., 2004) und finden sich im vorliegenden Manuskript an vielen Stellen wieder.
Weiterhin danken wir sehr herzlich für zahlreiche Hinweise und Hilfeleistungen Dipl.-lng. Florian BLIEFERT, Saarbrücken, Dipl.-Chem Dipl.-Ing. Frank ERDT, Steinfurt, Prof. Dr. Volkmar JORDAN, Steinfurt, und Prof. Dr. Eduard KRAHÉ, Metelen.
Heppenheim
Schöppingen und
Weinhe
HFECBWG
I
Ziele und Formen des wissenschaftlichen Schreibens
1
Berichte
1.1 Kommunikation in den Naturwissenschaften
1.1.1 Schreiben und andere Formen der Kommunikation
Die Betrachtungen in diesem Buch gehen von einem Gedanken aus, den wir als Leitsatz voranstellen wollen:
Was immer in den Naturwissenschaften gemessen, gefunden, erfunden oder theoretisiert wird – es verdient nicht, entdeckt zu werden, wenn es nicht anderen mitgeteilt wird.
Wissenschaftliche Ergebnisse wollen und sollen mit anderen geteilt werden, ins Einzelne gehend und so rasch wie möglich. Sich dem zu entziehen hieße, das Unterfangen Forschung der Vergeblichkeit preiszugeben, es zum Scheitern zu verurteilen. In der Mitteilung, kann man deshalb sagen, liegt der eigentliche Sinn der wissenschaftlichen Arbeit. Ohne den ständigen Austausch und die Weitergabe von Information gibt es auf Dauer keine Wissenschaft.
In diesem Sinne ist die naturwissenschaftliche
Mitteilung
als das Endprodukt der Forschung bezeichnet worden.
Hierin sehen wir einen ausgezeichneten Ansatzpunkt für die Behandlung des Themas „der Wissenschaftler als Schreiber“ (wie wir unser Buch auch hätten nennen können).
Jede naturwissenschaftliche Erkenntnis beruht auf den Erkenntnissen anderer, ist ein Schritt weiter auf einer langen Reise. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus dem Laboratorium dieser Gruppe oder vom Schreibtisch jenes Theoretikers regen die Untersuchungen eines anderen Forschers oder Arbeitskreises an, die zu neuen Ergebnissen und Folgerungen führen werden. So fügt sich das zusammen, was wir den „Fortschritt in den Naturwissenschaften“ nennen können. Damit das Spiel so läuft, müssen die Ergebnisse mitgeteilt – kommuniziert – werden und zugänglich sein für andere Forschungsgruppen, deren Errungenschaften gerade dadurch maßgeblich beeinflusst werden können.
Kommunikation unter Wissenschaftlern ist der Antrieb des wissenschaftlichen Fortschritts.
Welche Form nimmt die Mitteilung an? Im Wort Kommunikation (lat. communicare, etw. mit jmdm. gemeinsam haben, teilen) klingt Unterschiedliches an. Für den Linguisten bedeutet Kommunikation den direkten Austausch, die Interaktion zwischen zwei oder mehr Personen oder Gruppen, die sich etwas zu sagen haben, mündlich oder schriftlich. In der Informationstechnologie (IT) versteht man darunter auch den Fall, dass Personen oder Institutionen wechselseitig Zugang zu einem gemeinsamen Pool an Information – z. B. einer Datenbank – haben, den sie nutzen, indirekt gleichsam, ohne sich gegenseitig zu sehen oder zu kennen. Zwischen den Grenzen direkter und indirekter Kommunikation gibt es viele Übergänge.
Auch der Briefwechsel – heutzutage nicht mehr nur der klassische auf Papier, sondern auch der elektronische per E-Mail – kann als direkter Austausch gelten. Hingegen muss man den Begriffsumfang Kommunikation erweitern, wenn man (Fach)Texte einschließen will, die sich an einen anonymen Adressatenkreis wenden und bei denen keine unmittelbare Interaktion möglich ist. In diesem erweiterten Sinn, der in der Bezeichnung (engl.) „communication“ für eine bestimmte Publikationsform Ausdruck findet, benutzen wir den Begriff in diesem Buch.
Information, und somit auch wissenschaftliche Information, besteht im weitesten Sinne aus
Zeichen.
Kommunikation ist dann der Prozess der Übermittlung und Vermittlung dieser Zeichen.
Damit Zeichen übermittelt werden können, müssen sie zunächst in eine Form gebracht, müssen sie formuliert (und ggf. formatiert) werden. Dazu dienen in der Wissenschaft neben der allgemeinen Sprache die Elemente der jeweiligen Fachsprache. Zur Vermittlung des Formulierten sind Vermittlungsinstanzen nötig. Diese Aufgabe kann von den menschlichen Sinnesorganen übernommen werden, es können aber auch technische Aufnahme-, Übertragungs- und Wiedergabeeinrichtungen zum Einsatz kommen, wobei unter „technisch“ alles gemeint ist, was der Mensch zur Kommunikation künstlich erschaffen hat – angefangen bei dem behauenen Stein oder dem Papier, auf dem Information festgehalten werden kann. Für das Thema unseres Buches wichtig ist die Unterscheidung in individuelle und organisierte Vermittlung von Information.
Als individuell kann jede Form von Kommunikation angesehen werden, bei der zwar gewisse Benimmregeln eingehalten werden sollten, die aber weitgehend von den Beteiligten selbst gestaltet werden kann. Dazu zählen Gespräche, Diskussionen, der Austausch per Brief oder E-Mail, das Telefonieren, das Vortragen oder das Abfassen eines Berichts. Organisierte Vermittlungseinrichtungen sind die Printmedien (Buch, Zeitungen, Zeitschrift), Datenbanken von großen Organisationen und – natürlich und vor allem – Hörfunk, Fernsehen und die Filmindustrie.
Je organisierter die Vermittlungseinrichtungen sind, desto stärker formalisiert ist die Übermittlung der Information.
Um zur Veröffentlichung der eigenen Arbeit in einer bestimmten Zeitschrift zu gelangen, gilt es nicht nur, bestimmten inhaltlichen Kriterien zu genügen; vielmehr muss der Beitrag darüber hinaus nach gewissen Richtlinien aufgebaut und formal gestaltet sein. Gleiches trifft auf die Mitteilung wissenschaftlicher Information über das Medium Buch zu.
Der Übergang von individuell gestalteter zu organisierter Kommunikation ist fließend. Der Laborbericht beispielsweise ist zwar weitgehend vom einzelnen Wissenschaftler nach seinen persönlichen Vorstellungen anlegbar; um jedoch mitteilbar zu werden, müssen die darin festgehaltenen Ergebnisse in eine mehr oder weniger standardisierte Form gegossen werden, die von vielen anderen Personen akzeptiert und verstanden wird. Heute legen viele Institute oder Forschungseinrichtungen großen Wert darauf, dass Berichte von vornherein vielen Mitarbeitern zugänglich sind – das heißt, die Organisation der Kommunikation beginnt oft bereits beim Planen eines Experiments, spätestens aber beim Festhalten der Ergebnisse.
Beide Wege – der individuelle und der organisierte – befinden sich in einer stürmischen Entwicklung, wobei keineswegs die Rede davon sein kann, der eine Weg würde dem anderen den Rang ablaufen, ihn gar entbehrlich machen. Zunächst einmal:
Das
Internet
hat zu einer Demokratisierung hinsichtlich des Besitzes an Information geführt, ja einen Boom in der individuell gestalteten Informationsvermittlung ausgelöst.
Wissenschaftler tauschen sich mehr oder weniger formlos per E-Mail über ihre Forschungsergebnisse aus, stellen sie vielleicht auf so genannte Preprint-Server (in der Physik üblich) oder auf ihre eigene Website, und das tun sie, ohne allzu viele formale Kriterien zu beachten. Diese Entwicklung ist wünschenswert und wird fortschreiten. Auf der anderen Seite kommen immer mehr -Systeme (auf die wir später noch ausführlicher eingehen) zum Einsatz, die – was die äußere Form angeht – kaum noch Freiheiten zur individuellen Gestaltung lassen, dafür aber fast automatisch dafür sorgen, dass die hier niedergelegte Information allen formalen Kriterien einer Veröffentlichung innerhalb des Unternehmens oder der Organisation entspricht.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!