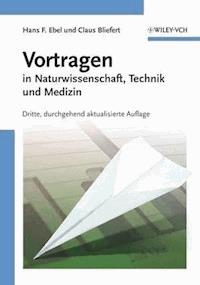
43,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ein guter Vortrag ist nicht nur eine Sache der pers nlichen Begabung oder Ausstrahlung des Redners. Dahinter steckt mindestens genauso viel harte Arbeit und das n tige Wissen. Dieses Wissen um die beste Vortragstechnik haben die Autoren in unterhaltsamer Form zusammengestellt und sch pfen dabei aus ihrem eigenen reichen Erfahrungsschatz als Redner vor verschiedenstem Publikum. Die dritte Auflage dieses Standardwerks zum wissenschaftlichen Vortragen wurde im Hinblick auf die modernen Bildbearbeitungs- und Projektionstechniken durchgehend aktualisiert und erg nzt. Die perfekte Vorbereitung f r den ersten ffentlichen Vortrag, aber auch "alte Hasen" werden hier noch viel Neues entdecken. "au ergew hnlich lehrreich und doch nicht belehrend; die lockere Art der Darstellung [macht] das Lesen zu einer wahren Freude" (Nahrung / Food) "eine u erst hilfreiche Anleitung zur Bew ltigung technischer Klippen bereits weit im Vorfeld des ffentlichen Ernstfalles" (Physik in unserer Zeit) "beschreibt mit bestechender Gr ndlichkeit und gro em didaktischen Geschick, was bei der Vorbereitung und Durchf hrung eines Vortrags alles falsch gemacht werden kann und daher zu beachten ist" (Arzneimittel-Forschung)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Contents
Vorwort
Danksagung
Teil I Ziele und Formen des wissenschaftlichen Vortrags
1 Die Bedeutung des gesprochenen Worts
1.1 Kommunikation unter Wissenschaftlern
1.2 Vorträge
1.3 Sprache und Sprechen
1.4 Wahrnehmen, Verstehen, Erinnern
2 Arten des Vortrags
2.1 Kleine und große Gelegenheiten
2.2 Fachreferat und Geschäftsvorlage
2.3 Dialektischer Exkurs
2.4 Die Stegreifrede
2.5 Der Kurzvortrag
2.6 Der Hauptvortrag
2.7 Die Präsentation
3 Vorbereiten des Vortrags
3.1 Klärungen, Termine, Zielgruppenbestimmung
3.2 Stoffsammlung und Stoffauswahl
3.3 Die drei Formen der Rede
3.4 Bild-, Demonstrations- und Begleitmaterial
3.5 Gliederung des Vortrags
3.6 Probevortragen
4 Der Vortrag
4.1 Einstimmen, Warmlaufen
4.2 Einführung und Begrüßung
4.3 Beginn des Vortrags, Lampenfieber
4.4 Freies Vortragen
4.5 Vortragen mit Stichwortkarten und Handzetteln
4.6 Vortragen mit Manuskript, der auswendig gelernte Vortrag
4.7 Einsatz von Bild- und Demonstrationsmaterialien
4.8 Ende des Vortrags
4.9 Diskussion und Diskussionsleitung
4.10 Vortragen in einer Fremdsprache
4.11 Pannenvorsorge
Teil II Bilder, Anforderungen, Herstellung
5 Projektionstechnik
5.1 Überblick
5.2 Vorführbedingungen
5.3 Originalvorlagen
5.4 Projektionsvorlagen: Arbeitstransparente
5.5 Projektionsvorlagen: Dias
5.6 E-Projektion
6 Bildtechnik
6.1 Freihand-Zeichnen
6.2 Bildvorlagen
6.3 Vom Bild zur Projektionsvorlage
6.4 Zeichnen mit dem Computer, E-Bilder
6.5 Arbeitstransparente
6.6 Diapositive und Dianegative
7 Bildelemente
7.1 Schrift
7.2 Linien
7.3 Flächen
7.4 Bildzeichen
7.5 Bildtitel
7.6 Farbe
7.7 Testen von Vorlagen und Bildern
8 Bildarten
8.1 Strichzeichnungen
8.2 Halbton- und Farbabbildungen
8.3 Poster
Kategorische Imperative
Literatur
Register
Über die Autoren
Anmerkungen zur Herstellung dieses Buches
Von denselben Autoren sind erschienen:
H. F. Ebel, C. Bliefert
Schreiben und Publizieren in den Naturwissenschaften
4. Auflage
ISBN 3-527-29626-3
H. F. Ebel, C. Bliefert
Diplom- und Doktorarbeit
Anleitungen für den naturwissenschaftlich-technischen Nachwuchs
3. Auflage
ISBN 3-527-30754-0
H. F. Ebel, C. Bliefert, A. Kellersohn
Erfolgreich Kommunizieren
Ein Leitfaden für Ingenieure
ISBN 3-527-29603-4
H. F. Ebel, C. Bliefert, W. E. Russey
TheArt ofScientific Writing
From Student Reports to Professional Publications in Chemistry and Related Fields
2nd Edition
ISBN 3-527-29829-0
Dr. rer. nat. habil. Hans F. Ebel
Im Kantelacker 15
D-64646 Heppenheim
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. Claus Bliefert
Meisenstraße 60
D-48624 Schöppingen
E-Mail: [email protected]
1. Auflage 1991
2. Auflage 1994
3. Auflage 2005
Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.
© 2005 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this book may be reproduced in any form – by photoprinting, microfilm, or any other means – nor transmitted or translated into a machine language without written permission from the publishers. Registered names, trademarks, etc. used in this book, even when not specifically marked as such, are not to be considered unprotected by law.
Print ISBN 9783527312252
Epdf ISBN 978-3-527-66244-9
Epub ISBN 978-3-527-66243-2
Mobi ISBN 978-3-527-66242-5
Vorwort
Das Vortragen ist eine zutiefst menschliche Angelegenheit, eine Herausforderung. Doch ebenso wahr ist: Der Vortrag ist in jüngster Zeit zu einem hochtechnischen Kommunikationsprodukt geworden. Die Auseinandersetzung mit diesen beiden Seiten einer immer wichtiger werdenden Mitteilungsform macht den Spannungsbogen dieses Buches aus.
In einer Zeit andauernder Entwicklungen und Veränderungen des gesellschaftlichen und beruflichen Umfelds kommt dem Vortrag und der Kunst des Vortragens ungebrochene, ja vermehrte Bedeutung zu. In der naturwissenschaftlichtechnisch-medizinischen Umgebung, für die dieses Buch konzipiert ist, gilt es, immer komplexere Sachverhalte z. B. aus Laboratorium, Technikum und Klinik in immer rascherer Folge anderen mitzuteilen, sie ihnen „vorzutragen“. Viele von uns Mitwirkenden werden, gewollt oder ungewollt, gelegentlich oder oft zu Vortragenden. Sie stehen dann vor der Aufgabe, das für einen gegebenen Zweck Wichtige zu sammeln und aufzubereiten – dies allein schon wichtige Prozeduren, die beherrscht sein wollen –, zu einer neuen Sicht zusammenzufügen und diese so zu vermitteln, dass sich das Auditorium nachher „ein Bild machen“ kann: Worum ging es, was kam heraus, was bedeutet das für mich?
Wir hatten von Anfang an eine bestimmte, im Titel des Buches umrissene und eben angesprochene Zielgruppe im Blick, eine Zielgruppe allerdings, die groß und in sich vielfach gefächert ist. Wir freuen uns, dass das Ergebnis unserer Arbeit bei Kolleginnen und Kollegen – und darüber hinaus, wie wir wissen – in zwei vorangegangenen Auflagen Anklang gefunden hat. Das macht es uns möglich, jetzt eine 3. Auflage vorzulegen. Es war an der Zeit!
Beim Vortragen, wie überhaupt beim Reden in der Öffentlichkeit, wie groß oder klein diese auch sei, gerät der oder die Vortragende in eine Ausnahmesituation. Ihr sind manche mühelos gewachsen, sie erledigen ihre Aufgabe wie selbstverständlich, fast spielerisch. Andere haben Mühe damit und begegnen der Sache mit Unbehagen. Vor allem sie – aber keineswegs nur sie – bedürfen des Rats, der durchaus zur Verfügung steht. Auch wer als Redner geboren scheint und vor Zuhörern erst richtig auflebt, muss heute mit einem anspruchsvollen „Handwerkszeug“ umgehen können und kann gleichfalls aus der Erfahrung anderer Gewinn ziehen.
Unsere Darlegungen, so das wesentliche Ziel der Neubearbeitung, sollten womöglich noch besser begründet und mit Beispielen belegt sein als bisher. Große Aufmerksamkeit haben wir der „Begegnung“ zwischen Vortragendem und Zuhörern gewidmet. „Begegnen“ die sich überhaupt, und wie? Nur zu oft gerät der Vortrag zu einer höchst einseitigen Angelegenheit, die er aber nicht sein sollte. Jemand spricht, die anderen hören sich das an – fertig. Das ist es nicht, was uns am Schluss sagen ließe: Das war ein guter Vortrag! Ein Popkonzert, bei dem kein „Funke überspringt“, bekommt am nächsten Tag schlechte Noten in der Zeitung. In Studium und Beruf hingegen hat man, so die resignierende Meinung vieler, selbst deutliche Mängel in der Art der Vermittlung hinzunehmen, weil die sich doch nicht abstellen lassen. Wissenschaftler sollen kompetent in ihrem Fach sein, Vortragskünstler müssen sie nicht auch noch abgeben. Dieser Auffassung wollen wir uns nicht anschließen.
Der Vortrag soll und kann mehr sein als Reden und Zuhören in der Gruppe mit fest zugewiesenen Rollen. Wie kann man in ihn wenigstens einen Hauch von Dialog einbringen? Das wollten wir wissen und weitergeben, denn ein Vortrag ganz ohne „Zwiesprache“ und „Kontakt“ führt meist nur unvollkommen zum eigentlichen Ziel, der Weitergabe und Entgegennahme von Inhalten.
Einige Passagen aus den vorigen Auflagen sind, da nicht mehr zeitgemäß, „über Bord“ geworfen worden, um für Neues Platz zu schaffen. Anderes wurde neu strukturiert und geordnet. Durch ein neues Layout is es gelungen, mehr Text auf eine Seite zu bringen, ohne dass die Seiten jetzt überladen wirken. Im Gegenteil, wir finden, sie sind attraktiver geworden. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht nach wie vor der bildunterstützte Vortrag vor einem fachkundigen „Publikum“, wie er heute das Geschehen auf Tagungen und Lehrveranstaltungen, in Hörsälen, Seminar- und Konferenzräumen prägt. Zum gesprochenen Wort – dem „Medium“ der klassischen Rhetorik – tritt dabei immer zwingender die Sichtbarmachung und „Belebung“ (Visualisierung, Animation) von Sachverhalten als Vermittlungsmethode. Darauf mussten wir reagieren. Beamer zur computergesteuerten Lichtbildprojektion beispielsweise sind in den „Jahren des Umbruchs“ seit dem Erscheinen der 2. Auflage dieses Buches (1994) leistungsfähiger und zugleich billiger geworden, was die Vortragsszene nachhaltig beeinflusst und die konventionelle Dia-Projektion in den Hintergrund gedrängt hat. Zunehmend beleben E-Präsentationen Business und akademische Szene. Nur das liebe Arbeitstier Overhead-Projektor ist geblieben, vor allem für kleinere Anlässe.
Dem allem galt und gilt es Rechnung zu tragen. Bei unserem Bemühen haben wir moderne Erkenntnisse der Kommunikations- und Kognitionswissenschaften ebenso berücksichtigt wie beispielsweise, auf der technischen Seite, neue Normen zur Bildprojektion im Hörsaal oder den Einsatz von Computern am Rednerpult, auch in Verbindung mit dem „Netz“.
Bei einem so komplexen Thema wie dem Vortragen kann, ja muss man sich bestimmten Stellen von verschiedenen Seiten nähern. Wir haben deshalb ein gewisses Maß an „Wiederholung“ zugelassen, dieses Wort hier in Anführungszeichen setzend, weil ja jede Annäherung neue Einblicke und Ausblicke gewähren kann, also nicht wirklich wieder herholt, was schon einmal da war. Keineswegs immer haben wir durch Querverweise angezeigt, dass über einen bestimmten Gegenstand auch an anderer Stelle etwas gesagt wird. Wichtiger schien es uns, im Register – durch das beharrliche Einrücken von Unterbegriffen – dafür zu sorgen, dass auch die Leser oder „Benutzer“ des Buches schnell zu den gefragten Kontexten geführt werden, die eher punktuell nach Auskunft suchen.
Vor dem Hintergrund fortlaufender Lehr- und Vortragstätigkeit vor allem des einen von uns dürfen wir sagen, dass wir an den Entwicklungen aktiv teilgenommen und alles, was wir hier ausbreiten, selbst „erfahren“ haben. Besonders zustatten kamen uns Lehraufträge an mehreren technischen Fachbereichen der Fachhochschule Münster und anderer Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen, auch im Ausland. Einladungen aus wissenschaftlichen Gesellschaften (z. B. von den Jungchemikern in der Gesellschaft Deutscher Chemiker) und der Industrie erweiterten die eigenen Horizonte. Immer wieder ist uns dabei der freundliche Rat von Kollegen wie Teilnehmern zuteil geworden. Gerade auch die Begegnung mit Studenten, also jungen Hörerinnen und Hörern, hat uns immer wieder inspiriert und uns in unserem Mühen bestärkt. Vielen Personen gilt so unser herzlicher Dank (s. Danksagung auf der nächsten Seite).
Auch Ihnen gegenüber würden wir uns gerne in die Schuld begeben. Dazu haben wir unseren Anschriften im Impressum (Seite IV) unsere E-Mail-Adressen angefügt und es Ihnen so leicht gemacht, mit uns in Verbindung zu treten. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie davon Gebrauch machen wollten und so auch an dieser Stelle ein wenig „Dialog“ entstünde. Schon jetzt danken wir für jeden Kommentar von Leserseite – von Ihnen – und für Hinweise auf mögliche Verbesserungen.
Wir wünschen Ihnen, dass Ihr nächster Vortrag ein paar wohl gelungene Kreise über den Köpfen der Anwesenden zieht, bevor er zu einer eleganten Landung ansetzt, wie die Papierschwalbe auf dem Umschlagbild, wenn sie richtig gebaut und geworfen wird.
Heppenheim und Schöppingen,
im September 2004
H. F. E.
C. B.
Danksagung
Für zahlreiche Hinweise und tatkräftige Unterstützung danken wir
besonders herzlich. Weiterhin gilt unser Dank für vielerlei Hilfe und Rat
Teil I
Ziele und Formen des wissenschaftlichen Vortrags
1
Die Bedeutung des gesprochenen Worts
1.1 Kommunikation unter Wissenschaftlern
1.1.1 Die Kunst der Rede
Auch der publikationsfreudigste Wissenschaftler spricht mehr, als er schreibt. Ist ein Vortrag für ihn wichtiger als eine Publikation? Darüber zu spekulieren erscheint müßig. Sicher ist, dass Redegewandtheit und die Kunst der Rede in ihrer Bedeutung für berufliches Fortkommen und Karriere nicht hoch genug eingeschätzt werden können (s. beispielsweise Ruhleder 2001, Hartig 1993). Landauf, landab werden dazu Kurse angeboten, die von der Stimmbildung – der systematischen Schulung zur Heranbildung einer klangschönen, belastbaren Stimme – bis zur Gesprächstechnik (Dialogik) und Redetechnik (Rhetorik) reichen.
Abendakademien und andere Institutionen der Erwachsenenbildung widmen sich dieser Aufgabe, Firmen schicken ihre Mitarbeiter auf entsprechende Seminare. Wissenschaftler aber neigen dazu, dieses Feld Politikern, Werbeleuten und anderen Anwendern der Rede und Überredungskunst zu überlassen. Als Akademiker sind sie darüber erhaben – und manche ihrer Vorträge und Vorlesungen sind danach! Ein wesentliches Ziel dieses Buches wäre erreicht, wenn es an dieser Stelle zu einem geänderten Bewusstsein beitragen könnte.
Denn die Wirklichkeit ist: Wir, die Fachleute – die, die etwas zu sagen haben – stolpern in unsere ersten Redeabenteuer mehr oder weniger unvorbereitet. Wir stolpern hinein, statt dass wir auf sie zugingen. Wir blamieren uns, so gut wir eben können, oder auch nicht – wenn nicht, sind wir ein Naturtalent. In seinem Buch Der Kongreß vermerkte dazu der Neurochemiker Volker Neuhoff (1992, S. 13):
Es ist des Menschen unveräußerliches Recht, sich zu blamieren – doch er ist nicht dazu verpflichtet.
Mit unserem Buch wollen wir andere – Jüngere – vor Situationen bewahren helfen, in denen sie sich blamieren könnten. Wir wollen ihnen die Gewissheit geben, dass sie mit gutem Erfolg vortragen können, auch wenn sie sich dazu zunächst nicht auserwählt fühlen. Kann man gutes Vortragen lernen? Kann man es lehren? Ein Älterer hat sehr schön ausgedrückt, was von solchen Fragen und Zweifeln zu halten ist (s. Kasten auf S. 4). Ähnlich äußert sich jung, dem wir auch den Hinweis verdanken, wie schon die Römer darüber dachten, nämlich in unnachahmlicher Kürze so: „Poeta nascitur, orator fit„ („Ein Dichter wird geboren, ein Redner dagegen wird gemacht“).1)
1.1.2 Kommunikation
Schon an anderer Stelle (EBEL und BLIEFERT 1998) haben wir herausgearbeitet, wie wichtig die Kommunikation zwischen Wissenschaftlern ist: ohne sie Stillstand der Wissenschaft, ohne sie keine berufliche Entwicklung des Einzelnen. Ging es uns dort in erster Linie um das geschriebene Wort als Mittel der Kommunikation, so hier um das gesprochene. „Wissenschaft entsteht im Gespräch“, schrieb Werner HEISENBERG im Vorwort zu seinem Buch Der Teil und das Ganze: Gespräche im Umkreis der Atomphysik (HEISENBERG 1996). Die ersten „Akademiker“ – Plato, Aristoteles und ihre Schüler – erdachten sich ihre Welt, die Welt, am liebsten im Gespräch oder verliehen ihren Abhandlungen Gesprächsform. In dem Sinne können wir in HEISENBERG einen modernen Platoniker sehen, wie sein Buch zur Genüge beweist (vgl. auch HEISENBERG 1990).
Es hilft, sich den Vortrag als eine organisierte Form der mündlichen Kommunikation vorzustellen, als eine Fortsetzung des im Kleinkreis geführten Gesprächs.
Unser Buch wendet sich an die Vertreter der naturwissenschaftlich-technischen und der medizinischen Disziplinen.1) Für sie alle spielt auch die mit der verbalen (mündlichen, gesprochenen) Kommunikation verbundene nichtverbale Kommunikation eine wichtige Rolle, vor allem die Vorführung – Präsentation – von Bildern (visuelle Kommunikation). Für viele ist ein Vortrag im akademischen oder geschäftlichen Raum, von ein paar Festreden abgesehen, ohne Bilder nicht mehr vorstellbar. In den USA beispielsweise tritt so neben das Wort “speaker” für den Vortragenden zunehmend das Wort “presenter”, der Vortrag selbst wird entsprechend zur “presentation”, wie das bei Michael ALLEY geschieht (ALLEY 2003). Rhetorik und Visualisierung sind somit untrennbar verbunden. Woher rührt das?
Bilder können komplexe Sachverhalte oft besser erklären als Worte: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“.
(Wir haben eine chinesische Spruchweisheit zitiert.) Bilder lassen sich heute mühelos farbig, in Bildfarbe, in Szene setzen. Allein dadurch kann ein Vortrag viel gewinnen – für die Zuhörer: schnelleres Erkennen von Strukturen und Zusammenhängen, besseres Verstehen, mehr Aufmerksamkeit. Mit noch so „gekonnt“ eingesetzter Klangfarbe beim Sprechen kann man da nicht mithalten. Auf das Bereitstellen von Bildern und ihr Einbringen in den Vortrag werden wir deshalb im Folgenden ausführlich eingehen.
Menschen, die mit (oder vor) dem Fernseher aufgewachsen sind, sind in weit stärkerem Maße auf Bilder fixiert als frühere Generationen. Die Verleger von Lehrbüchern müssen darauf auch bei der geschriebenen Kommunikation Rücksicht nehmen. Das Wort, gleichviel ob geschrieben oder gesprochen, ist enger an das Bild herangerückt. Deshalb muss jeder heute etwas von Bildtechnik verstehen, der Redner zusätzlich von Projektionstechnik. Auch als Anleitung dazu ist dieses Buch gedacht (s. besonders die Kapitel 5 und 6).
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























