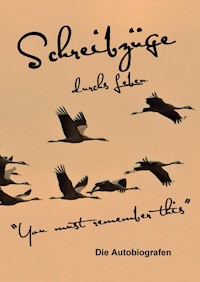
Schreibzüge durchs Leben E-Book
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Es war ein großes Abenteuer für die acht Autobiografen der Generation 50+ der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität, sich selbst und den anderen beim Schreiben über das eigene Leben zu begegnen. Vier Semester Schönes, Lustiges, Berührendes und auch Bedeutendes bescherten uns unsere "Schreibzüge durchs Leben".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Marliese Schüpferling, Katharina Jennewein-Lohrey, Heidrun Friedt, Marita Mallmann, Petra Lustenberger, Dieter Mallmann, Axel Kiltz, Peter Przybylski
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Petra Elisabeth Lustenberger
Schneewittchen ist tot
„Oh, wie schön Du bist…!“ – aus meiner Kindheit
Die goldene Hochzeit
Das Fotoalbum
Und jetzt?
Axel Kiltz
Mein Bruder „Hans Hermann“
Der erweiterte Zugang
Marita Mallmann
Warum ich über mein Leben schreibe
Meine Geburt
Kindheit
Der Burggarten
Zwei Weltwunder auf einmal
Neubeginn
Umarme den Tag
Vorbilder sind Wegweiser
Meine wiedergefundene Schwester
Heute ist der 30. Juli 2019…
Die alte Kaffeemühle
Herbst
Marliese Schüpferling
Butterblumen am Telegrafenmast
Im Sommer die Getreideernte
Im Herbst die Traubenlese
Schule
Unser Dorfpfarrer
Ich lieb Dich, ich lieb Dich nicht
Klassentreffen
Unser erstes Enkelkind
Katharina Jennewein-Lohrey
Eine kinderreiche Familie
Ein geschenktes Haus
Pariser Mai, Prager Frühling
Frauenbewegung
Heidrun Friedt
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht,
Ich wagte einen Neuanfang
Ein Herbsttag im Alter.
Ein neues Ziel – Rucksack-Wandern.
Wer bin ich, wenn alles von mir abfällt
Dieter Mallmann
Tanzschule
Hausschlachtung
Mein Tag beginnt früh
Peter Przybylski
Eine Reise in eine andere Welt und Zeit
Dead People, Boat People, Rich People
Epilog
Danksagung
Prolog
Machen wir uns auf den Weg! Es ist vielleicht einer der rätselhaftesten und magischsten Momente, die wir erleben können – der Moment des Erinnerns. Im Bruchteil einer Sekunde reisen wir in eine vollkommen andere Zeit und Welt.
Begleiten Sie uns auf diesen Erinnerungswegen, die wir in vier Semestern autobiografisches Schreiben an der Mainzer Universität in zahlreichen Texten festgehalten haben. Es ist eine Wanderung durch die Summe vieler großer und kleiner Ereignisse, Eindrücke und persönlicher Erkenntnisse.
Sie erhalten tiefe Einblicke in das Leben der einzelnen Teilnehmer. Aus der Sicht eines Musikliebhabers könnte der Eindruck entstehen, es seien Passagen von lauten Posaunen, leisen Klarinetten, mitreißenden Violinen und ausgleichenden Bratschen. Das Leben – ein Musikstück. Es gibt uns den Takt, den Rhythmus und das Tempo vor. Es offenbart sich uns in den ständig wandelnden Melodien.
Unser „Orchester“ besteht aus acht Personen. Jede und jeder von uns ist einzigartig und hat Ihnen aufregende, lustige und auch nachdenklich stimmende Episoden aus verschiedenen Lebensphasen zu erzählen. Lauschen Sie hinein in die Melodien unserer Leben und begleiten Sie uns ein Stück des Weges!
Wir wünschen Ihnen, dass Sie ein wenig von der Begeisterung „Schreiben“ übernehmen, die uns motiviert hat, dieses Buch zu initiieren. Wir beginnen gleich mit der ersten Vorlesungsstunde.
Petra Elisabeth Lustenberger
Ich wurde 1958 an Weihnachten in Mainz geboren. Mainz-Kostheim war der Ort meiner Kindheit und Jugend. Hier unterhielten meine Eltern einen Baustoffgroßhandel. Sie gaben mir Geborgenheit, Liebe und Sicherheit.
Als Kind hatte ich aufgrund der vorhandenen beruflichen Lebensumstände meiner Eltern einen großen persönlichen Freiraum, den ich nutzte und der sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht: Kein Kindergarten, kein Chef, keine Heirat, keine Kinder.
Ich führe ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes Leben mit meiner großen Liebe, genieße meine Freiheit, meine Unabhängigkeit und lebe nach meiner eigenen Lebensphilosophie:
Das Wilde bleibt ein Leben lang rebellisch.
Es beugt sich keiner Macht!
Schneewittchen ist tot
„Neujahrsmorgen. Raureif überzieht die Reben mit einer glitzernden Schicht. Strahlend weißer Schnee legt sich wie Puderzucker über die Weinberge. Es herrscht Dauerfrost. Der Himmel ist wolkenlos. Alles scheint unberührt - ja jungfräulich. Stille liegt über dem Dorf. Der barocke Kirchturm thront über den mittelalterlichen Fachwerkhäusern mit den kleinen, engen und verwinkelten Gassen. Alles ist menschenleer. Wie erloschen ist das Leben. Selbst der Kirchgang ist in weite Ferne gerückt. Ein bellender Hund unterbricht die Ruhe. Sein Besitzer radelt, der Kälte und dem Schnee trotzend, mit einem uralten Fahrrad im grünen Lodenmantel, Schal und Federhut sowie Filzhandschuhen seinem Hund hinterher. Sein Weg führt ihn unterhalb der Kirche die Weinberge entlang.
Es ist der alte Winzer aus dem großen, stattlichen Weingut unterhalb des Ortes. Jeder kennt ihn. Er fährt zügig, willig und dennoch etwas unsicher. Sein Lenker schwankt hin und her. Der Schnee ist hart gefroren und bietet keine gute Unterlage. Der Hund, ein Rauhaardackel, eilt ihm immer noch bellend weit voraus.
Er kommt an die Gabelung unterhalb des Wegekreuzes. Unter diesem Wegekreuz steht seit Jahrzehnten eine alte, marode Holzbank. Darauf sitzt eine junge Frau, mit dem Rücken angelehnt, im weißen Abendkleid mit weit ausgeschnittenem Dekolleté, eleganten Spitzenschuhen mit hohen Absätzen. Der Hund steht laut kläffend vor ihr. Sie rührt sich nicht und starrt mit offenen Augen geradeaus. Ihre schwarze, elegante kleine Tasche liegt geöffnet auf dem Boden vor ihr. Der Schnee unter der Bank ist blutrot gefärbt. Es bietet sich ihm ein wahrlich bizarres Bild. Der Radfahrer richtet seinen Blick im Vorbeifahren Richtung Bank. Er schaut der Frau direkt in die Augen. Sein Gesicht erstarrt, er bremst, wirft das Fahrrad auf den Boden und geht zögerlich, ja fast verhalten die wenigen Schritte zurück. Bereits ahnend, dass etwas Schlimmes passiert sein musste, steht er nun vor ihr. Sie ist tot. Erstarrt in der Kälte. Den Moment des Todes festgehalten im letzten Atemzug. Fast lächelnd wirkt ihr Gesicht. Die rot geschminkten Lippen schimmern in der Sonne. Inmitten des Endgültigen, dessen Hauptrolle sie übernahm, verkörpert sie sichtlich Anmut und Stolz. Er starrt sie an. Einen kurzen Augenblick zögert er, kaum fähig zu begreifen, was er sah. Panikartig beginnt er in den Manteltaschen sein Mobiltelefon zu suchen. Aufgeregt mit zitternden Händen tippt er die Notrufnummer.“
Ja! Blut sollte fließen, viel Blut! Lange schon träumte ich davon, einen Kriminalroman zu schreiben. Geistig viele Male durchdacht, teilweise in den vergangenen Wintermonaten bereits lose zu Papier gebracht, spannend, der Mörder letztendlich ohne Chance. Jetzt im April saß ich an einem Dienstagmorgen im Auto meiner Freundin und deren Mann Richtung Mainzer Johannes Gutenberg-Universität. Studieren 50+ war angesagt: Autobiografisches Schreiben – vor uns lagen vier Semester. Im Grunde genommen war es mehr ein Nachgeben gewesen. Aus einer Laune heraus sagte ich zu, ohne jemals damit zu rechnen, dass es Wirklichkeit werden könnte.
Wir parkten auf dem Uni-Gelände und waren inmitten von Studenten. Es war ein wildes Durcheinander vor den Gebäuden. Lauter junge Menschen um mich herum – so viel Lebendigkeit! Ich fühlte mich so jung wie schon lange nicht mehr. Eine Leichtigkeit der ersten warmen Frühlingstage lag in der Luft. Sie beschwingte mich und bereitete mir gute Laune. Dennoch betrat ich mit gemischten Gefühlen den Raum für die erste Vorlesung. Neuland!
In meiner Hand hielt ich einige alte Fotos aus meiner Kindheit. Diese hatten wir mitbringen sollen. Sie hatten bis dahin längst vergessen in einem alten Karton geschlummert, versteckt zwischen einigen Büchern im Regal bei mir Zuhause.
Mein eigenes Leben aufzuschreiben hielt ich für nicht schreibenswert. Ich trauerte in Gedanken meinem Krimi hinterher. Dort hatte meine Fantasie Platz, konnte sich austoben, erfinden und dichten.
Ich fühlte mich wohl in diesen Rollenspielen. Ich war Mörder oder Opfer oder jagte den Gejagten, wechselte die Orte, das Geschehen, wann und wie es mir passte. Ich dachte an die von mir so treffend formulierten Sätze, die ich am liebsten nach stundenlangem Nachdenken in Blei gegossen hätte. Meine Hauptfiguren hatte ich tief in mein Herz geschlossen und lebte in Gedanken eine Zeitlang mit ihnen. Nun diesen Kokon verlassen, in den ich mich zusammen mit den Protagonisten zurückgezogen hatte? Und jetzt? Was erwartete mich hier?
Ich fing an zu grübeln. Ich schaute auf meine Bilder und dachte: Manchmal kommt man von der Kindheit nicht los. Vor allem nicht von den schönen Tagen, die sich damals warm, weich und wunderbar anfühlten, so, dass mich die Erinnerungen manchmal noch jetzt, als Erwachsene, durch mein Leben tragen. Sie leuchten farbenfroh, wärmen meine Seele. Aber sie können auch tiefschwarz sein und ich wünschte mir, ich könnte sie für alle Zeiten aus meiner Erinnerung verbannen. Gott sei Dank hielten sich diese Erlebnisse in meinem Leben in Grenzen.
Selbstvergessen träumte ich vor mich hin. Ich schaute die Fotos durch und stapelte sie auf dem Tisch. Einige Fotos zeigten mich als Fünfjährige inmitten des großen, wunderschönen Gartens meiner Großmutter im Sommer. Beim Anblick der Bilder roch ich wieder den Duft der Rosen. Ich hörte die Stimme meiner Großmutter und das monotone Summen der Wasserpumpe. Ein jüngeres Foto zeigte mich als Baby in den Armen meiner stolzen Eltern. Im Hintergrund das damalige Wohnzimmer. Stilsicher eingerichtet mit Nierentisch, Mustertapete und Blumenampel. Obenauf kam das Bild von der Ostereiersuche im Garten meiner Tante. Stolz präsentierte ich als Dreijährige mein volles Osterkörbchen. Ich versank in einer nicht gemähten Wiese, war festlich gekleidet und umgeben von blühenden Osterglocken. Oh, wie ich diese Osterfeste liebte…
Stimmen rissen mich aus meinen Gedanken.
Der Raum füllte sich. Auf den Stühlen saßen schon einige meiner zukünftigen Mitstreiter. Ich schaute mich um und dachte spontan, dass Menschen wie Städte sind. Manche sind mir einfach auf den ersten Blick sympathisch, weil sie über jene gottgegebene Ausstrahlung verfügen, die man Charisma nennt. Hier gab es einige davon.
Mir fiel unter den meist weiblichen Anwesenden ein Mann auf. Er trug Jeans mit Hosenträger und ein kariertes Hemd. Er hatte sich ganz vorne platziert. Ein Schreibblock lag vor ihm auf dem Tisch. Die dunkle Aktentasche hatte er auf den Boden gestellt. Seine Blicke schweiften interessiert durch den Raum, während er mit seinem Kugelschreiber spielte.
Ja, nun entdeckte er den Ehemann meiner Freundin und nahm sofort Blickkontakt mit ihm auf. Er war sichtlich erleichtert, nicht allein unter Frauen zu sein. Sein verschmitztes Lächeln hatte eine einnehmende Ausstrahlung. Erwartungsvoll lugten seine hellwachen Augen hinter der Brille hervor. Die grauen, lockigen Haare gaben ihm ein burschikoses, jugendliches Äußeres. Ich schaute ihn an und überlegte, welchen Beruf er wohl früher ausgeübt hatte. Auf jeden Fall etwas aus dem Bereich der Wissenschaften. Physiker, Chemiker oder ein artverwandter Beruf, dachte ich. Wie ich dann kurze Zeit später bei der Vorstellungsrunde hören würde, war er Mathematiker. Das hatte ich fast richtig eingeschätzt.
Eine Atmosphäre zwischen Erwartung, Aufregung und Spannung war im Raum. Man platzierte sich, lächelte sich verhalten zu und versuchte sich zu ordnen. Obwohl wir uns bis dato nicht kannten, war eine gewisse Vertrautheit zu spüren. Oder war es eher ein gemeinsames Ziel – die eigene Autobiografie zu schreiben - die in mir dieses Gefühl auslöste? Ich empfand das Bedürfnis, das Stück eines Ganzen werden zu wollen. Einem geschlossenen Kreis nun bald anzugehören, erzeugte in mir eine innere Spannung.
Die Intention hier zu sitzen, mag von Person zu Person wohl unterschiedlich sein. Aber alle haben den gleichen Weg vor sich, überlegte ich.
Ja, das Schreiben zog mich schon immer magisch an. Es wird eine abenteuerliche Reise mit dem Stift in der Hand werden. Das Schreiben trägt mich aus Raum und Zeit. Wird es mich in die verwinkelten Ecken meiner Seele bringen, die ich sonst vielleicht nie entdecken würde? Mit jeder geschriebenen Zeile werde ich wohl mehr über mich erfahren. Es wird sicher auch ein Rückzug aus dem Alltag werden, vom Lauten zum Leisen. Schreiben ist nicht nur das Notieren des eigenen Erlebten, um nicht zu vergessen. Es ist viel mehr. Es ist immer auch ein Dialog mit mir selbst. Es verändert, stößt etwas an, von dem ich vorher nichts ahnte. Es kann befreien und auch beglücken. Denn wenn ich jetzt schreibe, gebe ich meinem Ich eine Stimme. Egal, was ich zu sagen habe. Ich trete in Kontakt mit mir selbst. Ich spreche mit mir und höre mir zu. Das allein zählt für mich. Im Raum wurde es ruhiger. Er war nicht groß, fast alle Plätze waren zwischenzeitlich belegt. Die Tische waren in U-Form angeordnet, wir saßen eng zusammen. Es waren ungefähr 15 Personen anwesend.
Die Dozentin hatte nun das Wort. Jeder der Anwesenden lauschte aufmerksam ihren ersten Worten und Anweisungen. Sie sprach von gegenseitigem Vertrauen, Wertschätzung und der Verschwiegenheit des hier Gesagten und Gehörten.
Gut so, sagte ich als Bestätigung zu mir. Es gab mir in diesem Moment Sicherheit für das Zukünftige, für das, was kommen wird. Alle Teilnehmer stellten sich vor. Das Altersspektrum bewegte sich von 55 bis 75 Jahren. Ich fühlte mich wohl in dieser Runde.
Dann fragte die Dozentin nach unseren ersten Kindheitserinnerungen. Ich versuchte, mich zu konzentrieren und dachte, bis zu diesem Moment kaum detaillierte Erinnerungen an meine Kindheit zu haben. Es waren mehr Stimmungen und Gefühle. Manchmal gab es eher zufällig kurze Erinnerungsmomente an das lange vormals Geschehene. Wie ein Duft, den man plötzlich in der Nase hat und mit dem man Gefühle von Geborgenheit, Glück und Freiheit verbindet. Mein bisher fast unbeschwertes Leben hatte ich nie in Gedanken an die Vergangenheit gelebt. Nur die Zukunft zählte. Wünsche, Ziele und Träume schauen voraus und nicht zurück. Wie würde ich wohl jetzt empfinden? Ja, gute Erinnerungen blieben. Und die anderen? Die unterdrückten, die ins Abseits geschobenen Erlebnisse? Das Verdrängte?
Wir hatten 20 Minuten Zeit, unsere ersten Erinnerungen zu notieren. Ich sah ein unbeschriebenes Blatt vor mir. Meine Gedanken waren ganz woanders. Ich versuchte, meine Gefühle zu packen und einzuordnen. Ja, Geduld wird nötig sein. Es wird ein emotionaler und intensiver Prozess, der Ehrlichkeit erfordert. Ehrlichkeit mir selbst gegenüber und den hier Anwesenden. Ich werde wohl Schwäche und Überforderung spüren, genauso wie Stärke und Höhenflüge. Mich zu öffnen – dazu gehört Mut, denn Authentizität ist die Essenz unseres Selbst. Sichtbar dokumentiert auf Papier steht es dann unwiderruflich da. Ich dachte, es wird vor dir liegen – dein Leben. Dich anstarren und dich herausfordern, mutig weiterzuschreiben. Oder werde ich in Zweifel geraten und das Ende nie erreichen oder erreichen wollen?
Ich werde es riskieren, sprach ich zu mir selbst. Keine halben Sachen, dachte ich weiter und fing endlich an zu schreiben. Der Stift bewegte sich plötzlich wie von Geisterhand. Von Minute zu Minute dachte ich schneller, als ich schreiben konnte. Es öffneten sich all diese verschlossenen Türen zu den Erinnerungen. So, als ob sie schon lange in meinem Innersten darauf gelauert hätten und nur darauf warteten, von mir wahrgenommen zu werden.
Es war still im Raum. Das war gut so. Die Stille verbindet uns mit dem Eigentlichen. Sie macht uns bereit, den Dingen auf den Grund zu gehen, denn Tiefe entsteht nur im Moment der inneren Ruhe. Ich nutzte diese Momente der inneren Ruhe und schrieb.
Ich dachte: Diese Momente sind unabdingbar. Es gibt keine Zweifel daran, am richtigen Ort zu sein. Das Schreiben ist für mich wie für eine andere Person vielleicht das Reiten, Kochen oder Segeln. Ich weiß jetzt, wann ich mich am wohlsten fühle. Ich werde genau diesen Momenten in Zukunft den Raum geben, den ich für notwendig erachte. Ich werde nicht denken, gerade etwas anderes machen zu müssen, um irgendwelchen Verpflichtungen nachzukommen oder Ansprüchen gerecht zu werden. Zeit ist ein wertvolles Gut: Sie will gefühlt und gefüllt werden mit unserem Tun und Schaffen. Jetzt ist Zeit für mich.
Und schon wieder hatten mich meine Gedanken und Emotionen eingeholt, abgelenkt und auch indirekt motiviert.
Bereits in der ersten Vorlesung entstanden verbindende Momente zu meiner Kindheit, den Eltern, Geschwistern und deren Leben und Geschichten. Dabei verweilten die Gedanken auf liebgewonnenen Gegenständen, die mit Emotionen und Erinnerungen aus meiner Kindheit verbunden sind. Der Teddybär von früher, der immer noch in der Nachtkommode neben der Taufkerze lag, die uralten Glückwunschkarten von meiner Geburt, die gebündelt im Schrank liegen. Nicht zu vergessen die alte Wiege aus Holz. Sie stand im Keller. Jedes Mal, wenn ich in den Keller ging, schaute ich sie mit dem Gefühl einer großen inneren Verbundenheit an. Ja, manchmal merkt man erst mit der Zeit, was man an den Dingen und den Menschen hat. Wie tief sie letztendlich mit uns verbunden sind.
Ich blickte zwischendurch in die Runde. Nicht jeder, so hatte ich den Eindruck, fühlte sich wohl in seiner neuen Rolle als Autobiograf. In einigen Gesichtern, in die ich schaute, spiegelten sich die Gedanken der Vergangenheit wider. Ich fühlte, wie schwer die Last der Erinnerung auf ihnen lag. Ich versuchte, mich in ihre Lage und Gefühle zu versetzen. Das eigene Leben wurde bei unseren ersten Schritten des Notierens ganz leise immer mehr gegenwärtig. Es erlaubte uns, Momente unseres Lebens von innen heraus zu betrachten und zu bewerten. Das ist der Augenblick, in dem wir zur handelnden Person unserer Erinnerung wurden. Wir waren es, die das Glück empfunden hatten, denen etwas zugestoßen war und die ein Unglück erlebt hatten.
Kein Mensch kann sich die Familie auswählen, in die er hineingeboren wird. Weder den Zeitpunkt seiner Geburt noch den Ort, das Land, die Kultur und ökonomische Situation, in der er das Licht der Welt erblickt. Dennoch ist es das Nest, der Anfang unseres Lebens und der Biografie, dem wir uns nicht entziehen können. Die Familie ist die mächtige Existenz im Hintergrund unseres Daseins. Sie prägt uns. Im besten Falle ist sie stabile Basis für unseren Lebensweg. Doch allzu oft entfaltet sie zerstörerisches Potenzial. Was tun, wenn der Vater Alkoholiker war? Die Mutter depressiv? Wie mit den tiefen Wunden umgehen? Wohin mit der Ungerechtigkeit? Ja, die eigene Familie steckt tief in einem drin, manchmal mehr als einem lieb ist. Aber auch manchmal weniger, als man es sich insgeheim gewünscht hätte.
Ich hörte auf darüber nachzudenken und spürte Dankbarkeit, selbst auf eine unbeschwerte Kindheit blicken zu können.
Einige von uns trugen die Notizen ihrer ersten Kindheitserlebnisse vor. Ich hörte aufmerksam und interessiert zu. Meine Ahnungen bestätigten sich. Nicht jede Kindheit war so unbelastet wie die meinige. Ich bewunderte die Offenheit meiner neuen Kollegen. Teilweise fühlte ich mit ihnen. Das war kein leichter Moment.
Als sich der Unterricht dem Ende zuneigte, war ich um einige Dinge reicher. Eines war mir klar: Es gibt keine objektive Sicht auf die eigene Biografie. Nichts, aber auch absolut nichts, an das wir uns erinnern, ist neutral aufbewahrt, sondern bereits emotional bewertet. Wir speichern somit nicht nur das Erlebte ab, sondern vor allem die damit verbundenen Gefühle und Wahrnehmungen. Und je stärker die Emotionen eines bestimmten Ereignisses waren, desto besser erinnern wir uns. Und der wundervollste Moment beim Schreiben für mich ist der, in dem die Worte vor den Augen verschwimmen und sich beim Lesen wieder zu Bildern und Gefühlen formen. Ich werde versuchen, diese Momente immer wieder zu erleben.
Die Zeit verging wie im Flug an diesem Tag des Semesterbeginns. Glücklich verließ ich nach Unterrichtsende mit meinen Freunden den Raum. Bei der Heimfahrt im Auto träumte ich auf der Rückbank, schaute hinaus in den Himmel und dachte an den Dichter Hermann Hesse. Ein jeder kennt sein Dichterwort:
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“
„Oh, wie schön Du bist…!“ – aus meiner Kindheit
Es war ein kalter, grauer und verregneter Samstagnachmittag im Herbst. Die Wolken hingen am Himmel wie dicke Bettdecken. Kaum vorstellbar, dass eine Wolke nichts anderes als eine Ansammlung kleinster Wassertropfen ist. Präsent, aber nicht greifbar.
Meine Mutter war in der Küche damit beschäftigt, einen Kuchen für die Sonntagstafel zu backen. Ich schaute gelangweilt aus dem Fenster unserer Küche in den Garten. Rinnsale liefen die Scheiben hinab. Im Garten war es still geworden. Die Vögel hatten längst den Flug in den warmen Süden angetreten. Die alte Schaukel wehte sanft hin und her. Der Wind wirbelte das bunte Laub auf und die Blätter tanzten auf dem nassen Rasen. Ich seufzte. Wie wunderbar der letzte Sommer doch gewesen war, dachte ich. Nun sah alles trostlos und verlassen aus.
Langsam hellte sich der Himmel auf und auch meine Stimmung, denn mein Vater kam in die Küche und fragte mich spontan: „Es ist Kerb! Hast Du Lust? Kommst Du mit?“
„Ja“, sprudelte es aus mir heraus und schon waren wir davongeeilt. Wir liefen quer durch unseren Ort an das Mainufer von Kostheim. Von weitem sah ich den erleuchteten Horizont. Die vielen bunten Lichter erhellten den düsteren Himmel. Ich war voller Erwartung. So gingen wir schneller, immer schneller. Es roch nach gebrannten Mandeln. Menschen kamen uns lachend entgegen mit Lebkuchenherzen um den Hals, Tüten mit Popcorn oder Zuckerwatte in der Hand. Sie waren fröhlich und gut gelaunt. Die Kinder hielten Schnüre in ihren Händen, an denen bunte Luftballons befestigt waren und trugen Stofftiere unter den Armen. Große, glückliche Kinderaugen schauten mich an. Ich ging an ihnen vorbei und berührte ihre Ballons zart mit dem Finger, verbunden mit dem Wunschgedanken, nun bald auch einen zu bekommen. Die Menschenmenge wurde dichter, das Licht heller, die Düfte intensiver.
„Hereinspaziert“, hallte es uns entgegen. Nach einer gefühlten Ewigkeit tauchten wir endlich in diese bunte Glitzerwelt ein, in der alles viel zu laut und zu bunt war und die mich dennoch unwillkürlich verzauberte. Wir durchschritten das Eingangstor und sahen in die vielen Gassen mit ihren Verkaufsständen, Fressbuden und Schiffschaukeln. Mit Mühe bahnten wir uns den Weg durch die Menschenmassen. Wir gingen vorbei an einer Schießbude. Ein Besucher versuchte, mit einem Gewehr auf eine kleine Dosenpyramide zu schießen. Mein Vater blieb stehen und schaute zu. Die angespannten Gesichter waren auf den Schützen gerichtet. Er hatte einen grünen Hut auf und versuchte sich zu konzentrieren. Spannung lag in der Luft. Endlich knallte es und die Dosen flogen in die Höhe. Die Freude der Beteiligten war groß. Der Schütze riss glücklich die Arme hoch und nahm seinen Gewinn, eine Pfauenfeder und eine kleine Flasche Sekt, entgegen.
Wir schlenderten neugierig weiter und berauschten uns an den Klängen, Farben und Düften. Unsere Augen erblickten Marktschreier, Muskelprotze und Akrobaten.
Das Leben pulsierte und all die Eindrücke strömten auf unsere Sinne ein; sie bildeten eine Atmosphäre des Außergewöhnlichen. Eine wunderbare Leichtigkeit lag in der Luft. Die Zeit war außer Takt geraten – alles war gut. Nein - es war wunderbar. Ein Gefühl einer unstillbaren Sehnsucht, hier zu bleiben, machte sich in mir breit.
„Lose zu verkaufen! Lose zu verkaufen!“, schrie es uns voraus. Ein lustiger Clown mit einer knallroten Nase hielt meinem Vater den Eimer mit den Glückslosen direkt vor das Gesicht. Er zog sein Portemonnaie und forderte mich auf, fünf Lose zu ziehen. Der Clown schüttelte den Eimer und ich zögerte. Welche Lose soll ich nehmen? Sie sahen alle gleich aus. Ich nahm mit spitzen Fingern welche von ganz unten. Gleichzeitig nahm ich wahr, dass ich inmitten von Nieten und Papierschnipseln stand, die den Boden unter meinen Füßen bedeckten. Aufgeregt öffnete ich das erste Los.
„Leider verloren“, las ich, nachdem ich das Papier aufgerollt hatte. Mit den nächsten drei Losen erging es mir ebenso. Ich war den Tränen nahe. Ich blickte auf die vielen Gewinne, die in den Regalen hübsch aufgereiht waren. Hell erleuchtet warteten sie auf ihre neuen Besitzer. Riesige Stofftiere wie Löwen, Tiger, Eisbären, Puppen, Spielzeug und noch so einiges mehr. Nun war das letzte Los an der Reihe. Ich schaute meinen Vater mit erwartungsvollem Blick an. Mein Herz klopfte laut, als ich eine Gewinnnummer las. Triumphierend verzog ich das Gesicht.
Er lachte, als er mich ansah und sagte:
„Komm, wir holen den Gewinn ab. Mal sehen, was Du gewonnen hast.“
Eine dicke Frau mit blonden wilden Haaren und knallrotem Lippenstift stand vor der Gewinnausgabe. Sie beugte sich zu mir herunter, lachte mich freundlich an und nahm mir das Los aus der Hand. Sie griff in eine große Kiste und gab mir einen kleinen rosafarbenen Handspiegel. Bewundernd betrachtete ich ihn, steckte ihn in meine Jackentasche und dachte an Schneewittchen. Sicher war es der Zauberspiegel der bösen Königin.
Wir gingen weiter. Vor uns hatten sich viele Menschen im Kreis versammelt. Uns packte die Neugier und wir kämpften uns durch das Menschengewühl.
Dann sah ich sie, die weißen Pferde mit den aufgeblähten Nüstern, so, als wären sie im Galopp eingefroren. Sie warfen ihre Vorderläufe mit den schwarzen Hufen in die Luft, ich hörte ihr Schnaufen und fühlte ihren Drang, frei sein zu wollen. Davon zu galoppieren, weit in die Ferne. Aber sie waren gefangen. Gefangen in einem nostalgischen Karussell. Sie drehten sich im Kreis und schauten mich immer und immer wieder mit ihren großen schwarzen Augen an.
Ein Pferd hatte besonders funkelnde Augen und im Zaumzeug glitzerten kleine silberne Sterne. Bei jeder Umdrehung tauschten wir einen vielsagenden Blick. Ich murmelte bewundernd, voller Zuneigung ganz leise vor mich hin:
„Oh, wie schön Du bist!“
In diesem Moment gab es keinen Platz mehr für ein anderes Gefühl in mir.
Und wieder hörte ich:
„Hereinspaziert, hereinspaziert! Fahren Sie mit!“
Ich schaute meinen Vater an. Offenbar war es der richtige Blick, denn ohne ein Wort zu sagen, kaufte er einen Fahrschein an der kleinen grell erleuchteten Verkaufsbude vor dem Karussell. Wir warteten, bis das Karussell zum Halten kam. Ein älterer Mann mit einem großen schwarzen Bart und einer dicken Brille nickte mir zu. Ich ging mehrere Stufen hinauf und setzte mich auf das Pferd mit dem glitzernden Zaumzeug. Das Pferd trug einen goldenen Sattel. Ich nahm die ledernen Zügel in die Hand. Die Fahrt begann und das Pferd hob und senkte sich anmutig in gleichbleibendem Rhythmus. Im Hintergrund spielte Musik. Sie klang für mich wie eine übergroße, laute Spieluhr. Die vielen bunten Lichter blinkten mir entgegen. Zeit und Raum entschwanden, auch das Gesicht meines Vaters in der Menge. Die Menschen, die Buden, alles glitt vorbei. Ich sah auf die große wilde Mähne vor mir und fing an zu träumen. Wäre es jetzt lebendig – was würde passieren? Könnten wir davon reiten vor den Augen der Zuschauer? Erst die Stimme meines Vaters brachte mich in die Realität zurück. Das Karussell hatte längst angehalten, ohne dass ich es gemerkt hatte. Allzu tief war ich in meinen Träumen versunken. Ich stieg ab, streichelte es zart und hatte großes Mitleid mit ihm. Wie gern hätte ich es mitgenommen und ihm die Freiheit geschenkt.
Die goldene Hochzeit
Sie überschwemmen mich, die Erinnerungen mit einer Woge an Aufregungen, Gerüchen und Emotionen. Die goldene Hochzeit meiner Großeltern war ein großes Ereignis und Erlebnis für mich. Die Feier fand gegen Ende der Sechzigerjahre statt. Ich war zu dieser Zeit zehn Jahre alt.
An einem Samstagnachmittag im Sommer stand ich aufgeregt inmitten einer Schar festlich gekleideter Menschen. Unsere Nachbarn, die Familie und Freunde meiner Eltern und Großeltern waren gekommen. Sie wippten und scharrten ungeduldig mit den Füßen, unterhielten sich leise, murmelten… wie schön es doch sei… und schauten mit neugierigen Augen auf die lange, weiß gedeckte Tafel und auf das Büffet.
Auf der anderen Seite baute sich ein Orchester auf. Die Musiker rückten sich die bereitgestellten Stühle in Position, packten ihre Instrumente aus und organisierten sich. Die Sonne schien mit all ihrer Kraft vom Himmel und brachte die Musiker in ihren schwarzen Anzügen und weißen Hemden ins Schwitzen. Sie sahen alle gleich aus, nur ihre Krawatten hatten unterschiedliche Farben und Muster. Mittendrin in diesem Geschehen waren meine Großeltern, beide von ansehnlicher Statur. Mein Großvater strahlte trotz der bevorstehenden Feierlichkeiten etwas Beruhigendes aus. So, wie er das fast immer tat. Beide saßen mittlerweile stolz und aufrecht nebeneinander auf ihren Stühlen an der Tafel und waren voller Erwartung. Meine Großmutter trug eine Perlenkette um ihren Hals und ein dunkelblaues Kleid. Ihre weißen Haare waren kunstvoll frisiert. Großvater mit seinem dunklen Anzug und Krawatte sah ich zum ersten Mal so festlich angezogen.
Die Gäste nahmen an der langen Tafel Platz und unterhielten sich fröhlich. Das Orchester stimmte sich ein und der Dirigent erhob den Taktstock. Plötzlich war es totenstill. Man hätte eine Stecknadel zu Boden fallen hören können. Dann ertönten die Trompeten, die Querflöten, die Tuben und Trommeln. Sie spielten voller Inbrunst und die Menschenmenge lauschte ihnen bewundernd zu. Der Applaus war ihnen sicher, ebenso das dankbare Lächeln meiner Oma und das wohlwollende Nicken meines Opas.
Es folgten die beiden Männergesangsvereine, „Harmonie“ und „Liedertafel“, mit den nächsten Darbietungen. Zwei Dutzend Kehlen sangen euphorisch, fast rauschhaft ihre Lieder.
All das fand unter freiem Himmel in unserem Bauhof zwischen Bauplatten, Steinen und Zementsäcken statt.
Ich war beeindruckt. Gestern noch war der Gabelstapler über den Hof des elterlichen Baustoffhandels gesaust, die LKW beladen worden, der Boden voller Staub und Schmutz, es war laut und hektisch gewesen. Und nun dieses Fest! Der Boden war besenrein und aufgeräumt. Papierschleifen zierten die Tore.
Auch ich hatte nicht, wie sonst üblich, meine über alles geliebten roten Lederhosen an. Nein, ich trug an diesem Tag ein hellgelbes Strickkleid mit weißen Rändern und hatte weiße Socken und Sandalen an. Meine wilden langen Zöpfe waren ordentlich geflochten und zwei Haarspangen hielten die Zopfenden fest. So ganz wohl fühlte ich mich nicht darin. Sonst war ich meist barfüßig unterwegs und liebte es, keine Rücksicht auf meine Kleidung nehmen zu müssen.
„Heute ist ein besonderer Tag“, hatte ich vor mich hingemurmelt, als ich mich im großen Spiegel im Schlafzimmer meiner Eltern am Morgen angeschaut hatte. Unbeobachtet hatte ich noch einige Grimassen gezogen. Ich gefiel mir in diesem Moment – auch mit Schuhen! Berührt vom Geschehen lief ich zwischen den vielen Menschen umher und schaute mich neugierig um. Es wimmelte nur so von Gratulanten. Ich schlängelte mich durch die Gäste hindurch bis ich am Bürgersteig angelangt war. Hier war Platz und nun überblickte ich alles. Der örtliche Metzger, ein dicker, gemütlicher Mann mit Zigarre, kam mit dem Auto angefahren und lud Töpfe aus. Sein Gesicht war rot und er hatte es eilig. Er ließ sein Auto direkt vor mir stehen und bahnte sich einen Weg durch die Menschenmasse.
Wie ich den Gesprächen entnahm, organisierte meine Tante, eine sehr resolute, umtriebige Frohnatur das Fest. Sie war in der Familie der Garant für gelungene Überraschungen und stimmungsvolle Feiern. Ich mochte ihren warmen, offenen Blick und ihre Art, wie sie mich wahrnahm. Sie wohnte mit ihrer Familie im Elternhaus meiner Großeltern in der Ortsmitte und war die ältere der beiden Schwestern meines Vaters. Oft besuchte ich sie dort mit meinem Vater. An Ostern und Weihnachten hatte sie stets eine Kleinigkeit an Schokolade für mich und auch Geschenke.
Zielstrebig und locker wirbelte sie von hier nach da…
Weitere Familienmitglieder, Angestellte und Arbeiter unseres Betriebes halfen tatkräftig mit. Sie begrüßten die Gäste und boten kalte Getränke an. Es war ein wildes Durcheinander, aber alle lächelten, strahlten und gingen freudig miteinander um.
Im Keller der Lagerhalle, welches als Warenlager für Schrauben und Nägel diente, standen riesige Bütten gefüllt mit Stangeneis, um die vielen Getränke zu kühlen.
Ich ging hinunter, nahm mir einige Eisstücke, um meine Arme zu kühlen und schaute mich dabei um. Hier durfte ich sonst nicht hinein. Zu gefährlich sei es hier für mich.
„Das ist kein Spielplatz“, ermahnte mich mein Vater in regelmäßigen Abständen.
Aber ich hielt mich nicht daran. Ab und zu schlich ich mich trotzdem mit einer Freundin in den Keller. Es gruselte uns jedes Mal, aber vielleicht war dort ein Schatz versteckt? Lange hielten wir es nie dort aus.
Die Gästeliste war lang - mein geselliger Großvater war Mitglied in einigen örtlichen Vereinen. Viele Ortsansässige kamen der Einladung meiner Tante nur allzu gerne nach. Weiterhin betrieb er bis zur Rente ein florierendes Maler- und Tünchergeschäft mitten im Ort. Auch dadurch erhöhte sich die Anzahl der Gratulanten sichtlich. Die gedeckte Tafel stand in der Lagerhalle und war unendlich lang. Die vielen Festgäste unterhielten sich lebhaft bei Bier, Wein, Sekt und allerhand Leckereien. Für uns Kinder gab es Malzbier. Für mich war es ein nicht alltäglicher Genuss. Am Büffet mussten die Gäste zeitweise lange warten, weil sich so viele angestellt hatten. Der Duft von knusprigem Rollbraten, Spießbraten und Grillwürsten machte Hunger. Es war wie auf einem Volksfest: Laut, rauschend, lachend. Die Sonne schien durch die Lichtplatten im Dach und zauberte eine entspannte, romantische, spätsommerliche Atmosphäre. Die bunten Stoffbänder verzierten das rustikale Ambiente und wehten im Wind hin und her.
Wie viele Festgäste es wohl waren? 100? Oder 200? Oder sogar noch mehr? Es waren unendlich viele glückliche Menschen, die kamen und gingen.
Es wurde gelacht, gesungen und auf das Hochzeitspaar wurden Reden gehalten. Hände wurden geschüttelt, Küsse ausgetauscht, Umarmungen nahmen kein Ende. Manche Gäste gratulierten so, dass ich wahrnehmen konnte, wie sehr sie meine Großeltern schätzten und respektierten. Ständig wurden Präsente mittels Boten abgegeben und Blumengestecke angeliefert.
Meine Großeltern genossen das Geschehen in vollen Zügen und fühlten sich sichtlich wohl.
Mir fielen insbesondere die unzähligen Fresskörbe auf: Flechtkörbe mit Henkel, bunt verziert und gefüllt mit allerhand Delikatessen. Wein, Sekt, Pralinen, Dosenwurst, Schokolade sowie frisches Obst konnte ich mit meinen neugierigen Blicken entdecken.
Da meine Großeltern, wie auch meine Familie, direkt auf dem Bauhof wohnten, konnten sie sich zwischendurch eine kleine Pause gönnen. In ihrer Wohnung war kaum noch Platz. Überall standen die Präsente auf den Tischen und auch auf dem Boden. Teilweise noch verpackt mit wunderschönen großen Schleifen. Auf dem Schreibtisch im Wohnzimmer sah ich viele Umschläge mit Glückwunschkarten liegen.
Ich wurde bei diesem Trubel mir selbst überlassen. Das gefiel mir sehr, denn so konnte ich das Treiben ungestört beobachten. Nach einer ausgedehnten Runde über den „Festplatz“ ließ ich mich auf den Stuhl zwischen meinen Eltern fallen und verweilte dort einige Minuten. Es war immer noch warm und ich pustete mir eine blonde Strähne aus der Stirn. Genüsslich trank ich noch ein weiteres Malzbier aus der Flasche. Meine Mutter sah mich völlig überrascht an - mahnte mich mit einem scharfen Blick. Ich trank fast immer aus der Flasche – das aber sonst nur Zuhause! Ich ignorierte ihren Blick und machte mich auf die Suche nach bekannten Gesichtern.
Die ganze Verwandtschaft war gekommen, um mitzufeiern. Ich freute mich, sie wiederzusehen. Im Laufe des Nachmittags war ich bei jedem einzelnen von ihnen. Jeder meiner nahen Verwandten hatte für mich einen eigenen Geruch. Er gehörte zu ihnen wie ihr Lächeln oder ihre Art, mir bei jedem Zusammentreffen immer wieder die gleichen Fragen zu stellen.
„Was macht denn die Schule? Lernst Du auch fleißig?“ Auch erschienen sie mir in unterschiedlichen Farben. Manche waren grau und langweilig. Andere wirkten kunterbunt und quirlig.
Zu den Letzteren gehörten meine älteren Cousinen und meine Cousins väterlicherseits. Ich freute mich so sehr, sie zu sehen. Mit ihnen war es immer lustig. Sie waren immer gut gelaunt und nahmen sich Zeit für mich. Auch heute. Ach, und da war noch Peggy. Ein mittelgroßer, zotteliger Hund mit dunklem, gelocktem Fell. Er ging stets eigene Wege, ohne Leine und wohin er wollte. So auch an diesem Tag.
Alle meine Verwandten begrüßten mich auf die gleiche Weise: Sie umarmten mich, küssten mich auf die Wangen, und streichelten mir über das Haar. Mir gefiel das.
Weitere Spielkameraden fanden sich unter den Festgästen. Es waren Kinder aus der Nachbarschaft, mit denen ich gemeinsam meine Runden drehte. Zwischendurch setzten wir uns auf einen Stapel Zementsäcke. Sie waren von der Sonne angewärmt, ziemlich hoch aufgetürmt. Von hieraus hatten wir einen guten Blick. Danach zeigte ich ihnen meine Verstecke auf dem Bauhof. Es waren gut behütete Geheimnisse, da das Spielen auch im Lager verboten war.
Die Stunden vergingen. Es begann zu dämmern. Glücklicherweise war die Halle hell erleuchtet und die Feier ging weiter. Das Fassbier schmeckte den Gästen weiterhin. Das Büffet wurde mit einer Käseauswahl ergänzt. In der Mitte stand ein großer Topf mit Spundekäs. In einem Korb lagen frische, knusprige Brezel und Brotscheiben.
Die Kinder aus der Nachbarschaft waren mittlerweile gegangen. Was nun? Ich blickte mich um. Auf den Tischen standen zwischen den leeren Bierkrügen die Schnapsflaschen. Die Aschenbecher waren voll mit Zigarettenstummeln. Ich nahm sie mit gebührendem Abstand, leerte sie in der Mülltonne aus und freute mich, dass einige Gäste mich dafür lobten.
Unterbrochen von kurzen Pausen, wenn eine Rede gehalten wurde, spielte das Orchester. Die Gäste unterhielten sich immer lauter, waren lustiger und ausgelassener. Die Krawatten der männlichen Gäste hingen längst über dem Stuhl. Die Hemdkragen standen weit offen und viele Gäste hatten wohl einen Schwips. Manche starrten mich mit glasigen Augen an und lachten ununterbrochen.
Seltsam – diese Erwachsenen, dachte ich für mich.
Dann wurde mir langweilig und müde war ich auch. Zeit für mich, schlafen zu gehen. Meine Mutter beobachtete mich schon eine Weile aus der Ferne, nahm mich verständnisvoll an die Hand und brachte mich ins Bett.
Weit noch strahlte das Licht hinaus in die Dunkelheit. Der Wind trug die Stimmen davon, die Musik und das Gelächter. Das Treiben ging bis spät in die Nacht. Nie wieder wurde innerhalb der Familie ein so großes wunderbares Fest gefeiert.
Du musst das Leben nicht verstehen.
Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass Dir jeden Tag geschehen
so wie ein Kind im Weitergehen.
Von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.





























