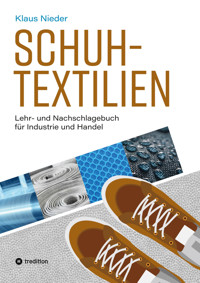
45,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Durch die rasche Entwicklung der Materialien zur Herstellung von Schuhen, weg vom Leder, hin zu Textil und Kunststoff, wurde die Abfassung eines Lehr- und Nachschlagebuchs für den Einsatz von Schuhtextilien notwendig, welches sich mit den unterschiedlichen Facetten der Herstellung, Konstruktion, Veredlung und Anwendung von Schuhtextilien befasst: • Gesamte Prozesskette zur Herstellung und Verwendung der Schuhtextilien auf dem aktuellen Stand der Technik • Textile Kette von der Fasererzeugung über die Garnherstellung, textile Flächen, Textilveredlung und Vertrieb • Beispiele textiler Erzeugnisse und ihrer Anwendung • Entwicklung von Smart- und Funktionstextilien, wie u. a. Membrantechnologie, PCM-Materialien, effektive Hydrophobierung (Lotus Effekt), neue maßgeschneiderte Fasern und antibakterielle Ausrüstungen • Weltweite Vernetzung, Handel, Märkte • Ökologische Aspekte und Recycling Abweichend von üblichen Lehrbüchern werden viele Aspekte auch im Lichte der historischen Entwicklung betrachtet, sodass sich das Lesen nicht nur für die Fachwelt, sondern ebenso für den interessierten Laien und Verbraucher lohnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
© 2023 Klaus Nieder
An diesem Buch haben insbesondere mitgewirkt
Erweitertes Lektorat, Satz, Layout und E-Book-Gestaltung:Christina Berghold, Göttingen (https://www.lektorat-berghold.de)
Index:Walter Greulich, Birkenau (https://publishing-and-more.de)
Umschlaggestaltung und Internetseite:Sonja Fischpera, Pforzheim (https://www.grafik-fuers-volk.de)
Coverbilder: Voinau Pavel/shutterstock.com
tcareob72/shutterstock.com
Humannet/shutterstock.com
yanin kongurai/shutterstock.com
vchal/shutterstock.com
Texturemaster/shutterstock.com
Anmerkung zum Urheberrecht der Bilder und Tabellen
Leider war es nicht in allen Fällen möglich, die Rechteinhaber zu ermitteln. Bitte melden Sie sich über [email protected], sofern Ihnen Urheberrechte an einem Text oder Bild zustehen.
Alle Rechte vorbehalten
Das vorliegende Werk ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ohne seine Zustimmung ist unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors durch die tredition GmbH, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
ISBN Softcover: 978-3-347-54831-2
ISBN Hardcover: 978-3-347-54834-3
ISBN E-Book: 978-3-347-54842-8
Gleichbehandlung ist mir wichtig. Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit habe ich in diesem Buch dennoch ausschließlich die männliche Form gewählt, was keinesfalls eine Benachteiligung anderer Geschlechter impliziert. Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für alle.
Dieses Buch ist all den wissbegierigen und engagierten Studenten gewidmet, die mich während meines Berufslebens jeden Tag aufs Neue inspiriert und motiviert haben.
Warum ein Buch über Schuhtextilien?
Zahlreiche wissenschaftliche Literatur wurde über Textilien im Allgemeinen sowie über deren produktionstechnische, wirtschaftliche und geschichtliche Hintergründe verfasst. Auch über Textilien für Oberbekleidung lassen sich verschiedene Veröffentlichungen finden. Aktuelle wissenschaftliche Bücher oder zumindest Zeitschriftenartikel über Schuhe, Schuhfertigung und vor allem Textilien als Schuhmaterial sucht man jedoch oft vergebens. Speziell über Schuhtextilien ist die ohnehin magere Auswahl dann häufig nur mit längst überholtem Informationsgehalt zu bekommen.
Durch die rasche Entwicklung der Materialien zur Herstellung von Schuhen – weg vom Leder und hin zum Textil – wurde die Abfassung eines Lehr- und Nachschlagewerks für den Einsatz von Schuhtextilien jedoch notwendig und genau hier setzt meine Idee zu diesem Buch an: einem Fachbuch, welches sich mit den unterschiedlichen Facetten der Herstellung, Konstruktion, Veredlung und Anwendung von Schuhtextilien befasst. Das klassische und bekannte, genutzte und möglicherweise geeignete textile Stoffe für Schuhe vorstellt, auf ihren Einsatz beziehungsweise ihre Einsatzmöglichkeiten im Hinblick auf die Herstellung von Schuhen eingeht und ausführliche Hintergrundinformationen gibt. Auch die neuen Entwicklungen in Richtung Funktionstextilien, wie unter anderem Membrantechnologie, Phase Change Materials, Hydrophobierung (Lotuseffekt), neue maßgeschneiderte Fasern und antibakterielle Ausrüstungen, werden behandelt.
Das Buch soll zum einen als Lehrbuch für Studierende der Schuhtechnik in Ingenieur- und Fachschulen im Bereich Produktentwicklung und Design dienen und Textilien und Grundlagen aufzeigen. Zum anderen soll es den vielen Praktikern in den Betrieben und im Handel als Handreichung und Nachschlagewerk dienen. Es fußt auf den wissenschaftlichen Errungenschaften, Forschungen und Veröffentlichungen der Textiltechnik und Textilwirtschaft und stellt somit den aktuellen Stand der Forschung dar. Ausgehend von einem großen Fundament an Literatur und Quellen werden offene und neue, auch kritische Fragen mithilfe eigener Ideen beantwortet. Abweichend von üblichen Lehrbüchern sind viele Aspekte zusätzlich im Lichte der historischen Entwicklung betrachtet, sodass nicht nur die Fachwelt, sondern ebenso der interessierte Laie Lust aufs Weiterlesen bekommt. Links und Verweise zu einer Vielzahl von Quellen und Herstellern laden zu ergänzendem Studium ein.
Für Korrekturarbeiten und wichtige fachliche Hinweise danke ich Herrn Oberstudienrat Manfred Ruf, Herrn Dr. Wilfried Kolling und Herrn Franz Eckert. Weiterhin habe ich den Farbenfabriken, chemischen Fabriken und Maschinenfabriken für die Überlassung entsprechender Unterlagen zu danken. Nicht zuletzt gilt mein Dank den vielen Studentengenerationen, die mit Diplom-, Bachelor- und Projektarbeiten das Fundament für dieses Buch gelegt haben. Stellvertretend seien hier Frau Karin Vereet und Karoline Agne genannt.
Und danke Frau Berghold! Für die professionelle Zusammenarbeit beim Lektorat, für zielgerichtete Formulierungen und die wunderbare Eigenschaft, einen schlecht verständlichen Abschnitt neu zu gliedern, für die schnelle Einarbeitung in die naturwissenschaftliche Thematik und die vielen telefonischen Fachgespräche. Gerne empfehle ich Ihre professionelle Arbeit weiter.
Bexbach, im Mai 2023
Prof. Klaus Nieder
Inhaltlicher Aufbau
In Kapitel 1 werden zum Zwecke eines generellen Überblicks und Verständnisses allgemeine und physiologische Anforderungen an Schuhtextilien und Dessins erläutert Diese beeinflussen maßgeblich die Gestalt, Konstruktion und Fertigung des Schuhwerks und der verwendeten Materialien. Sie bilden somit die Grundlage für die Erforschung und Entwicklung, die Verarbeitung und den Gebrauchswert bestimmter Textilien im Schuhbereich. Dem folgen in Kapitel 2 historische Fakten zur Entstehung und Entwicklung der Schuh- und Textilherstellung. Es wird beleuchtet, welche wichtigen Schritte und Innovationen vollzogen wurden, um geeignete Materialien und Fertigware zu verwenden. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der textilen Kette von der Fasererzeugung bis zum fertigen Kleidungsstück. Auch die Entsorgung und die Auswirkungen auf die Umwelt finden sich wieder. Die textilen Rohstoffe beschreibt Kapitel 4 ausführlich. Dabei stehen hier nicht nur die Fasergewinnung, sondern auch die Fasereigenschaften und Faserprüfungen im Blickpunkt. Kapitel 5 thematisiert Fäden, Garne und Zwirne. Neben den Feinheitsbezeichnungen bilden hier die Herstellung und Nomenklatur einen Schwerpunkt. Die Herstellung und Eigenschaften der textilen Flächen wie Gewebe, Maschenware und Vliesstoffe sind in Kapitel 6 beschrieben.
Textile Flächen in der Schuhindustrie finden sich in Kapitel 7. Das Textilkennzeichnungsgesetz und die Schuhkennzeichnung runden die Darstellung ab. Die Textilveredlung in Kapitel 8 umfasst zahlreiche außerordentlich komplexe Technologien und Methoden und ist in ihrer Gesamtheit daher kaum fassbar. Zumindest würde eine derartige Herangehensweise den Rahmen dieser Arbeit deutlich sprengen, sodass lediglich auf die für Schuhtextilien wichtigsten Verfahren eingegangen wird. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Textilbeschichtung und Kaschierung, da Textilien für Schuhe oft beschichtet oder kaschiert ihre Anwendung finden. Kapitel 9 geht noch einmal detailliert auf die umweltkritischen Aspekte der Textilherstellung ein und zeigt Möglichkeiten zur Verminderung des ökologischen Fußabdrucks – insbesondere durch den sparsamen Einsatz von Ressourcen und durch Recycling. Schließlich folgt ein Fazit mit Ausblick, in dem wesentliche Erkenntnisse und eine kurze Einschätzung der zukünftigen Entwicklung resümiert sind.
Nachfolgeband
Der vorliegende erste Band beschäftigt sich ausführlich mit allen Aspekten der Schuhtextilien. Ein weiterer Band wird sich mit Schadstoffen und Materialprüfungen befassen, denn mit der zunehmenden Labelflut und Reglementierung wie zum Beispiel durch REACH, ÖKOTEX, BLUESIGN, DETOX und andere ist es für den Schuhhersteller kaum noch möglich, hier up to date zu sein. Es wird die gesamte Lieferkette von der Faserherstellung bis zum fertigen Textil betrachtet und Schuhhersteller erhalten wertvolle Tipps, wie sie das Schadstoffmanagement innerhalb der Betriebe effektiv händeln können. Auch nehmen technologische Prüfungen, Echtheiten und die dazugehörigen Normen einen breiten Raum ein.
Einleitung
Im Jahr 2014 wurden weltweit ca. 24,3 Milliarden Paar Schuhe hergestellt: Lediglich 21 Prozent davon waren Lederschuhe.1
Im Zusammenhang mit Trends und Lifestyleerscheinungen wie Ecomode, Vegetarismus oder Veganismus sowie aufgrund der Diskussion um Schadstoffbelastungen im Leder zeichnet sich auch im Schuhbereich eine Bewusstseins- und demnach Nachfrageveränderung ab: weg von Leder- und Echtpelzprodukten, hin zu alternativen Materialien. Dieser Trend hat sich in den vergangenen Jahren weiter fortgesetzt.
Seit 2019 erlebt die Schuhindustrie weltweit eine Verlangsamung des Produktionswachstums: Die Branche schrumpft.
Die Schuhproduktion und die Exporte waren 2019 nur noch um 0,6 beziehungsweise 0,1 Prozent gestiegen.2 Diese Verlangsamung setzte sich angesichts von Covid-19 fort, inzwischen spricht man von einem Produktionsrückgang von bis zu 30 Prozent.
Die geografische Verteilung der Schuhproduktion war von Veränderungen bislang nicht betroffen: Der Hauptproduzent bleibt Asien (→ Abb. 1).
Dort werden fast neun von zehn Paar Schuhen hergestellt.3 Oft passt hier der Ausspruch: „In Deutschland gedacht, in Asien gemacht.“
Abb. 1: Weltjahresproduktion und Top 10 Footwear Consumers 20204
Durch diese Entwicklungen hat sich besonders im Bereich der gestalterischen Planung und Realisierung in der Schuhproduktion ebenfalls vieles verändert. Für die Designer, Ingenieure und Produktentwickler ist es unabdingbar, sich mit der Beschaffenheit, den Eigenschaften und der Herstellung auch neuer und innovativer Schuhmaterialien auseinanderzusetzen. Die immer schnellere Nachfrage nach immer komfortableren, exklusiveren, aber auch individuelleren Produkten lässt die Ansprüche an Design, Modellierung und Fabrikation steigen. Hersteller und Fachkräfte müssen vermehrt innovativere und auch modischere Materialien ausarbeiten und zum Einsatz bringen, um den Verbraucherwünschen und der Mode gerecht zu werden und um auf dem sich tendenziell verkleinernden und durch asiatische Produzenten bestimmten Markt bestehen zu können.
Die Verarbeitung von Textilien drängt sich hier aufgrund der enormen textilen Vielfalt geradezu auf. So ist es mittlerweile üblich, dass Stoffarten wie Bouclé, Cord, Loop, Spitze, Stretch, Velvet, selbst Brokat oder bestickte Stoffe, die ursprünglich vor allem für Bekleidung und Heimtextilien benutzt wurden, als Schaftmaterialien von Abend-, aber auch von Freizeit- und Straßenschuhen verwendet werden. Es ist und bleibt dennoch wichtig, sich neben der Erforschung und Entwicklung neuartiger Produkte weiterhin mit Klassikern und Altbewährtem zu beschäftigen – mit dem Ziel, Textilien wiederzuentdecken, innovativ einzusetzen oder derart zu bearbeiten beziehungsweise auszurüsten, dass sich ihr Einsatz für die moderne Schuhfertigung wieder eignet und lohnt.
Kapitel 1Allgemeine und physiologische Anforderungen an Schuhtextilien
Ein Produkt kann nur gut konzipiert und konstruiert werden, wenn man bestehende Anforderungen kennt und beachtet. Dieses Wissen ist vor allem dann essentiell, wenn es sich um Artikel handelt, die direkt vom oder am Menschen verwendet werden. Im Folgenden sind daher die wichtigsten Aufgaben der Fußbekleidung sowie entsprechende optisch und haptisch bedingte Voraussetzungen und Ansprüche an sie beschrieben. Die Anforderungskriterien sind mit Blick darauf ausgewählt, dass die Mehrheit der Schuhtextilien, sei es Obermaterial, Futter- oder Schaftmaterial, in ihrer Anwendung evolutions- wie auch funktionsbedingt den menschlichen Bedürfnissen nach Schutz, Kultur und Mode unterliegen.
1.1 Aufgaben der Fußbekleidung
In der Produktentwicklung unterscheidet man drei Bezugsebenen zwischen Produkt und Mensch: die Benutzerebene, die Betrachterebene und die Besitzerebene. Die Benutzerebene bezieht sich auf die körperlichen Aspekte des Produkts, die Betrachterebene auf die sinnlichen und die Besitzerebene auf die gesellschaftlichen. Von diesen Bezugsebenen lassen sich drei Grundfunktionsbereiche eines Produkts ableiten: praktische (körperlich erfahrbar), ästhetische (sinnlich erfahrbar) und symbolische (gesellschaftlich erfahrbar). Im wirtschaftlichen und technischen Sprachgebrauch sind diese Dimensionen unter den Begriffen Gebrauchs- und Geltungsnutzen erfasst.5
Gute Fußbekleidung muss dementsprechend zwei Hauptaufgaben gerecht werden, nämlich einen Gebrauchsnutzen und einen Geltungsnutzen zu schaffen. Der Gebrauchsnutzen, oft auch Grundnutzen genannt, bezieht sich auf die übergeordnete Funktion des Schuhwerks. Gemeint sind praktische Eigenschaften wie Sicherheit und Schutz, Brauchbarkeit, Haltbarkeit, Pflegbarkeit, ergonomische Funktionen, Handhabung beziehungsweise Beherrschbarkeit, Tragekomfort und weitere. Sie werden auch als Nützlichkeitsansprüche bezeichnet.6 Die ergonomischen Funktionen sowie der Tragekomfort sind die wichtigsten Ziele der Schuhkonstruktion. Die wichtigsten Funktionen der Fußbekleidung sind dabei ihre Schutzfunktion sowie die Unterstützung der Thermoregulierung.7 Der Geltungsnutzen wird auch als Prestigenutzen bezeichnet. Er bezieht sich auf den Gewinn von Ansehen, den der Verbraucher sich erhofft oder tatsächlich erlangt, indem er ein Produkt erwirbt und nutzt – ist er ausnehmend hoch, spricht man vom Statussymbol. Der Geltungsnutzen setzt sich aus der ästhetischen Funktion und der sozialen, gesellschaftlichen Funktion zusammen. Dazu gehört somit das weite Feld der Mode: Bekleidung war und ist seit jeher Ausdruck der Persönlichkeit. Der Mensch bringt mit der Art und Weise, wie er sich kleidet, seine Erscheinung, seine Individualität, auch seine Kultur und seine Einstellungen und Wertevorstellungen zur Geltung. Gelegentlich wird Bekleidung gar wie eine Art Uniform getragen, um zu zeigen, welcher Personengruppe man sich zugehörig fühlt (zum Beispiel Springerstiefel in der Skinhead-Szene, klobige Boots bei Grunge-Fans). Ein Schuh kann ein Outfit und die Persönlichkeit des Trägers optisch ergänzen, unterstreichen, einen Look optimieren, sogar im positiven Sinne dominieren oder im Gegenteil auch verschlechtern.8
1.2 Bekleidungsphysiologische Anforderungen
Laut dem Lexikon für Textilveredelung ist Bekleidungsphysiologie „die Lehre über jene Vorgänge, die sich zwischen Körper und Bekleidung wechselseitig abspielen und sich in Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und Gesundheit des Trägers äußern“9. Die Bekleidungsphysiologie befasst sich also mit den Eigenschaften, die das Trageverhalten und den Tragekomfort ausmachen und auch als thermophysiologische, hautsensorische und ergonomische Komforteigenschaften bezeichnet werden. Als thermophysiologischer Komfort gilt die Fähigkeit der Textilien, die Feuchte- und Temperaturregelung des Körpers zu unterstützen. Hautsensorischer Komfort entsteht durch das Spüren der Materialien auf der Haut, der ergonomische Komfort bezieht sich auf die Passform der Modelle und entscheidet zusammen mit dem physiologischen Komfort darüber, wie wohl sich ein Mensch in seiner Kleidung fühlt und wie gut er sie akzeptiert. Die Richt- beziehungsweise Kenngrößen der Bekleidungsphysiologie sind Körper, Kleidung und Klima (3-K-System). Diese drei Faktoren bestehen weitgehend voneinander abhängig und bedingen sich gegenseitig. Sie müssen daher während der Produktplanung genau bedacht werden.
Thermophysiologischer Komfort
Die Grundelemente für die Bekleidung eines bestimmten Klimas sind in Bezug auf Schweißtransport, Wärmerückhaltevermögen und Luftaustausch zu definieren.10
Warum? Der Mensch erzeugt durch Stoffwechselvorgänge Energie. Als Nebenprodukt entsteht Wärme, die ausgeglichen und an die Umgebung abgeführt werden muss. Zu diesem Zweck verfügt der gesunde Organismus über ein physisches Regulierungssystem, das die Temperatur auch bei unterschiedlichen Lebensvorgängen und Umweltbedingungen beständig hält. Je nach körperlicher Arbeit entstehen unterschiedlich hohe Wärmemengen innerhalb des Körpers und je nach Umgebungstemperatur werden größere oder kleinere Wärmemengen nach außen abgeleitet (evaporative Wärmeabgabe).11 Die so entstehende physiologische Schwankungsbreite der Körpertemperatur eines gesunden Erwachsenen liegt etwa zwischen 36,4 und 37,4 °C. Seine Organe funktionieren optimal, wenn die Temperatur im Körperkern (Kopf-Rumpf-Bereich) konstant in diesem Bereich gehalten wird, und das ist der Fall, wenn die Wärmeabgabe in etwa der Wärmeproduktion gleichkommt.
Bei Hitze oder gesteigerter Muskeltätigkeit erhöht der menschliche Körper die Wärmeabgabe durch Schwitzen und vermehrte Durchblutung. Füße, Hände und Kopf haben dabei jeweils mehr Schweißdrüsen pro Quadratzentimeter als die anderen Körperpartien, was bedeutet, dass der Mensch dort besonders viel schwitzt. Die Wohlfühltemperatur am Fuß liegt bei ca. 30 °C. Bis zu einer Umgebungstemperatur von 25 °C erfolgt die Wärmeabgabe dort trocken, ab 25 °C trocken und feucht und ab 36 °C nur noch feucht: Die durchschnittliche Feuchtemenge, die die Hautporen am Fuß ausschwitzen, beträgt bei einem Erwachsenen 5–20 g/Std. und bis zu 200 g/Tag. Voraussetzung für eine Kühlwirkung durch Schwitzen ist nun, dass der Schweiß verdampfen kann und nicht als Flüssigkeit auf der Haut bleibt, auch wenn der Fuß in Socke und Schuh steckt.
Zentrale thermophysiologische Forderungen sind deshalb Feuchteregulierung durch Luftaustausch und Optimierung des Feuchtetransports von der Hautoberfläche zur Außenluft. Die Schweißflüssigkeit muss schnellstmöglich von der Hautpore zur Textilaußenseite geleitet werden. Ob die Schweißverdunstung funktioniert, hängt beim Schuh vor allem vom Feuchtetransportvermögen des Obermaterials ab. Der Grad des Feuchtetransports ist dabei physikalisch abhängig vom Dampfdruckgefälle beziehungsweise vom relativen Feuchtegefälle zwischen hautnaher Zone und Außenklima. Es wird zudem zwischen Transportvermögen für Wasserdampf und Transportvermögen für Schweißflüssigkeit unterschieden: Wasserdampf ist wesentlich leichter abzuleiten als Flüssigkeit. Ist das Feuchtetransportvermögen des Textils zu gering, wird durch kontinuierliche Stimulation der Schweißdrüsen übermäßig viel Schweiß erzeugt, der sich tropfenartig auf der Haut sammelt. Der thermoregulatorisch wichtige Prozess der Verdampfung ist behindert beziehungsweise erschwert und der Wärmegehalt des Körpers steigt. Es kommt zu einem Wärmestau, wodurch die physische Leistungsfähigkeit und das Wohlempfinden abnehmen. In extremsten Fällen kann es gar zu Kreislaufzusammenbrüchen kommen. Andererseits muss die Wärmeabgabe ab einer bestimmten Temperatur durch Atmung und zusätzlich durch Kleidung reduziert werden, damit der Mensch keine Erfrierungen erleidet oder, auf den gesamten Körper bezogen, sogar an Unterkühlung stirbt. Für die Fußhauttemperatur des Menschen liegt die Kälte-Schädigungsgrenze bei ca. 13 °C; sinkt die Fußhauttemperatur unter 10 °C, kommt es zu weiteren physischen Störungen und Schädigungen.12
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die thermoregulatorischen Eigenschaften die wichtigsten Funktionen zweckmäßiger Bekleidung sind. Die Wärmeisolation von Schuhen ist dabei nicht nur abhängig vom Schuhmodell und Schichtaufbau, sondern ganz entscheidend auch vom Material, etwa der Konstruktion des Textils. Es gilt zum Beispiel, dass besonders eine porig strukturierte Oberfläche mit abstehenden Fasern Luft einschließen und somit Wärme stauen kann. Dabei wirkt als eigentliche Wärmeisolation die eingeschlossene Luft (Adhäsionsluft) und nicht die Faser an sich, weshalb für kalte Jahreszeiten vor allem voluminöse, bauschige Textilien zum Einsatz kommen. Die zentrale Funktion der Feuchteregulierung stellt nach wie vor die größte Herausforderung und Schwierigkeit für die Entwicklung und Konstruktion zweckmäßiger Schaftmaterialien dar. Als besonders geeignet haben sich hier Fasern mit hohen Hydrophobierungseigenschaften erwiesen wie Polyester und Mischungen aus Polyamid sowie Mischungen aus Chemie- und Naturfasern. Allgemein gilt, dass die Hydrophobierungseigenschaften beziehungsweise die Feuchtetransportbedingungen sich mit der Größe der Querschnittsoberfläche (Profil), der Feinheit der eingesetzten Fasern (T: Titer; Einheit: tex), dem Volumen des Fadens infolge der Faserlänge, der Dehnung und Texturierung sowie der Größe der Oberfläche des textilen Erzeugnisses (Gestrick, Gewebe, Vliese oder andere) verbessern.13
Hautsensorischer und ergonomischer Komfort
Tragephysiologisch spielen auch hautsensorische Empfindungen, anatomische Gegebenheiten und kraftbezogene Veränderungen am Schuh eine Rolle. Unter Hautsensorik versteht man all die Empfindungen, die durch den direkten Kontakt des Textils mit der Haut entstehen. Diese sind wesentlich durch die Materialzusammensetzung, die Auflagefläche auf der Haut und die Tragesituation bedingt.
Generell wird ein Schuh während der Nutzung kaum rein statisch belastet, vielmehr sind die Belastungen am Material hauptsächlich schwellender und wechselwirkender Natur. Bereits bei der Schaftfertigung wird das Obermaterial insbesondere beim Formen über den Leisten flächenhaft überdehnt, Schuhverschlüsse werden vor allem auf Zug belastet. Derartige Anforderungen beeinflussen die Materialwahl und entscheiden darüber, inwieweit ein Textil zu verstärken ist. Neben der Auswahl funktionsgerechter Materialien ist es zudem wichtig, dass der Anatomie und Supination des Fußes genügend Bewegungsfreiheit verschafft wird (→ Abb. 2). Zu weiche Materialien sollten auch aus diesem Grund verstärkt werden.
Abb. 2: Pronation und Supination des Fußes14
Die spezifische Schuhmachart und ihre Funktion sind also in der Tätigkeit der Zielperson genau zu bedenken, um einen Schuh bekleidungsphysiologisch zu konstruieren oder zu bewerten. Die Funktionalität eines Schuhs ergibt sich aus allen Eigenschaften, beeinflusst durch die Faktoren Fasermaterial, Spinn-/Web- oder Maschenware, Dichte, Volumen, Gewicht, Färbung, Ausrüstung, Modell- und Konfektionstechnik.15
1.3 Anforderungen an Schuhmaterialien
Zwar beeinflussen die Machart und der Sohlentyp die Verarbeitungs- und Trageeigenschaften sowie das Erscheinungsbild eines Schuhs stark, doch spielen auch die verarbeiteten Materialien eine entscheidende Rolle. Dabei ist grundsätzlich davon auszugehen, dass für die verschiedenen Schuhtypen verschiedene textile Flächen geeignet sind und dass an diese beim Tragen und bei der Herstellung unterschiedliche Anforderungen gestellt werden.
Viele wichtige Anforderungen an die Eigenschaften von Schuhmaterialien sind in Deutschland in DIN-Vorschriften und in internationalen Normen (EU, ISO) festgehalten. Die Materialien werden dementsprechend gewissen Werkstoffprüfungen unterzogen. Die bedeutendsten Prüfungen untersuchen Festigkeitseigenschaften wie Zugfestigkeit, Scheuerfestigkeit und Nahtfestigkeit sowie das Verhalten bei Dauerfaltung. Sehr wichtig insbesondere bei Schuhen sind auch Prüfungen zur gerade beschriebenen Klimaregulation (Wärmerückhaltevermögen, Schweißtransport, Luftaustausch) und solche zur Farbechtheit. Diese Eigenschaftsprüfungen dienen der Vereinheitlichung, dem besseren Vergleich, der Reproduzierbarkeit sowie der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung. Sie gewährleisten insbesondere die reibungslose Weiterverarbeitung, die Sicherheit des Trägers, den Geltungswert des Endprodukts und die reklamationsfreie Nutzung.
Als Ober- und Futterstoffe werden vor allem Materialien auf Gewebebasis, auf Vliesbasis oder auf Vliesbasis mit wasserdampfdurchlässiger Ausrüstung und Laminate aus Textil oder Textil mit Membranen eingesetzt. Sie müssen genügend Festigkeit besitzen oder zusätzlich kaschiert sein. Sie sollten ausreichend dehnfähig sein, aber gleichzeitig zugfest genug, um dem Ausbeulen entgegenzuwirken. Futterstoffe müssen gute Farb- und Scheuerfestigkeiten aufweisen, da sie den Reib- und Druckkräften, die die Supination und die Gehbewegungen des Fußes direkt am textilen Material verursachen, am meisten ausgeliefert sind. Bei Fellimitationen ist eine gute Haarfestigkeit Voraussetzung.
Schnürsenkel müssen extrem scheuerfest sein, da sie beim Tragen und Schnüren kontinuierlich Reibkräften ausgesetzt sind. Sie werden deshalb auf Scheuerfestigkeit bis zur Lochbildung getestet und sollten 5000 und für Spezialschuhwerk 15.000 und mehr Scheuertouren überstehen. Garne müssen insbesondere dehnungsbezogen gute Festigkeitseigenschaften vorweisen, da sie nur so problemlos zu vernähen sind. Der Wert der Bruchdehnung (Dehnung bis zum Fadenbruch) sollte nicht mehr als 20 Prozent betragen. Trotzdem müssen Garne auch über eine gewisse Elastizität verfügen, damit sie der Dehnung während der Schlingenbildung beim Vernähen standhalten und zudem möglichst wenig Garn verbraucht wird. Als sehr widerstandsfähig gelten synthetische Garne, wobei Polyestergarne besonders gute Werte erbringen.
1.4 Mode, Trend und Zeitgeist
Der Begriff Mode geht auf den französischen Ausdruck „à la mode“ zurück, wobei „la mode“ vom lateinischen Wort „modus“ abstammt; beide bedeuten Maß, Art, Gemessenes beziehungsweise Erfasstes.16 In früheren Jahrhunderten ist Mode nur einzelnen Gesellschaftsschichten vorbehalten gewesen: Vor der Zeit der französischen Revolution haben Königshäuser und Adlige bestimmt, was zu tragen sei. Nur ihnen ist es möglich gewesen, sich schicke Kleidung aus edlen Materialien fertigen zu lassen. Erst die Abschaffung der Monarchie und somit der fremdbestimmten Kleiderordnung führte dazu, dass sich die gemeine Bevölkerung „à la mode“ kleiden konnte und durfte.
Unter Mode versteht man Regeln, Sitten, Bräuche und Gewohnheiten, die über eine gewisse Zeitspanne hinweg gelten, sowie etwas zu tun, anzuziehen oder zu kaufen, das sich mit den Bedürfnissen der Menschen im Verlauf der Zeit wandelt. Moden finden als Momentaufnahmen eines Prozesses beständigen Fortschritts statt und stellen somit in der Regel ein Abbild des momentanen Zeitgeistes dar. Länger anhaltende Äußerungen des Zeitgeistes, die mehrere Modewellen überdauern, bezeichnet man als Klassiker. Vielen Definitionen zufolge zeichnet sich Mode durch schnellen Wandel und das Verlangen nach Abwechslung aus. Sie ist eine kontinuierliche Evolution menschlicher Ideen. Das produzierende Gewerbe, Kreative und Konsumenten wollen oder müssen der Mode folgen, womit sie wiederum gleichzeitig die Verbreitung modischer Tendenzen vorantreiben. Gewichtige Impulse gehen dabei von Modemetropolen wie Paris, Mailand, New York, London, Kopenhagen und den dort ansässigen Designern und Berühmtheiten aus. Einen großen Einfluss haben heute auch der Street Style und Modeblogger. Die Vorwürfe eines „Mode-Diktates“ und eines Kaufverhaltens, das sich nur noch danach richtet, treffen allerdings nicht zu.17 In den letzten Jahren wurde der übertriebene Modewahnsinn vor allem von Naturschutzverbänden angeprangert. Durch den zweimaligen Modewechsel im Jahr werden Unmengen an Textilien produziert und auch weggeworfen, viele sind nur wenige Male getragen. So kaufen sich die Deutschen jährlich im Schnitt rund 4 Paar Schuhe (Frauen 6 Paar, Männer nur 2 Paar).18 Auf die immense Umweltbelastung, die dies über die gesamte textile Kette hinweg bedeutet, gehe ich in Kapitel 3 detailliert ein.
Das Wort Trend stammt vom englischen Verb „to trend“ ab und bedeutet wörtlich übersetzt „in einer bestimmten Richtung verlaufen“, „drehen“ oder „wenden“.19 Der Begriff hat einen beweglichen, richtungsweisenden Charakter: Er steht für Wandlungsprozesse und zeigt eine Richtung oder Fortsetzung von Besonderheiten auf, die Beständigkeit und gleichzeitig auch Umgestaltungskraft beinhalten. Trends veranschaulichen Veränderungen beziehungsweise Entwicklungen in allen Bereichen der Gesellschaft, Wirtschaft oder Technik. Darüber hinaus verdeutlichen Trends konsumbezogene Wünsche und Erwartungen möglicher Kunden. Sie machen Konsumbedürfnisse beobacht- und vorhersehbar, denn ein Kunde verfolgt oftmals Dinge, die seiner derzeitigen geistigen Orientierung entgegenkommen oder durch öffentliche Manipulation entstehen. Zusammengefasst ist ein Trend also auch Ausdruck des Zeitgeistes und der Zeitströmung. Im Vergleich zum Begriff Mode bezieht er sich jedoch weniger auf das modische Angebot oder das Objekt und dessen Gestalt an sich. Seine Bedeutung beinhaltet vielmehr das – auf mehr Aktualität ausgerichtete – Kauf- und Konsumverhalten und berücksichtigt auch modische Extravaganzen, da trendbewusste Konsumenten sich trauen, extrem Modisches oder Gewagtes zu tragen – oft ein Bekleidungsstil, der nicht gleichzeitig und beherrschend im Straßenbild auftaucht.20
Diverse Schichten der Gesellschaft bringen immer wieder eigene Moden und Trends hervor und so kommt es, dass manche Ausdrucksformen simultan nebeneinander bestehen. Auch daraus lässt sich der Begriff des Zeitgeistes ableiten, der die Summe der vom konkreten Zeitalter geprägten Empfindungs- und Anschauungsweisen darstellt. Der jeweilige Zeitgeist oder Zeitgeschmack manifestiert sich unter anderem in der Mode, weshalb sich entsprechende modische Tendenzen zwingend verbreiten und durchsetzen. Stilrichtungen, die nur bei wenigen oder zu kurzfristig Gefallen und Beachtung finden, werden daher nicht als Modeströmung verstanden.21
Trends und Moden können einen großen Einfluss auf zahlreiche unternehmerische Entscheidungen haben. Zukünftiges und Mögliches zu prognostizieren gestaltet sich jedoch oft als schwierig und bisweilen überaus komplex, sodass man lediglich approximative Lösungen ausprobieren kann. Prognosen über Trends werden von einer speziellen Trendforschung und entsprechenden Instituten vorgenommen. Manchmal dient diese Trendforschung lediglich der Informationsbeschaffung; oft ist sie aber Basis wichtiger Entscheidungen, wie etwa bei der Frage nach der Entwicklung und dem Ausgestalten angestrebter Produktlinien. Die Resultate der Trendforschung verhelfen den Unternehmen dazu, eigene Marktchancen zu identifizieren und zu optimieren, das Marketing knüpft hier an.
Methodisch eignen sich hierfür besonders Zeitreihenprognosen, Methoden des exponentiellen Glättens und nichtlineare Trend- und Wachstumsfunktionen. Ergebnisse dieser Verfahren sind gewichtige Ausgangspunkte zum Beispiel für Werbung und Warenpräsentationen – Bereiche, in denen es unerlässlich ist, sich fortwährend am Zeitgeist und an Trends zu orientieren, um die Waren für Kunden interessant zu halten, auch weil die Erwartungen und Ansprüche an Produkte und deren Präsentation unentwegt zunehmen. So kann beispielsweise die gezielte Umsetzung international einflussreicher Trends besondere Aufmerksamkeit beim Kunden hervorrufen. Freilich ist hierbei Professionalität gefragt, denn ein schlechtes Abbild einer tollen Aufmachung aus den Modemetropolen führt kaum zum Erfolg. Aus diesem Grund sind Trendanalysen immer auch mit den jeweiligen Gegebenheiten in Bezug zu setzen. Des Weiteren muss beachtet werden, dass dem eigenen Firmenimage nicht geschadet wird und dass die Aufnahme des Trends zum Unternehmen passt.22
Da auch Textilunternehmen und Schuhhersteller erfolgreiche Angebote konzipieren wollen, müssen sie sich in der Regel über die möglichen Ansprüche und Entwicklungen der Gesellschaft und insbesondere ihrer konkreten Zielgruppen Gedanken machen. Generell analysieren Textilunternehmen modische Entwicklungen und Trends, um originelle Textildesigns und innovative Effekte anzubieten, um selbst modische Entwicklungen und Trends zu beeinflussen oder gar zu erschaffen. Besonders die deutsche Textilwirtschaft hat sich allerdings inzwischen erfolgreich von der modisch unbeständigen und immer kurzfristiger zu beliefernden Bekleidungsindustrie unabhängig gemacht, indem sie sich auf die Entwicklung und Produktion Technischer Textilien konzentriert. Textilhersteller können sich auf diesem Wege verhältnismäßig „modeunabhängig“ halten, denn für ein Textil und den Stoffhersteller ist es belanglos, wie das Halbzeug später verarbeitet wird.
Unternehmen, Produktentwickler und Ingenieure im Bereich der Schuhtechnik können sich das jedoch nicht erlauben. Die Mehrheit der Schuhhersteller ist aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, sich Gedanken über Mode und Trends zu machen und genau abzuwägen, inwieweit und auf welche Art und Weise ihre Zielgruppe modisch eingebunden ist oder nicht. Selbst Schuhe, deren Aufbau maßgeblich von ihrer spezifischen Funktionalität abhängt, wie etwa beim Sport- oder auch Orthopädieschuhwerk, werden nach modischen Maßstäben und Tendenzen entworfen. Denn den Verkaufszahlen und dem Angebot nach zu urteilen legen auch hier viele Verbraucher nicht nur Wert auf eine gute Passform, angenehmen Tragekomfort und Pflegeleichtigkeit, sondern eindeutig auch auf den modischen Aspekt.23
Kapitel 2Geschichte und Entwicklung der Schuhtextilien
Nichts verdeutlicht so eindrücklich wie ein Blick in die Historie, dass Schuhe und Textilien schon seit jeher zur Evolution und Eigenart des Menschen gehören. Und dass die Entwicklungen, Arbeiten und technischen Verfahren auf diesen Gebieten ständigen Veränderungen und Innovationen unterliegen, die die Textil- und Schuhindustrie zu genau dem machen, was sie heute ist und bietet.
2.1 Die Schuhfertigung
In der Höhle von Altamira in Spanien befindet sich die älteste Abbildung eines Schuhs. Die Darstellung zeigt Jäger, die eine Art Bundstiefel tragen. Sie wurde vor ca. 12.000–15.000 Jahren gemalt. Die ältesten Sandalen wurden in Oregon/USA, die ältesten geschlossenen Schuhe in Missouri/USA ausgegraben, sie dürften ca. 8300 Jahre alt sein. Es handelt sich dabei um Fußbekleidung aus pflanzlichen Werkstoffen. In einer armenischen Höhle wurden die ältesten komplett erhaltenen Lederschuhe entdeckt. Sie stammen vermutlich aus der Periode zwischen Jungsteinzeit und Bronzezeit und dürften etwa 5500 Jahre alt sein. Schaft und Sohle bestehen aus Rindsleder, gefüttert wurden sie mit Gras. Die Schuhe der Gletschermumie Ötzisind ungefähr 5300 Jahre alt und zeichnen sich durch einen recht komplexen Aufbau aus:
Abb. 3: Replikat des Ötzischuhs24
Ihr Schaft (Außenschuh) besteht aus Hirschleder, wobei die Haarseite nach außen gearbeitet wurde, um Feuchtigkeit abzufangen. Die Sohle ist aus Bärenfell gefertigt, wobei die Haarseite hier zur Wärmeisolierung ins Schuhinnere gelegt wurde. Ötzis Schuhe weisen zudem die älteste bekannte Profilsohle auf, quer und kreuzartig befindet sich je ein Streifen aus Leder auf den Bärenfellsohlen. Die Schuhe beinhalten auch Innenschuhe aus Lindenbast, geflochten und gezwirnt. Zwischen den Innenschuh und das Schaftmaterial wurde ein Polster- und Isolierfutter aus Heu gestopft. Auch zahlreiche antike und mittelalterliche Ausgrabungen und Hinterlassenschaften (zum Beispiel ägyptische und römische Sandalen, etruskische Holzpantoffeln, ritterliche Schnabelschuhe, königliche Absatzschuhe) beweisen, dass Schuhe immer eine besondere Bedeutung für den Menschen gehabt haben und zum Teil sogar Macht- oder Herrschaftssymbole waren.
Abb. 4: Schuhe aus Samt mit Stickereien, 19. Jahrhundert25
Der Mensch versuchte schon früh, seine Füße vor Verletzungen, Hitze, Kälte und Nässe zu schützen und hat sich entsprechende Fußbekleidungen konstruiert. Dabei entstanden auch immer wieder neue Materialien wie Leder, neue technische Methoden wie Gerben, unterschiedlichste Modelle und Moden sowie der Beruf des Schuhmachers. Im 5. vorchristlichen Jahrhundert hat sich der Beruf des Schuhmachers von dem des Gerbers getrennt und mit der Zeit entwickelte sich die Schuhfertigung zu einem richtigen Handwerk, das viele Beschäftigte aufwies. Diese Entwicklung änderte sich mit der Einführung der maschinellen Schuhproduktion ab ca. 1870 drastisch. Durch die Industrialisierung ist die Anzahl der Handwerker auf ein Minimum zurückgegangen. Zahlreiche Produkte wurden vereinheitlicht, um sie möglichst billig herstellen und anbieten zu können und damit letztlich vor allem den Gewinn zu steigern. Design und Anfertigungstechniken wurden fortan der maschinellen Serienfertigung angepasst. Mittlerweile wird die große Mehrheit aller Schuhe industriell gefertigt. Gleichsam entstand früh eine kleine, aber erfolgreiche und beständige Spezialisierung des Maßhandwerks. Entsprechende Produkte zeichnen sich durch Einzigartigkeit, individuelle Anpassung, spezifische Fachkompetenz, viel Kreativität, eine hohe Qualität und oft einen hohen Preis aus. Sie sind in gehobenen Gesellschaftsschichten äußerst beliebt. Auch im Bereich der industriell gefertigten Schuhe gibt es heute eine spürbare Tendenz zu mehr Individualität und Maßarbeiten, was sich zum Beispiel in Angeboten zur Individualisierung zeigt.26
Zusammenfassend lässt sich für die Gesamtentwicklung feststellen, dass die fortwährende innovative Erarbeitung neuer Verfahrenstechniken, Arbeitsweisen, Modelle und Materialien ein wichtiges Fundament der Schuhfertigung ist.
2.2 Die Textilindustrie
Die Produktion von Textilien, also die Bearbeitung von Tierhaaren, Pflanzenfasern und Chemiefasern zu Garnen, Geweben und anderen Textilprodukten, repräsentiert eine der ältesten gewerblichen Tätigkeiten des Menschen. Vor kurzem hat man in einer Höhle in der Nähe des Toten Meeres die ältesten jemals gefundenen Textilien entdeckt. Dabei handelt es sich um Reste von Kleidung, Fasern, Seilen und Matten. Sie stammen sehr wahrscheinlich aus der Zeit um 9000 v. Chr. Bereits 3000 Jahre vor unserer Zeitrechnung hat der Mensch im Raum Indien und im heutigen China nachweislich Baumwolle verarbeitet; Funde aus Mexiko gehen sogar auf 5800 Jahre v. Chr. zurück. Aus China existieren Seidengewebe, die ca. 2000 Jahre v. Chr. entstanden sind. Zudem gibt es Nachweise, dass Mitteleuropäer schon vor 6000 Jahren mit Handspindeln und Gewichtswebstühlen Flachs verarbeitet haben.
Historische Aufzeichnungen aus Griechenland erwähnen bereits im 5. Jahrhundert v. Chr. „wollähnliche Haare auf Bäumen“ (in Indien) – sie schienen zu dieser Zeit zumindest schon bekannt gewesen zu sein. Um 325 v. Chr. hat Alexander der Große dann erwiesenermaßen erste Baumwollgewebe von Indien nach Europa gebracht, die Osmanen haben im 8. Jahrhundert n. Chr. erstmals Baumwollprodukte im großen Stil nach Europa importiert. Erst 300 Jahre später verbreiteten sich Baumwollerzeugnisse im Rest Europas. Arabische Händler brachten die Baumwolle im 13. Jahrhundert nach Spanien und Sizilien. Erst im 14. Jahrhundert wurde sie auch in Süddeutschland, in Konstanz, Ulm und Augsburg, vermehrt verarbeitet, wo sie versponnen und anfangs meist zusammen mit Leinen auch verwebt wurde. Bereits im Mittelalter hat sich das Weben zu einem bedeutenden, sehr spezialisierten Handwerksberuf entwickelt.27 Hofer sieht in der Verarbeitung von Baumwolle im urbanen Raum zu Zeiten des Mittelalters sogar erste Züge der Industrialisierung:
„Die Einfuhr der Baumwolle in die süddeutschen Leinweberstädte Mitte des 14. Jahrhunderts läutete gleichzeitig den Beginn des industriellen Zeitalters ein. Während Leinen handwerklich verarbeitet wurde und daher den Bindungen der Zünfte unterlag, nahmen die Kaufleute, die kein Interesse an zunftartigen Zusammenschlüssen hatten, die Produktion von Baumwollgeweben in die Hand und lösten sie aus dem mehr oder weniger hausindustriellen Charakter der übrigen Zweige des Textilgewerbes. Schon früh gab es in der Baumwollverarbeitung industrielle Massenproduktion.“28
Jahrtausendelang ist die textile Fertigung der bedeutendste Bereich der gewerblichen Produktion gewesen, wobei sie fast ausschließlich Hausgewerbe war – etwas Anderes haben die agrarischen Wirtschaftsstrukturen kaum zugelassen. Dies änderte sich erst, als die Stadtwirtschaft sich weiterentwickelte und sich während des Mittelalters zunehmend Textilhandwerker in den Städten ansiedelten. Mit ihren Produkten und Erzeugnissen orientierten sie sich am Markt. Im Merkantilismus des 16. und 18. Jahrhunderts bestimmte insbesondere der Staat, wie und was produziert werden durfte. Mit der staatlichen Organisation und Lenkung wurde während dieser Zeit das Fundament für die textilgewerblichen Massenproduktionen gelegt: eine wichtige Voraussetzung für das spätere Wachstum der Textilindustrie.
In Amerika hat der Baumwollanbau zwischen den Jahren 1661 und 1694 begonnen. Im Zusammenhang mit der Sklavenarbeit hat er die USA zum größten Baumwollproduzenten und einem der reichsten Staaten der Welt gemacht. In Europa hat der 30-jährige Krieg (1618–1648) dazu geführt, dass Augsburg Flandern und England als Marktführer in der Baumwollverarbeitung ablöste, da es vom Krieg verschont geblieben war. 1733 hat der Engländer John Kay den Schnellschützen (ein Webschiffchen) erfunden, sodass die Produktivität der Webstühle verdoppelt werden konnte und sich die Marktanteile der europäischen Länder wieder neu ergaben. Schließlich haben 1764 die Erfindung der Spinnmaschine und 1784 die des mechanischen Webstuhls die erste große industrielle Revolution im textilen Bereich ausgelöst. Derartige Erfindungen haben die Textiltechnik nachhaltig verändert sowie die Herstellung in Fabriken etabliert. Damit begann die industrielle Produktion, wie wir sie heute kennen, und die erste Industrie – die der Textilien – ist entstanden.
Die industrielle Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wird als die grundlegende und dauerhafte Umgestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, der Arbeitsbedingungen und Lebensumstände gesehen. In den folgenden 180 Jahren veränderten neue Erfindungen und Weiterentwicklungen die Industrie fortwährend. Zuerst hat sich England zum vorherrschenden Textilproduzenten entwickelt, da die Mechanisierung des Spinnens und Webens dort ihren Anfang genommen hatte. Somit gilt die Baumwollindustrie als Schlüsselindustrie





























